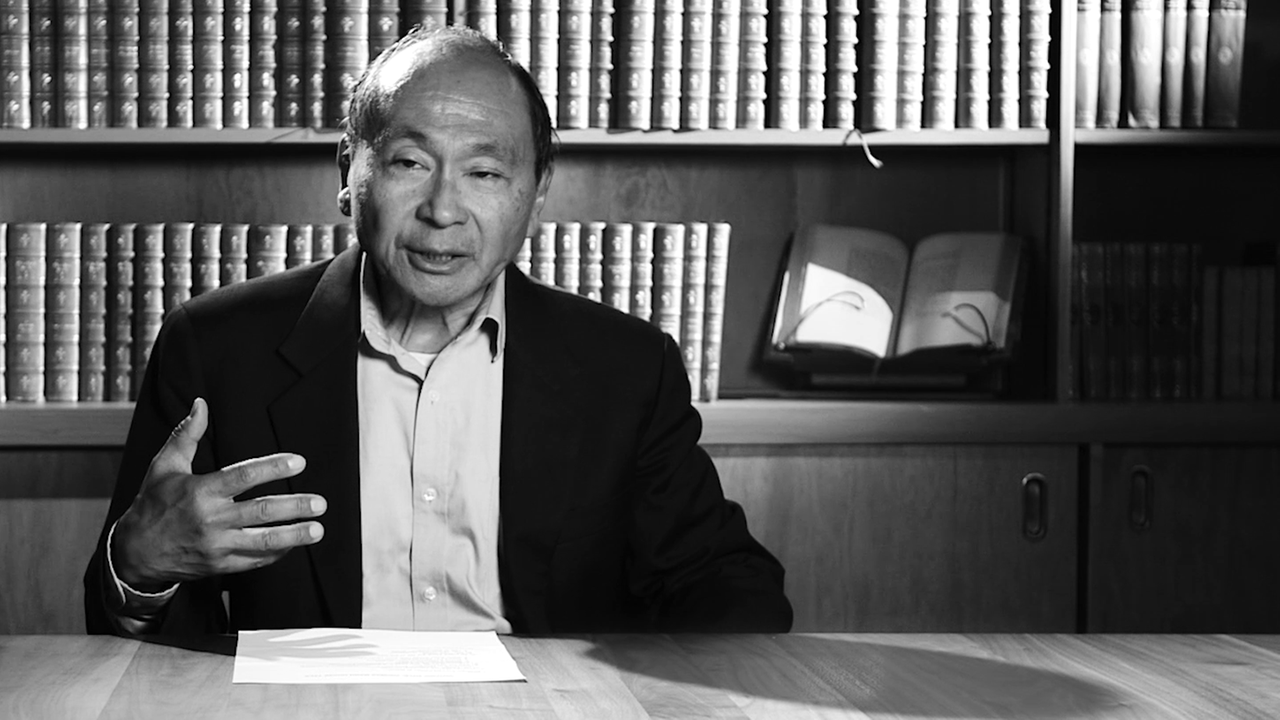Den Kampf für die Demokratie ausfechten, das tun sie: Der Philosoph Rainer Forst und die Soziologin Jutta Allmendinger, aber auch die Protestierenden in Belarus, die Kämpfer*innen gegen Rassismus in den USA, junge Demonstrierende in Hongkong. Einzelne, die reflektieren, mahnen, öffentlich sprechen. Oder ganze Massen, die auf die Straße gehen, Rechte fordern, ihr Leben riskieren. Viele Stimmen für die Demokratie - zusammen ein Chor.

Seit Herbst 2019 fügt das Thomas Mann House in Los Angeles diesem lautstarken Chor für die Demokratie regelmäßig neue Stimmen hinzu. "55 Voices for Democracy" heißt das Projekt: kurze Reden Intellektueller. Über die kommenden fünf Jahre sollen sich tatsächlich 55 solcher Ansprachen ansammeln. In Anlehnung an die 55 BBC-Reden, die Thomas Mann zwischen 1940 und 1946 aus dem amerikanischen Exil an die deutschen Hörer richtete: gegen Nazideutschland, für die Demokratie. Francis Fukuyama, Timothy Snyder, Ananya Roy und Jan Philipp Reemtsma haben bereits ihre Beiträge aufgezeichnet. Seit Anfang dieses Jahres kamen die Amerikanistin Heike Paul und die Kulturkritikerin und Genderforscherin Karen Tongson dazu. Auch Rainer Forst und Jutta Allmendinger hielten im Rahmen von 55 Voices for Democracy Reden, diesmal in der Paulskirche in Frankfurt. An jenem Ort also, an dem die deutsche Demokratie 1848 ihren Anfang nahm und wo 1949 Thomas Mann nach dem Krieg erstmals wieder in Deutschland sprach.
Bisherige Essays aus 55 Voices For Democracy
- Politologe Francis Fukuyama "Wir sind in einer globalen Demokratie-Krise"
- US-Historiker Timothy Snyder Zurück in eine Politik der Zukunft
- Urbanistin Ananya Roy Menschen retten - nicht den Kapitalismus
- Publizist Jan Philipp Reemtsma Demokratie als minimaler Schutz vor Grausamkeit
"Ich glaube, man würde gar keine bessere Zeit finden als jetzt, die Parallelen aufzumachen zu der Zeit, wo Thomas Mann seine Reden gehalten hat. Es gibt ja auch ein paar Parallelitäten: nicht jetzt durch Exil oder NSDAP-Bedrohung, aber man hat ja heute eine Situation, wo man vor wenigen Leuten steht, aber viele Leute erreicht", sagt Jutta Allmendinger.
Rainer Forst meint: "Das ist schon ein ungewohntes Sujet, so eine kurze Mahnrede oder Erinnerungsrede oder aufrüttelnde Rede, aber ich denke es ist ein interessantes Experiment, so etwas zu machen, weil man pointiert Probleme benennen kann und einen bestimmten Zugang zu möglichen Lösungen."
Fast überrascht es, dass Rainer Forst es ungewohnt findet, in nur knapp zwölf Minuten Wert und Wesen der Demokratie zu verteidigen. Der Professor für politische Theorie und Philosophie an der Goethe Universität in Frankfurt ist Sprecher zahlreicher Forschungsgruppen und scheut nicht die mediale Präsenz. Neben den wissenschaftlichen Publikationen plädiert er in Artikeln und Interviews für soziale Gerechtigkeit, für die Fähigkeit, Konflikte auszutragen, und für Toleranz. Inbegriffe demokratischen Denkens und Handelns, die wir zu verlernen drohen. Zumindest nicht genug pflegen, so seine These in Frankfurt. Dass drei Tage vor seiner Rede in Berlin bei einer Demonstration gegen Corona-Maßnahmen Reichsflaggen geschwenkt werden, ist nur eines der vielen Anzeichen für das, was Rainer Forst "Verwahrlosung" der Demokratie nennt. Sie ist unser aller Versagen und ihr kann nur mit klaren Konzepten, Urteilen und dem Mut zur Vernunft begegnet werden. In seiner Rede spricht Rainer Forst nicht nur davon, sondern führt vor, was damit gemeint ist:
Rainer Forst: Die Verwahrlosung der Demokratie
Auszug aus der Rede von Rainer Forst, Professor für politische Theorie und Philosophie an der Goethe-Universität Frankfurt
Mit "Verwahrlosung" der Demokratie meine ich Prozesse des Verkommenlassens, die von innen stammen, die aus einem falschen, aber verbreiteten Demokratieverständnis herrühren und dabei blind machen für den Übergang der Demokratie ins Autoritäre, also für eine Verkehrung, in Frankfurt sagt man: eine Dialektik der Demokratie. Solche immanente Verwahrlosung zeigt sich daran, dass die Begriffe verrutschen – und es etwa die Möglichkeit "illiberaler Demokratie" geben soll oder jemand "Wir sind das Volk" ruft und eigentlich die Unmenschlichkeit propagiert. Mit Thomas Mann gesagt, sind es solche "gestohlenen Worte", für die wir ein Sensorium brauchen.

Auf dem Wege der Realisierung der Demokratie ist das Mehrheitsprinzip, das sich gegen die Herrschaft der Wenigen wendet, essenziell. Aber es schlägt in sein Gegenteil um, wenn dies zu neuer Klassenherrschaft führt, und sei es die der viel zitierten "Mittelklasse", die die Armut anderer nicht mehr kümmert, solange sie selbst zu profitieren glaubt. Die Ignoranz gegenüber der Lebenslage derer etwa, die ihr Kind nicht auf eine Klassenfahrt mitschicken können, ist ein deutliches Zeichen der sozialen Verwahrlosung in einer Demokratie. Eine begriffliche Trennung von Demokratie und Gerechtigkeit ist ihr theoretischer Ausdruck.
In Deutschland ist das Wort "Volk" als Übersetzung für "demos" historisch belastet. Die Herrschaft des Volkes über sich selbst, ein emanzipatorischer politischer Anspruch, kann so verkommen zur Vorherrschaft derer, die "wirklich" Deutsche zu sein meinen, denen gegenüber, die nicht richtig dazugehören oder nur geduldet sind. Die "Nation" wird zur ethnischen Familie, sie schließt sich ab und andere aus. Wie lange noch müssen sich Menschen mit türkischstämmigen Namen in deutschen Amtsstuben und Firmen wegducken, wenn sie einen Anspruch geltend machen wollen? Solche Exklusion erhält besonders im Westen der Bundesrepublik nicht selten eine religiöse Pointe, der zufolge die Demokratie recht verstanden christliche Wurzeln habe und die den Islam als demokratieunverträglich auf die Plätze des Nachsitzens verweist.
Der völkische Demosbegriff, bis hin zur Xenophobie und zum Rassismus gesteigert, ist ein die Demokratie in die extreme Verwahrlosung treibendes Gedankengift. Wie die Geschichte der USA bis in die jüngste Gegenwart hinein zeigt, prägt der Rassismus aber auch dort, wo die "Nation" ganz anders entstand, die Strukturen einer Gesellschaft nachhaltig; die Wunde der einstigen Sklaverei verheilt nicht.
Nicht minder bedenklich ist die spiegelbildliche Verwahrlosung aufseiten von Eliten, die sich vom sogenannten "Pöbel" abwenden und die Reproduktion ihrer Privilegien nicht nur geschickt sichern, sondern sich auch dafür rühmen, das Niveau der Gesellschaft zu heben und zu schützen. Es gibt kaum eine existierende Demokratie, in der sich nicht solche Blasen der Abgehobenheit finden, die den Rufen nach Demokratisierung der Gesellschaft und der Rechtfertigungsbedürftigkeit extremen Reichtums so elegant aus dem Weg zu gehen vermögen.
Die Elitenkritik wird aber aufs falsche Gleis geleitet, wenn sie nicht zwischen ihrer Berechtigung durch marginalisierte soziale Gruppen und der Niedertracht derjenigen unterscheidet, die etwa die Entscheidung der Aufnahme von Flüchtenden 2015 als "undemokratisch" geißeln und doch nur meinen, dass diese Leute hier nichts zu suchen haben – und damit zeigen, dass ihnen Menschenrechte gleich sind. Die Klage Unterprivilegierter ist demokratisch unabdingbar, der blinde Hass aber auf Gruppen, die noch weniger Privilegien haben, denen man solche aber andichtet, drückt schiere Menschenverachtung aus.
Der Begriff der Demokratie verrutscht, wenn sie als voluntaristisches Instrument der Mehrheitsmacht verstanden wird und nicht selbst mit Grundrechten, die die Gleichheit aller sichern, verknüpft wird, sodass sie durchaus "illiberal" agieren könne. Und er kommt auch dort auf die schiefe Bahn, wo diese Gleichheit nicht mehr als Gerechtigkeitsimperativ ernst genommen wird, ob von denen "oben", in der "Mitte" oder "unten". Und dort, wo der demokratische Streit verroht zur unerbittlichen Feindschaft, zur Lüge und Tatsachenverdrehung bis hin zur Leugnung des Klimawandels oder der Existenz eines Virus mit entsprechenden Verschwörungstheorien.
Rainer Forst ist Professor für politische Theorie und Philosophie an der Goethe-Universität Frankfurt. Er ist Mitbegründer und Sprecher des Forschungsverbundes ("Exzellenzcluster") "Normative Ordnungen" und der DFG-Forschergruppe "Justitia Amplificata". Seine Forschung befasst sich mit Fragen der Gerechtigkeit, Demokratie und Toleranz sowie mit kritischer Theorie und praktischer Vernunft.
Vernunft, Rationalität, Urteilskraft, sagt Rainer Forst im Anschluss an die Beschreibung all der aktuellen Irrwege demokratischen Denkens und Handelns, sind die zentralen Gegenmittel. Damit Demokratie eben nicht verwahrlost, diese "alte Dame", die schon so oft bedroht schien, dafür aber eigentlich immer noch recht wacker dasteht, meint im Gegensatz zu Rainer Forst jedenfalls die Soziologin Jutta Allmendinger. Zu Beginn ihrer Rede am 2. September in der Paulskirche schlägt sie einen liebevollen Ton an und signalisiert ihre Hochachtung vor der alten Dame Demokratie. Statt Verwahrlosung konstatiert die Präsidentin des Zentrums für Sozialforschung am Wissenschaftszentrums Berlin Vertrauen: Die Deutschen vertrauen in die Demokratie. Pflege und Aufmerksamkeit braucht sie aber trotzdem, gerade in Zeiten der Pandemie. Denn Corona stellt das demokratische Miteinander auf den Prüfstein. Vertrauen reicht nicht. Vertrauen braucht Begegnungen, Wissen und Teilhabe.
Jutta Allmendinger: Das große Wir verliert an Boden
Auszug aus der Rede der Soziologin Jutta Allmendinger
Liebe Bürgerinnen und Bürger,

das Virus ist ein zwittriges Biest. Zahm und fast einnehmend wirkt es gegenüber der Familie, Freunden, engen Kolleginnen, dem "kleinen Wir", wie ich es nenne. Diese Beziehungen werden enger, man lernt sich (wieder) besser kennen. Sorge und Fürsorge sind der Grund dafür. Stachelig und ausgrenzend wirkt das Virus gegenüber Fremden. Wenn wir nicht persönlich miteinander kommunizieren können, dann verkümmern unsere Sinne: Unser Radius wird kleiner, die Brücken, welche die vielen kleinen Wirs verbinden, werden brüchig.
Das große Wir verliert noch mehr an Boden. Und so tut man sich mit Gleichen zusammen. Wir sehen schon seit Langem in unseren Städten: Die Kieze werden immer homogener, die Unterschiede zwischen Stadtteilen immer größer. Diese Schließung sozialer Kreise wird durch dieses heimtückische Virus begünstigt. Der klare Auftrag an uns ist: So wie wir gegen die tödliche Krankheit kämpfen, so müssen wir auch gegen das Absterben sozialer Räume kämpfen.
Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter,
lassen Sie uns achten auf unsere Demokratie. Dazu gehört auch, dass wir eintreten für die Teilhabe möglichst aller in unserer Gesellschaft. Und gerade in diesen Tagen, Wochen, Monaten wird überdeutlich: Frauen haben diese Teilhabe in vielen wesentlichen Bereichen unseres Landes nicht. Niemand kann wollen, dass sich Frauen wieder zurückziehen ins eigene Heim, in ihre eigenen vier Wände, um dort zu arbeiten, Seite an Seite mit ihren Sprösslingen. Wieder zur wartenden Mutter werden, mit dampfenden Töpfen für Kinder, deren beste Nachhilfelehrerin und Chauffeurin. Niemand kann wollen, dass Frauen ver-heimlicht werden – im wortwörtlichen Sinne nicht mehr gesehen werden im öffentlichen Raum. Die Grenzlast ist in der Pandemie für Frauen ungleich höher als für Männer. Verantwortung für die Demokratie zu übernehmen heißt auch, alles zu unternehmen, dass wir Frauen besser stellen, leistungsgerecht entlohnen, ihnen mehr Optionen geben, sie nicht aus dem öffentlichen Raum verlieren, in dem sie noch immer nicht genügend präsent sind.
Liebe Demokratinnen und Demokraten,
die Zustimmung zur und die Zufriedenheit mit der Demokratie wird nicht von allen geteilt. Sie kommt gebildet daher und mit Geld in der Tasche. Die Unterschiede sind immens, und sie werden größer. Überhaupt nicht zufrieden mit unserer Demokratie sind 25 Prozent der Menschen, die zur Arbeiterschicht gerechnet werden, verglichen mit 7 Prozent der oberen Mittelschicht. Was wir in diesen Monaten aber sehen, ist eine weitere Spreizung der Teilhabe und eine Gefahr für unsere demokratischen Fundamente. Heinz-Elmar Tenorth spricht von einer Refeudalisierung, die wir durchlaufen. Es ist leider die richtige Bezeichnung.
Wir brauchen also neben dem Paritätsgesetz, welches auf die größere Inklusion von Frauen abzielt, Maßnahmen, die dazu führen, dass mehr Menschen aus Arbeiterschichten und mit niedrigerer Bildung in unseren demokratisch gewählten Gremien vertreten sind. Und natürlich müssen wir die Bildungsarmut abbauen.
Die Stärkung des öffentlichen Raumes, ein entschiedenes Nein zur Retraditionalisierung und Refeudalisierung unserer Gesellschaft sind wesentlich für die weitere Stärkung unseres Vertrauens in die Demokratie und unseren Einsatz für sie.
Jutta Allmendinger studierte Soziologie und Sozialpsychologie an der Universität Mannheim, anschließend studierte sie Soziologie, Volkswirtschaftslehre und Statistik an der University of Wisconsin. 1987 wurde sie an der Harvard University promoviert. Seit April 2007 ist sie Präsidentin des WZB Berlin, Zentrum für Sozialforschung. Im Jahr 2013 erhielt sie das Bundesverdienstkreuz Erster Klasse der Bundesrepublik Deutschland.
Keine Frage, für die Soziologin Jutta Allmendinger, ist die Wahrheit selbstverständlich, dass eine Demokratie, in der Frauen nicht auf allen Ebenen beteiligt sind, keine Demokratie ist. Das war nicht immer so. Wie lange und steinig der Weg zu dieser Selbstverständlichkeit war und welche Ausgrenzungen er selbst erzeugt hat, das ist der Ausgangspunkt der Rede von Heike Paul. Die Inhaberin des Lehrstuhls für Amerikanistik an der Universität Erlangen-Nürnberg ist dieses Jahr Fellow des Thomas Mann Hauses in LA. Im März wurde das Video mit ihrem Beitrag zu "55 Voices for Democracy" online gestellt. Heike Paul beginnt damit, an all die Frauen zu erinnern, die seit Mitte des 18. Jahrhunderts in Amerika für das Frauenwahlrecht gekämpft haben. Bis es schließlich – vor hundert Jahre – in der Verfassung verankert wurde. Ein Meilenstein für den Feminismus und die Demokratie, nicht aber das Ende eines bis heute nötigen feministischen und demokratischen Engagements. Das sich immer auch der eigenen Abwege bewusst sein muss und vor allem: seine Perspektiven weiten muss.
Heike Paul: Der Ruf nach alternativen horizontalen Zugehörigkeiten
Auszug aus der Rede von Heike Paul, Inhaberin des Lehrstuhls für Amerikanistik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
In diesem Jahr, 2020, feiern wir die Verabschiedung des 19. Zusatzes zur US-amerikanischen Verfassung, der amerikanischen Frauen vor 100 Jahren das allgemeine Wahlrecht gewährte und ihnen zumindest formal den Zugang zu dem System sicherte, das amerikanische Demokratie genannt wird. Zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Zusatzartikels beeindruckte das politische, soziale und kulturelle Klima der sogenannten Progressiven Ära nicht wenige Besucherinnen der Vereinigten Staaten. Alice Salomon, eine bekannte deutsch-jüdische Pädagogin, schrieb in ihrem Reisebuch: "Immer, schon nach meinem ersten Besuch in den Staaten, ist mir klar gewesen, dass – sofern ich noch einmal als Frau auf die Welt kommen sollte – ich nur wünschen würde, in den Vereinigten Staaten geboren zu werden."
Trotzdem war Salomons feministische Interpretation der einflussreichen utopischen Tradition in und über Amerika vielleicht etwas zu enthusiastisch. Zum einen lag ihr Fokus hauptsächlich auf den Privilegien der weißen Frauen der Mittelschicht, zum anderen fiel ihre Einschätzung der Situation mit einer damals in den USA grassierenden Welle der Fremdenfeindlichkeit zusammen, die schließlich zur Verabschiedung des restriktiven Einwanderungsgesetzes von 1924 führte. Die erfolgreiche Einbeziehung einiger Frauen in den politischen Prozess ging Hand in Hand mit einer neu institutionalisierten Diskriminierung, d.h. dem Ausschluss anderer "Anderer". Haben wir aus diesen Lektionen und Erfahrungen gelernt?
Schauen wir in die Gegenwart: In den meisten aktuellen Einschätzungen überwiegen die dystopischen gegenüber den utopischen Vorstellungen, und viele von uns würden wohl kaum in Salomons Wunsch nach einer Wiedergeburt in Amerika einstimmen. Ein wiederkehrendes Thema in dem jüngst wieder aufblühenden Genre der feministischen Dystopie sind verschiedene Arten repressiver autoritärer Regime, die in den Vereinigten Staaten der Jetztzeit bzw. der nahen Zukunft angesiedelt sind.
Die in diesen dystopischen Romanen beschriebenen fundamentalistischen Re-Nationalisierungen erscheinen leider weder sehr weit hergeholt noch völlig unrealistisch. Sie sind vielmehr Spiegel bzw. Übersteigerung des nicht nur in den USA, sondern in vielen westlichen Demokratien an Dynamik gewinnenden Backlash mit seinen Versuchen, den Feminismus entweder einzudämmen, zu verbieten und zu kriminalisieren oder ihn sich im Namen einer rechten, autoritären Ideologie anzueignen. Die Verwendung des Labels "Feminismus" kann zuweilen ebenso problematisch sein wie in der Vergangenheit die Verwendung des Labels "Demokratie".
Wo, wie in jüngster Zeit, der Begriff des Feminismus rhetorisch von rechts gekapert wird, werden multikulturelle und kosmopolitische Ideale von einem wiederbelebten Ethno-Nationalismus abgelöst (der stark an den Nativismus vor hundert Jahren erinnert). Wie Sara Farris in ihrer Betrachtung der europäischen politischen Kultur feststellte, erzeugt eine kulturelle Nationalisierung "im Namen der Frauenrechte" eine Art Pseudo-Feminismus. Dieser "Aufstieg des Femonationalismus" auf beiden Seiten des Atlantiks bedient sich nativistischer Reinheitsfantasien, fixiert sich auf die Rettung (weißer) Frauen vor ausländischen, die Grenzen überschreitenden nicht-weißen Männern und fordert sofortiges Handeln.
Aktivistinnen der schwarzen Diaspora haben schon lange dynamische Formen der Zugehörigkeit jenseits der Nation konzipiert. Mit den Worten von Audre Lorde: "Gemeinschaft darf nicht bedeuten, unsere Unterschiede aufzugeben, und auch nicht die erbärmliche Vorstellung zu hegen, dass diese Unterschiede nicht existieren." Die Manifeste von Chimamanda Ngozi Adichie, Mary Beard, Marie Rotkopf und Sara Ahmed, um nur einige zu nennen, mögen bisweilen Genrekonventionen aufbrechen und politisch vielstimmig sein. Ganz sicherlich jedoch versuchen sie alle, der düsteren Politik eines dystopischen, aktuell immer realer werdenden Heteropatriarchats mit einem programmatischen Ruf nach alternativen horizontalen Zugehörigkeiten zu begegnen.
Heike Paul ist Inhaberin des Lehrstuhls für Amerikanistik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Ihre kulturwissenschaftliche Forschung konzentriert sich insbesondere auf Formen und Funktionen des Sentimentalen und auf Dimensionen des impliziten Wissens. Sie ist Thomas Mann House Fellow 2020 und Trägerin des Gottfried Wilhelm Leibniz-Preises.
Der feministische Kampf muss heute ein Kampf gegen jede Art der Diskriminierung und Unterdrückung von Minderheiten sein, so die Amerikanistin Heike Paul in ihrer Rede für das Projekt "55 Voices für Democracy". Ein Aufruf, der im Amerika 2020 vor den Präsidentschaftswahlen auch der Genderforscherin und Kulturkritikerin Karen Tongson wichtig war.
Ihre Ansprache hielt sie Anfang Oktober im Thomas Mann Haus in LA. Die Professorin für Englisch, Gender Studies sowie Amerikanistik und Ethnizität an der University of Southern California wurde in Manila geboren und emigrierte 1983 in die USA. Wo sie aber nicht ihren Kindheitstraum von Freiheit und echter Demokratie verwirklicht fand. 1983 ebenso wenig, wie heute. Wobei Karen Tongson in ihrer Rede vor allem aus ihrer Ablehnung und Abscheu gegen Donald Trump keinen Hehl macht. Nicht alle Schandtaten des Präsidenten wolle sie referieren. Aber die aktuellen sozialen und politischen Verwerfungen im Land mitsamt der Zustände aufgrund der Pandemie benennt sie dann doch. Sie machen anschaulich, wie sehr die amerikanische Demokratie auf dem Spiel steht.
Karen Tongson: Demokratie am Abgrund
Auszug aus der Rede der Kulturkritikerin und Genderforscherin Karen Tongson
Mehr als acht Millionen Amerikaner haben sich mit dem Coronavirus infiziert, mehr als 225.000 sind bereits an der Covid-19-Pandemie gestorben, und zwar infolge des Fehlverhaltens des Trump-Regimes und der von Trump selbst eingeräumten Täuschung. In meinem wunderschönen Heimatstaat Kalifornien zerstören Waldbrände Leben und Land, und das inmitten all der anderen Verwüstungen, die unsere Klima-Apokalypse verursacht. Während in Erinnerung an unsere von der Polizei ermordeten schwarzen und braunen Brüder und Schwestern der zivile Widerstand gegen den systemischen Rassismus dieser Nation andauert, legitimieren die Regierung und ihre Propagandaorgane zunehmend rechtsradikale und rassistische Gruppen. Gegen die Vertreter der freien Presse, die von einer militarisierten Polizei offen beschossen, verprügelt und festgenommen wurden, wird weiterhin autoritär vorgegangen. Und jeder, der sich gegen den Faschismus ausspricht, wird auf die gleiche Weise, und auch von noch finstereren Kräften, brutal behandelt.
Die Demokratie in den USA steht am Rande des Abgrunds.
Wie jeder, der nicht zu den Ureinwohnern dieses Landes gehört, bin ich eine Immigrantin in den USA. Und wie Thomas Mann, der von einem autoritären Regime nach Los Angeles ins Exil getrieben wurde, zog auch ich aus einem Land - den Philippinen -, das von einem Diktator - Ferdinand Marcos - beherrscht wurde, nach Südkalifornien. Ich wurde 1973 geboren, ein Jahr nachdem Marcos das Kriegsrecht erklärt hatte.
Es ist kein Wunder, dass ich als Kind von einer Demokratie jenseits der leeren, pseudodemokratischen Gesten des Regimes träumte, mit dem ich in Manila aufgewachsen war. Normalerweise kommt jetzt der erhebende Teil der Geschichte, in dem man "nach Amerika kommt", erwachsen wird, seine Rechte ausübt - und das nur wenige Jahre, nachdem man angesichts der Fernsehbilder der "People's Power"-Revolution 1986 im eigenen Lande Tränen vergossen hatte. Jetzt müsste ich eigentlich mit feierlichem Blick direkt in die Kamera starren und alle auffordern: "Geht wählen!" Doch leider endet der Kampf nie mit der Gründung einer Demokratie - mit ihr beginnt er erst.
"Freiheit" bedeutet nichts ohne die Umverteilung von Macht und Ressourcen und ohne Fürsorge für die Entrechteten. Demokratie bedeutet nichts, wenn sie nicht mit einer Aufarbeitung von Kolonialismus, Völkermord und Versklavung einhergeht, sie bedeutet nichts ohne die Auseinandersetzung mit einer alltäglichen Entrechtung, an die wir uns durch einen Kapitalismus gewöhnt haben, den wir mit "Freiheit" verwechseln.
Genauso, wie das Böse und der Terror das Banale zu instrumentalisieren gelernt haben, um auf bürokratischem Wege Schaden anzurichten, so können auch wir im Alltag Akte des Widerstands und der Heilung vollziehen.
Wir haben uns derart an das Drama und die großen Gesten des Widerstands gewöhnt, dass wir vergessen, wie selbst die kleinsten Weigerungen, Befehlen zu folgen, das Potenzial haben, unseren Nächsten zu retten, die Welt zu retten. Wir sind aufgefordert, das Heilungspotenzial in unserer beschädigten Demokratie zu erkennen. Dafür ist jetzt der Moment gekommen.
Es liegt in unserer Macht - einer Macht, die wir fälschlicherweise als begrenzt wahrnehmen -, uns zu verweigern und zu widerstehen, bis keine Möglichkeiten mehr übrig bleiben, Gräueltaten zu begehen. Wir können gemeinsam eine Kette der Verbundenheit und des Widerstandes bilden, die es ermöglichen wird, die letzten Überreste dieser repräsentativen Demokratie zu erhalten, bis wir schließlich durch unsere Träume etwas Besseres Wirklichkeit werden lassen.
Karen Tongson ist Professorin für Englisch, Gender Studies und Amerikanistik & Ethnizität an der University of Southern California. Ihre Texte erschienen u.A. in der Washington Post. Sie wurde in Manila geboren und emigrierte 1983 in die USA.
Ketten des Widerstandes und die Macht der Träume sind es also, die Genderforscherin und Kulturwissenschaftlerin Karen Tongson für nötig hält, um der Demokratie zum Sieg zu verhelfen. Gerade im tief gespaltenen Amerika ein Appell, dem man Wirkung wünscht und Macht.
Dass alle Demokrat*innen ein Teil dieses Chores sind, ob in Videoansprachen, auf der Straße und im Alltag; dass dieser Chor vielstimmig bleiben muss, laut, unüberhörbar, ist die so schlichte wie herausfordernde Essenz aller vier Reden. Weil – auch dies die traurige Schnittmenge der Beitragenden – Demokratie vielerorts unter Beschuss steht. Sie wird überleben, das ja, aber wir müssen uns um sie kümmern, vernünftig sein, mutig, widerständig, weitsichtig und fähig zu Vertrauen und zum Träumen.