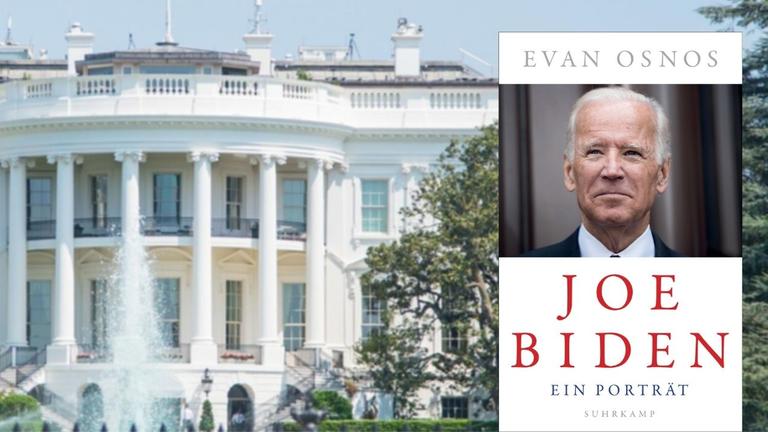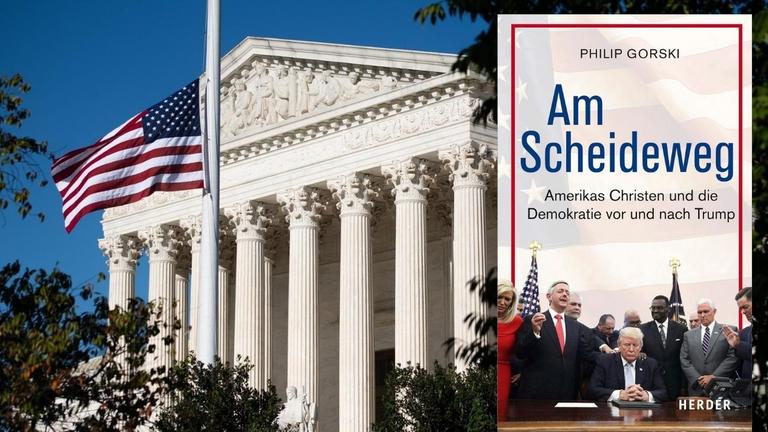Ob aufsteigende Polit-Stars wie der ehemalige demokratische Präsidentschaftskandidat Andrew Yang oder der altgediente republikanische Senator Mitch McConnell: Es wird viel geweint in Amerikas politischer Klasse. Tränen, insbesondere männliche, sind nicht nur gesellschaftsfähig, sondern unterstreichen die moralische – und politische – Autorität des Weinenden.
Das macht selbst vor Gericht nicht halt. So wandte sich erst kürzlich Staatsanwalt Matthew Frank beim Abschluss des Prozesses gegen den ehemaligen Polizisten Derek Chauvin mit erstickter Stimme an die Familie des Opfers, George Floyd.
Heike Paul, Amerikanistin an der Universität Erlangen-Nürnberg, hat sich des Themas jetzt angenommen. In ihrem schmalen Band "Amerikanischer Staatsbürgersentimentalismus" skizziert sie die Rolle des Sentimentalen in der politischen Kultur und Kommunikation der USA. Sie schreibt:
"Das Sentimentale ist (…) nicht nur der Stoff, aus dem gute Geschichten sind, sondern auch ein Register der Inszenierung von Macht. So entfalten die sentimentalen Szenarien auch im politischen Diskurs eine besondere Dynamik und lassen sich (…) zur Affirmation bestehender Machtverhältnisse instrumentalisieren."
Die Gründerväter hatten einen Hang zum Sentimentalen
Anstoß für das Buch habe die Präsidentschaft von Donald Trump geliefert, sagt Paul. Trumps Wahlkampf und Präsidentschaft seien "von Beginn an geprägt gewesen von einem Bruch mit dem, was ich als kontinuierliche Entwicklung des Staatsbürgersentimentalismus beschreibe."
Bereits die amerikanischen Gründerväter hatten einen Hang zum Sentimentalen – eine Geisteshaltung, die in der europäischen Moralphilosophie begründet liegt, sich mit Elementen des religiösen Puritanismus vermischte und später popularisiert wurde.
Die Präsidenten George Washington, Thomas Jefferson oder Abraham Lincoln – sie alle beschworen auf unterschiedliche Weise ein Zusammengehörigkeitsgefühl auf der Grundlage geteilter Leiderfahrung, schreibt Paul.
Die Autorin wählt sieben aktuelle Szenarien, in denen sich der moderne Staatsbürgersentimentalismus entfaltet. Eines ist die Trauerfeier für John McCain, Kriegsheld, Vietnam-Veteran, langjähriger republikanischen Senator und scharfer Kritiker von Donald Trump. McCain, der 2018 seinem Krebsleiden erlag, hatte seine Trauerfeier minutiös geplant – jeden Redner, jeden Sargträger, jedes Musikstück und jedes Gedicht ausgewählt. Präsident Trump war ausdrücklich nicht eingeladen. Die Choreografie der Trauerfeier sei ein Lehrstück in Staatsbürgersentimentalismus gewesen schreibt Paul – und McCain der Zeremonienmeister.
Das Sentimentale mischt sich mit religiösen Traditionen
Als eine andere Variante des Sentimentalen beschreibt die Autorin die Black-Lives-Matter Bewegung, insbesondere die trauernden Mütter der Opfer weißer Polizeigewalt.
"Der Staatsbürgersentimentalismus speist sich ja aus ganz unterschiedlichen Traditionen", sagt Paul, "und zum Teil sind es auch religiöse Traditionen." Diese seien wiederum sehr breit aufgefächert, auch unter unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen der USA. "Für die Black Community ist eine gewisse spirituelle, religiöse Traditionslinie sehr wichtig, auch was die Fabrikation des Sentimentalen angeht."
Schließlich: US-Präsident Joe Biden. Seine Biografie mache ihn zum perfekten Repräsentanten des Staatsbürgersentimentalismus, schreibt Paul, jene Mischung aus persönlichen Verlusten und dem Glauben an eine bessere Zukunft für sein Land. Als junger Senator verlor Biden seine Frau und Tochter bei einem Verkehrsunfall. Jahrzehnte später starb Sohn Beau an einem Hirntumor.
Im Präsidentschaftswahlkampf – mitten in der Pandemie – wurde sein Leidensweg zu einer Art Gütesiegel der Empathiefähigkeit – und Biden selbst, der Schmerzensmann, zum Gegenentwurf von Trump. Biden, schreibt Paul, sei aufgetreten "als Versöhner, Heiler, Tröster der Nation in schwierigen Zeiten – und dies wurde an hochsymbolischen Orten inszeniert. Einen seiner wichtigsten Wahlkampfauftritte hatte Biden an den Heilquellen von Warm Springs, Georgia."
Dort hatte US-Präsident Franklin D. Roosevelt Linderung von seinem Polio-Leiden gesucht.
"Doch hier ging es nicht um die Heilung eines Staatsmannes, sondern symbolisch gleichsam um die Heilung Amerikas (…) und um die Überwindung von politischem Tribalismus."
Öffentliche Emotionen als amerikanisches und globales Phänomen
Paul räumt ein: Öffentlich dargelegte Gefühle sind kein rein amerikanisches Phänomen mehr. Mit der wachsenden Rolle von sozialen Medien seien sie zu einem universalen Code geworden. Dennoch sieht die Autorin eine spezifisch amerikanische Traditionslinie – und einen klaren Unterschied bei der Bewertung des Sentimentalen in Deutschland und den USA.
"Das Sentimentale ist hierzulande stärker stigmatisiert, es wird abfällig benutzt in der Alltagssprache", sagt Paul. "Und natürlich gibt es Momente, wo das Sentimentale kippt in etwas, was als unecht oder als verlogen oder scheinheilig betrachtet wird."
Amerikanischer Staatsbürgersentimentalismus: Heike Paul ist es gelungen, ein ideengeschichtlich hochkomplexes Thema pointiert aufzubereiten – und damit zu einer Debatte über Chancen und Grenzen öffentlicher Emotion beizutragen, die aktueller kaum sein könnte.
Heike Paul: "Amerikanischer Staatsbürgersentimentalismus. Zur Lage der politischen Kultur in den USA",
Historische Geisteswissenschaften, Frankfurter Vorträge 14,
Wallstein Verlag, Göttingen. 144 Seiten, 12 Euro.
Historische Geisteswissenschaften, Frankfurter Vorträge 14,
Wallstein Verlag, Göttingen. 144 Seiten, 12 Euro.