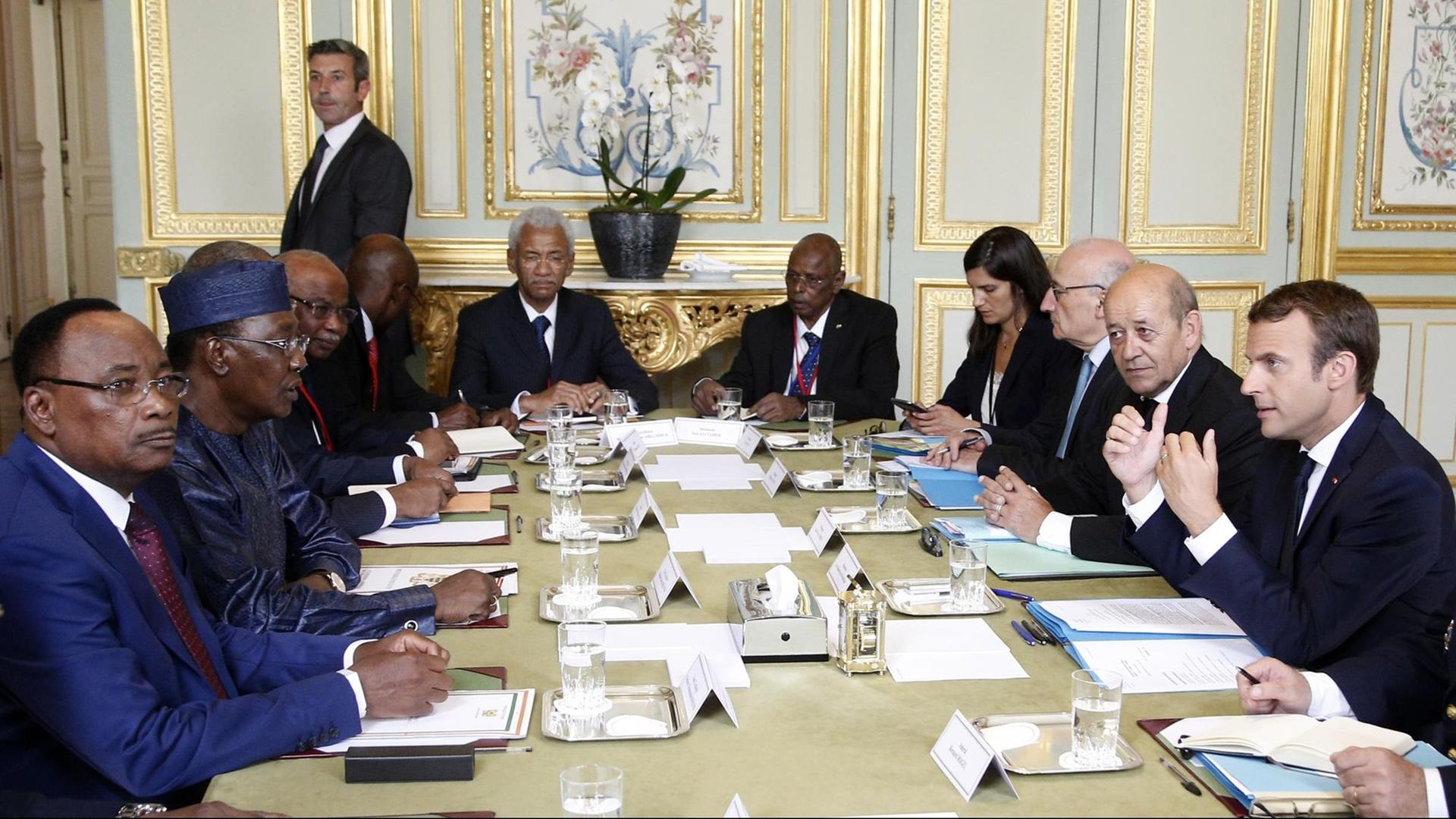Was für eine gottverlassene Gegend. Der Himmel ist wolkenlos, grell. Die Erde ausgetrocknet und steinig. Und immer nur Staub und Schweiß und das klitschnasse Hemd, das einem am Rücken klebt; auch hier, im Amtssitz des Unterpräfekten.
Wir sind im Osten des Tschad, nahe der sudanesischen Grenze. Hier zeigt sich die Sahelzone von ihrer härtesten, lebensfeindlichsten Seite: Alle paar Jahre Dürre, Hungersnot und zu allem Elend auch noch die Kriegsflüchtlinge aus Darfur: Zehntausende, Hunderttausende. "Natural desaster meets man made desaster", heißt das im NGO-Sprech: Naturkatastrophe trifft auf menschliche Katastrophe.
"Aber der Unterpräfekt sagt: Wir haben hier überhaupt keine Probleme. Den Leuten gehts gut", erzählt Monsieur Erdebu. Er hat sich in einem dick gepolsterten Sessel nieder gelassen.
"Die Leute sind zufrieden mit ihrem Leben", versichert er. "Und sie sind dankbar für die Hilfe der Europäischen Union und der Vereinten Nationen. Wie gesagt: Wir haben hier keine Probleme."
Eine chronische Krisenregion
Vielleicht sind die Probleme hier schlichtweg zu groß für einen Unterpräfekten. Seit 2004 versuchen westliche Hilfsorganisationen, das humanitäre Elend in dieser chronischen Krisenregion zu verwalten. Die Sachlage ist so einfach wie brutal: Hätten die EU und die UNO nicht Jahr für Jahr enorme Mengen Lebensmittel, Medikamente und sonstige Hilfsgüter eingeflogen, wären die Menschen im Grenzgebiet von Tschad und Darfur verhungert oder verdurstet. In Massen, irgendwo in der Wüste. Das wurde verhindert.
Mittlerweile sind im Tschad mehr als 400.000 Flüchtlinge zu Versorgungsfällen geworden. 14 Camps gibt es in diesem Teil der Sahelzone. Sie zählen zu den größten Afrikas. Die Lager sind mit der Zeit zu einer Art humanitärer Dauereinrichtung geworden. Sie werden vom UNHCR, dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen verwaltet und fast ausschließlich von der Europäischen Union finanziert; genauer gesagt - von Echo, der Generaldirektion für humanitäre Hilfe, die der EU-Kommission untersteht. Brüssel hat bislang etwa 260 Millionen Euro gegeben, um die Flüchtlinge in der Sahelzone am Leben zu halten. Das sei ehrenhaft, sagt Ante Galic vom UNHCR. Aber noch längst keine Lösung:
" Alles, was wir hier an Hilfe rein pumpen, kommt ja von außen. Das ganze Budget wird von der EU und von der UNO getragen. Es gibt im Tschad niemanden, mit dem wir zusammen arbeiten könnten. Die Präsenz des Staates geht gegen Null – nein, sie ist gleich Null."
Via Coupons und Telefonbanking
In den Flüchtlingslagern hat die EU ein ausgetüfteltes, komplexes Verteilungssystem etabliert. Bohnen, Getreide, Öl werden nicht mehr verteilt. Sie werden nur noch gegen Coupons ausgegeben und die Ware via Telefonbanking bezahlt.
"Dadurch sei hier kein Cash mehr im Umlauf", sagt Echo-Mitarbeiter Olivier Brouant. "Kein Bargeld, kein Streit, so einfach sei das."
Die EU, erklärt man mir, überweise einen Geldbetrag auf das Konto des UN-Welternährungsprogramms. Das Welternährungsprogramm leitet es weiter an Tigo, die staatliche Telefongesellschaft im Tschad und die simst dann den Betrag auf das Bankkonto des jeweiligen Händlers, der den Eingang auf seinem Handy bestätigt bekommt. "Er macht richtig gut Geld mit den Flüchtigen", sagt einer von ihnen.
Das muss man erst mal verdauen: Der Tschad ist das zweitärmste Land der Welt. Im Osten gibt es keine asphaltierte Straße im Umkreis von fünfhundert Kilometern, dafür Kamelkarawanen, Lepra, Stammesfehden um Brennholz, Weideland, Wasser. Aber in den Flüchtlingslagern sitzen dicke, zufriedene Männer auf Getreidesäcken und scrollen durch ihre Smartphones. Auf dem Markplatz tobt sich der Irrsinn der Gleichzeitigkeit aus.
Die Flüchtlingsstrategie der EU
Die Mitarbeiter der EU und der UNHCR haben im Osten des Tschad längst die staatliche Funktion übernommen: Sie sind verantwortlich für die Schulen, die Kliniken, die Märkte, die Sicherheit in den Lagern. Sie sollen vor Ort realisieren, wovon Europas Politiker immer reden: Bleibeperspektiven schaffen, Fluchtursachen bekämpfen.
Vor Ort materialisiert sich die Flüchtlingsstrategie der EU in einer Holzbaracke, zusammen genagelt aus Brettern und Balken. Zwei Dutzend Jugendliche sollen hier das Schreinerhandwerk erlernen.
"Das sei wichtig", sagt Sayed Beni, der Ausbilder. Schreiner fänden ja immer und überall Arbeit,
Die EU finanziert in den Flüchtlingscamps neunmonatige Ausbildungsprogramme für Schreiner und Schneider, KFZ-Mechaniker und Elektriker. "Was wollen sie später tun?" will ich wissen, "wovon träumen sie?"
Der unwiderstehliche Drang zu gehen
Einer der jungen Männer legt die Säge beiseite und wischt sich über die Stirn. Er sagt, er träume viel, eigentlich ständig. Er träume von einem besseren Leben - nicht hier, in Europa, wo es Sicherheit gebe. Und mit einem Mal lassen auch die anderen alles stehen und liegen und reden auf mich ein.
Sie haben den unwiderstehlichen Drang zu gehen, übersetzt Sayed Beni, sie können an gar nichts anderes mehr denken. Aber das sei doch gefährlich, gebe ich zu bedenken: Der Weg durch Libyen, die Fahrt übers Meer – und wie wollten sie die Schlepper bezahlen? "Mit dem Geld, das wir hier als Schreiner verdienen", sagen sie. "Damit kommen wir schon irgendwie durch."
Das ist ihr Plan: Nicht bleiben, weg gehen. Und sie haben Gründe dafür: "Die Regenzeit war dieses Jahr sehr mager", sagt Ante Galic Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen. "Die zweite Ernte ist ausgefallen. Es regnet überhaupt immer weniger und die Wüste wächst weiter. Irgendwann wird hier niemand mehr leben wollen."