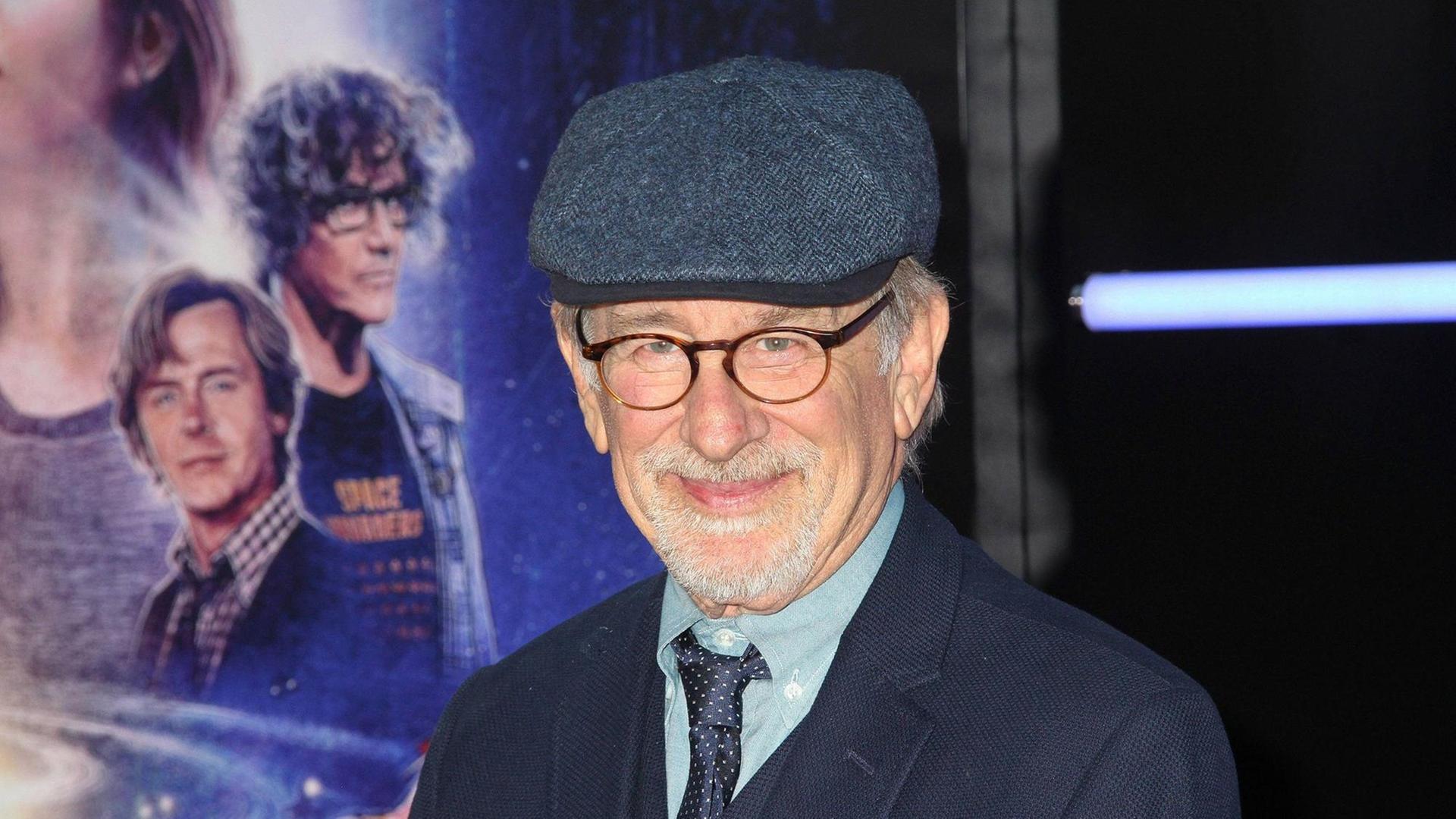Sigrid Fischer: Christian Petzold, Sie verlegen die Transitgeschichte von Anna Seghers aus den 40er Jahren ins heute beziehungsweise in eine unbestimmte Zeit, und damit erzählen Sie ja auch sehr allgemeingültig von Flüchtlingsschicksalen. Haben Sie sich vor dem Dreh mit der Hier-und-jetzt-Flüchtlingslage beschäftigt, haben Sie sich erkundigt, um vielleicht noch Ideen für Ihren Film zu bekommen?
Christian Petzold: Es war eher das Gegenteil, es hat mich gestört, die aktuelle Flüchtlingslage. Uns kam eher der Gedanke, dass alle unsere Filme, die wir zusammen geschrieben haben, alle diese Filme im Grund genommen die Referenz "Transit" haben, von Anna Seghers, unser Lieblingsbuch. Alles waren Übergangsgeschichten. Und so kamen wir dann dazu, zu sagen: Ist denn nicht die Historie was, was uns befragt? Die Gegenwart? Und uns fragt: "Sag' mal, wir haben einen Asylparagrafen im Grundgesetz stehen, der beruht auf den Erfahrungen, die die Flüchtlinge gemacht haben, die nicht in die Schweiz kamen, die nicht nach Amerika kamen."
Die Länder haben immer dieselben Sätze drauf: "Wir sind nicht das Sozialamt der ganzen Welt." "Wir können nicht jeden aufnehmen." Und Leute verrecken in diesen Warteräumen und Transitzonen. Anna Seghers Roman erzählt einfach, dass in dieser Transitzone eine Erzählung möglich ist. Und nicht nur die Hölle und das Nichts. Und das war eigentlich der Gedanke. Und dann kamen hier Willkommenskultur, Calais - der Dschungel, Front National – wir haben ja da gedreht, als da gerade die Wahlen waren. Einen Samstag war Mélenchon im alten Hafen, und am nächsten Tag war wieder die blonde Faschistin da. Und ich wollte nicht einen Kommentar abgeben. Dann sind die Bilder nur Medium für Sätze, die man schon vorher gewusst hat.
"Alle diese Menschen sind eine gesichtslose Masse"
Fischer: Okay, da hat die Aktualität ja dann doch noch reingespielt, in Ihren Film - wenn auch ungewollt. Und was Sie zeigen in "Transit" ist eben auch zeitlos und zutreffend wahrscheinlich auf alle Menschen in solchen Zwischensituationen im Nirgendwo, die irgendwo ankommen wollen.
Petzold: Ich hab das mal so formuliert: Wir leben in Berlin, wir haben viele Flüchtlinge in Berlin, wir haben Bilder im Fernsehen gesehen - damals hier von der Aufnahmestelle. Alle diese Menschen, die dort im Fernsehen gezeigt werden, sind eine gesichtslose Masse. Die haben keine Erzählung und wir vergessen sie sofort. Sie sind für uns so ähnlich wie Insekten oder sowas. Und niemand hört ihnen zu.
Ich spiele am Columbiadamm Badminton, und gegenüber ist ja das große Gelände des Zentralflughafens, und in diesem Gebäude waren mehrere tausend Flüchtlinge untergebracht. Ich fuhr da jeden zweiten Tag mit dem Fahrrad dran vorbei, ich sah sie nicht. Ich hörte sie nicht. Sie waren nicht da. Ich wusste, dass sie da sind, aber nur als Zahlen, eben als Leute, "die unsere Sozialsysteme belasten". Aber sie waren mit all ihren Geschichten, mit all den fürchterlichen Dingen, die sie erlebt haben, mit all dem, was sie eigentlich brauchen, nämlich ein Zuhause, ein Gefühl, dass man ihnen zuhört, all das hat natürlich was damit zu tun, dass bei Anna Seghers in "Transit" genau das schon mal geschildert wird - von Deutschen.

Fischer: Aber dieses Zuhause muss kein Ort sein, es können auch Menschen sein, die ein Zuhausegefühl geben. Das zeigen Sie auch in dem Film, wenn die Hauptfigur Georg sich z.B. mit einem kleinen Jungen anfreundet und mit dem immer Fußball spielt.
Petzold: Ja, es geht nicht darum, dass man denen eine Containersiedlung baut. Sondern es geht darum, dass man – und deshalb hab' ich das ja in dem Film so gemacht... ein Barkeeper hört ihnen zu. Und ob das nun in Amerika ist, ein Mann, der gerade seinen Job verloren hat oder ein Mann, dessen Frau ihm weggelaufen ist, der geht zum Barkeeper, und der Barkeeper hört ihm zu. Und dieses Zuhören ist zu Hause sein.
Wir haben noch länger mit Christian Petzold gesprochen -
hören Sie hier die Langfassung des Corsogesprächs
Fischer: Wenn Sie sagen: "Flüchtlinge sind eine gesichtslose Masse, ich sah' sie gar nicht", das heißt also, aus der persönlichen Erfahrung kennen Sie keine Flüchtlingsschicksale?
Petzold: Es ist so, dass die Geschichte der Flüchtlinge mich immer getroffen hat. Ich hab' mich dann immer gefragt, woher das kommt. Ich bin ja geboren in einer kleinen Stadt bei Wuppertal und in einer Reihenhaussiedlung groß geworden. Und jetzt, wo die Menschen in dieser Reihenhaussiedlung, also die Elterngeneration, langsam stirbt, fangen sie an zu erzählen, wo sie hergekommen sind. Es sind alles Flüchtlinge, die entweder... meine Mutter war Sudetendeutsche, mein Vater war Kommunismusflüchtling muss ich mal sagen.
Und alle diese Flüchtlinge, die dort zusammen lebten, taten so, als ob das Reihenhaus, das sie über die Gewerkschaft bekommen hatten, ein zu Hause wäre. Und im Moment des Sterbens, oder des Verlassens - die Kinder sind weg, und der Einsamkeit, bekamen sie mit, dass sie gar keins gehabt haben. Man hat ihnen eine Siedlung am Rande der Stadt gebaut, und dieses - dass wir vielleicht alle, dass wir alle Flüchtlinge sind, und das Identitätsmodell, oder das Heimatmodell, das man uns unterjubeln will von rechtskonservativer und faschistischer Seite -, dass dieses Heimatmodell eine Lüge ist.
"Ein Film, der mich nicht irritiert, der langweilt"
Fischer: Ihr Konzept, zeitliche Parallelwelten zu schaffen - also in Marseille sieht man ja dann Polizei in Uniformen von heute, gleichzeitig ist von Nazis und Faschisten die Rede -, das ist schon ein bißchen gewagt, das kann auch sehr irritieren, den Zuschauer, daraus könnte man auch Schlüsse ziehen, die Sie vielleicht nicht ziehen wollten?
Petzold: Die Irritation ist Teil davon. Es ist ja nicht so, dass ich die Leute nicht irritieren will. Ich finde, ein Film, der mich nicht irritiert, der langweilt mich jetzt schon in der Vorstellung. Die Amerikaner und die Franzosen - auch das argentinische und das philippinische Kino - wagt so viel, und wir müssen immer alles von Wahrscheinlichkeitskrämern abnehmen lassen. Ich war mir ganz sicher, dass diese Zeiten nebeneinander bestehen können.
Das einzige, was ich nicht gemacht habe, war Smartphones benutzen. Weil ich Kinder habe, die 22 und 18 sind, und beide sagen: "Niemals Smartphones im Film benutzen." Weil: Smartphones altern wesentlich schneller als Filme. Wenn die jetzt einen Film sehen, wie zum Beispiel eine Serie wie... "24" hieß die doch, mit dem Sutherland, diese Serie. Und dann holen die die alten Klapphandys raus oder Blackberrys, dann lachen die sich tot. Was ist das denn für ein alter Film? Wenn aber ein Cowboy mit Pferd vorbei reitet und ein Flanellhemd trägt, das ist Gegenwart. Dieser Film ist gegenwärtiger als das Klapphandy. Deshalb hab ich gesagt: keine Smartphones.
Fischer: Ihre Kinder geben Ihnen Regie-Tipps, sagen Sie eben. Schauen die und deren Freunde Ihre Filme, also Ihre Kinder, nehme ich mal an, schon, das ist ja wohl selbstverständlich, aber entfernt man sich als Filmemacher nicht allmählich von den Sehgewohnheiten dieser jüngeren Generation?
Petzold: Ich glaube nicht. Ich hab ganz andere Erfahrungen gemacht. Ich glaube, immer wenn wir repräsentativ sprechen wollen, über "die" Jugend, die nur noch kifft oder nur noch Egoshooter spielt oder in Virtual Reality unterwegs ist. Oder deren Konzentrationsspanne ist nur noch YouTube-Länge, oder die sind nur instagrammäßig unterwegs. Es ist alles falsch. Und ich mach' das schon lange nicht mehr. Dann landet man irgendwie, finde ich, bei Umfragenquoten, und das hat ja beim deutschen Fernsehen auch dazu geführt, dass sich das Programm in den Tod nivelliert.