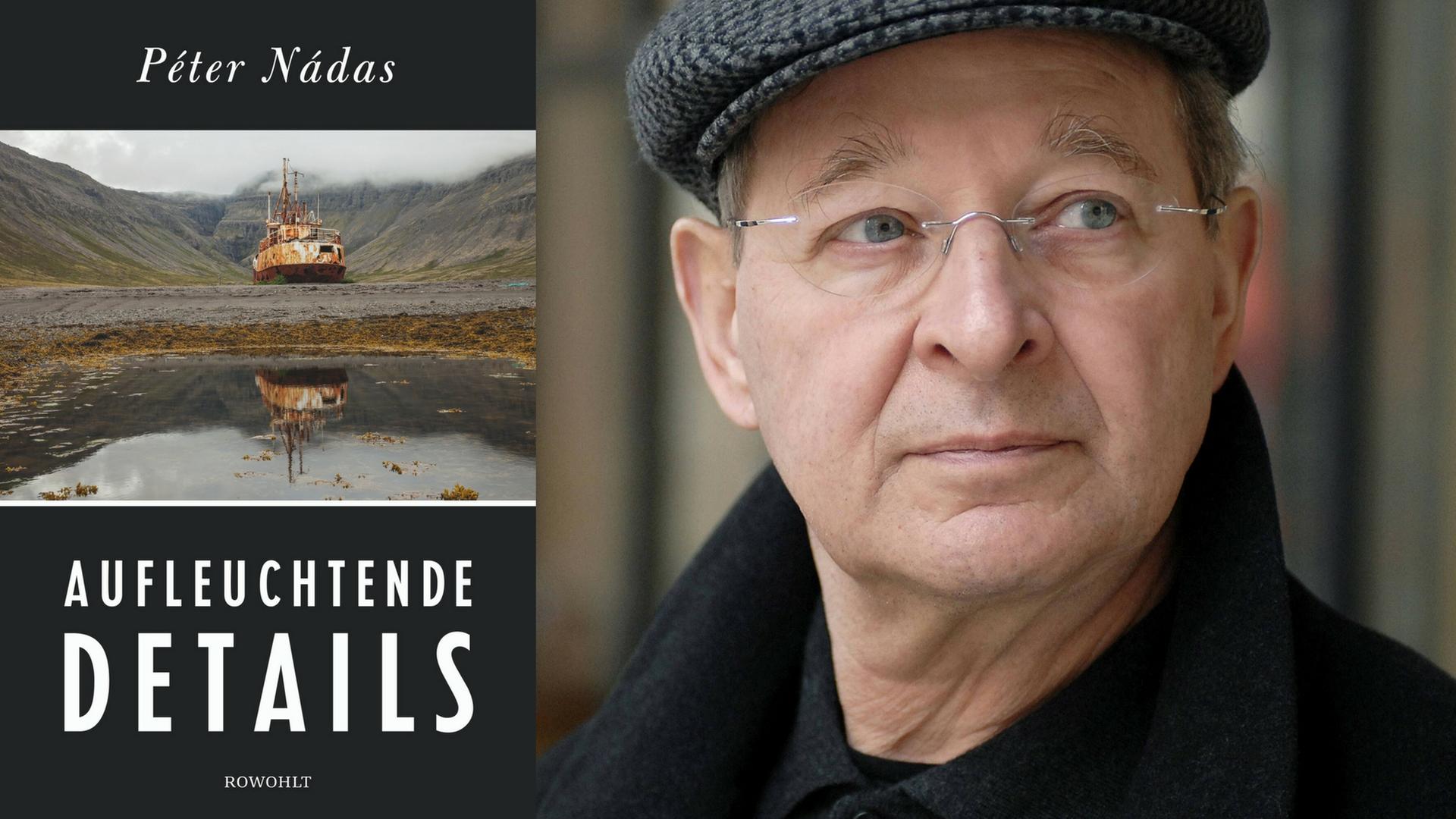"Airport 77", "Mayday – Katastrophenflug 52", "Blitzschlag im Cockpit", "Snakes on a Plane" – seit Jahrzehnten produziert Hollywood einen Flugzeug-Katastrophen-Film nach dem anderen. Seit den 70er Jahren begleitet das Genre die allmähliche Popularisierung des Fliegens. Den Skeptikern gibt es Anlass zur Sorge, den Faszinierten liefert es beeindruckende Bilder der technischen Apparatur.
Dem Flugzeug als szenischen Raum hat sich nun auch Christina Viragh in ihrem neuen Roman "Eine dieser Nächte" bedient. Von Thailand in die Schweiz geht der Nachtflug, und es wäre eine zwar ermüdende, aber übliche Reise, gäbe es da nicht den Passagier in Sitzreihe 63. Ein rüder Ami, ein Sextourist, ein Alkoholiker, die Urteile der Sitznachbarn sind schnell gefällt. Just dieser Typ kommt nämlich auf die Idee, nach dem Start drauflos zu erzählen, ungefragt und ungehemmt, während er an seinem Plastikbecher-Whiskey nippt:
"Wenn der so weitertrinkt, denkt Emma. Sie schläft nicht, wer kann schon einfach so einschlafen, sie hat nur die Augen geschlossen. Nützt allerdings nichts gegen Bill. Im Gegenteil, mit geschlossenen Augen hört man deutlicher. Noch sieben Stunden bis Zürich, Distance to Destination 5000 Kilometer. Vorsichtig zum Fenster hinausschielen. Draußen das gleiche Dunkel. Ist da unten wirklich der Himalaya, wie Bill behauptet, die achttausend Meter hohen Berge. Wie sollte der Schnee leuchten in einer mondlosen Nacht. Der Gipfelwind treibt unsichtbare Schneefahnen ins Dunkel hinaus."
Allmählich berührt Bills Gerede doch
Eine kleinbürgerliche US-Jugend, der Vater als Soldat in Vietnam, dazu brüderliche Konflikte und ein Ausreißer-Trip in die Wüst – aus der Anekdote einer fremden Kindheit in einem fernen Land wird allmählich eine Allegorie, die die unfreiwilligen Zuhörer und Zuhörerinnen in ihren Bann zieht. Jede der Figuren, darunter die ungarische Schriftstellerin Emma Dél, die auf Bali einen Kongress besucht hat, denkt und wirft sich hinein in Bills Gerede, das trotz seiner Penetranz sinnstiftend wirkt. Ob die sechs Menschen, die um Bill herumsitzen, es wollen oder nicht, längst hat die erzählerische Sogwirkung eingesetzt:
"Was muss der sich einmischen. Bill hätte am Ende doch erzählt, was John gesagt hatte, ohne dass man sich seine schmierigen Kopfhörer einzustecken braucht. Wieso musste es Johns Stimme im O-Ton sein. Aber was hatte er gesagt. Was für ein P.J. und was für ein Text. Wie geht die Geschichte des Teichs. Wie kommen solche Teiche oder Wirbel zustande. Und wie kam die Aufnahme zustande, hatte Bill ein Tonbandgerät dabei."
Jeder Geschichte folgt eine weitere
Während des zwölfstündigen Flugs werden zwar weiterführende Details ans Licht kommen, wer John ist und ob dieser mysteriöse P. J. wirklich ermordet wurde, aber eine endgültige Klärung wird es bis zur Landung in Zürich nicht geben. Stattdessen stimulieren Bills Ausführungen die Imagination und Selbstschau seiner Sitznachbarn. Emma notiert sich Erinnerungen an ihre erste Liebe in ein Heft, der Teenager Hagen tippt Protokolle von Bills Monologen in sein Tablet und ergänzt sie mit eigenen Erfahrungen. An einigen Stellen kann diese Struktur mechanisch wirken, schließlich gilt hier nur eine Regel: Die einzige Reaktion auf eine Geschichte ist eine weitere Geschichte. Nicht umsonst ist ständig von Gurus, Wanderpredigern und Schamanen die Rede, das ekstatische, auch erratische Sprechen energetisiert erst diesen Erzählreigen.
"Absurd, Walter findet die Situation absurd, diese Dél sitzt da, tut nichts, lässt ihn aber auch nicht nach hinten, Bill sitzt da und heult, hat nicht mal ein Taschentuch. Vielleicht heult ja auch diese Dél. Die macht so ein komisches Gesicht, soweit man das in diesem Schummerlicht sehen kann. Die schaukeln sich vielleicht gegenseitig hoch, und dann weiß Gott, was geschieht, Walter möchte nicht Zeuge weiterer Szenen werden. Er hat allmählich die Nase voll, kaum ein Augenblick Ruhe, und noch fünf Stunden, was ist überhaupt da unten, hoffentlich nicht mehr Afghanistan, aber wahrscheinlich sonst ein Stan, man kann den Kurs der Maschine nicht verfolgen, die haben für die Nacht die Displays ausgeschaltet."
Erzähltradition zwischen Mord im Orientexpress und 1001 Nacht
Christina Viragh weiß sehr wohl, in welche weitreichenden Traditionen sie sich mit "Eine dieser Nächte" einschreibt. Zum ungeklärten Mordfall, der sich in Bills Jugend zugetragen haben soll, entwerfen Emma, Hagen und Co unterschiedliche Szenarien, natürlich ohne das Verbrechen aufklären zu können. Die investigativen Mutmaßungen sind auch ein Wink an alle Kriminellen in Orient-Expressen und auf Nil-Kreuzfahrtschiffen, mit dem feinen Unterschied, dass es in der Boeing keinen Hercules Poirot gibt, der sich seinen Bart zwirbelt und den Fall en passant löst.
"Eine dieser Nächte" ist ein pathetisches Buch, das sich keine Kompromisse zugesteht, weder in Bezug auf die Länge noch auf die komplexe Schichtung der Erzählebenen. Für die größten der großen Fragen sind nun einmal Großprojekte geboten. Wie lässt sich vom Leben erzählen? Lässt sich mit Worten dem Tod entrinnen? Oder gibt man sich ihm dadurch nicht eher anheim? Während des Ineinanderwebens der Lebensfäden düst das Flugpersonal auch über Afghanistan hinweg, dessen Territorium einst zum persischen Großreich gehörte, dem Gebiet, in dem das Epos "Tausendundeine Nacht" entstanden sein soll. In Viraghs feingliedrig abgestimmtem Text ist dieses Detail nicht zufällig gesetzt. Auch der Titel spielt auf die wirkmächtige morgenländische Erzähltradition an.
Aber so wenig es an Bord einen Poirot gibt, so wenig ist bei Viragh eine Scheherazade anzutreffen, die als Erzählheldin dem Tod mit Wörtern trotzt. Stattdessen werden sprachmächtig vernarbte Kindheiten, entschwundene Jugendlieben und verhärmte Familienschicksale heraufbeschworen, sei es von Hagen, dessen Mutter Alkoholikerin ist, von Walter, der nach der Scheidung darum fürchtet, den Kontakt zu seiner Tochter zu verlieren, oder von Emma, die über ihr Leben in Rom sinniert.
Bill, der Majordomus des Fluges, wird bei der Ankunft in Zürich mehr als gezeichnet sein von seiner Leistung, Stimmen beschworen und Münder zum Erzählen verleitet zu haben. Es ging hier nie um einen nächtlichen Plausch, sondern immer um das Erzählen als existenzielle Sprechweise. Nach der Landung halten sich die Passagiere kurz an den Händen, mitten auf dem Flughafen, an einem der sogenannten Nicht-Orte, die der Anthropologe Marc Augé ob ihrer erkalteten, enthumanisierten Funktionalität als typisch für die Post-Moderne beschrieben hat. Aber nach diesem Flug, nach Viraghs gut fünfhundert Seiten scheint selbst dort für einen Augenblick so etwas wie Nähe und Zusammenhang möglich zu sein.
Christina Viragh: "Eine dieser Nächte"
Dörlemann Verlag, Zürich,
496 Seiten, 28 Euro
Dörlemann Verlag, Zürich,
496 Seiten, 28 Euro