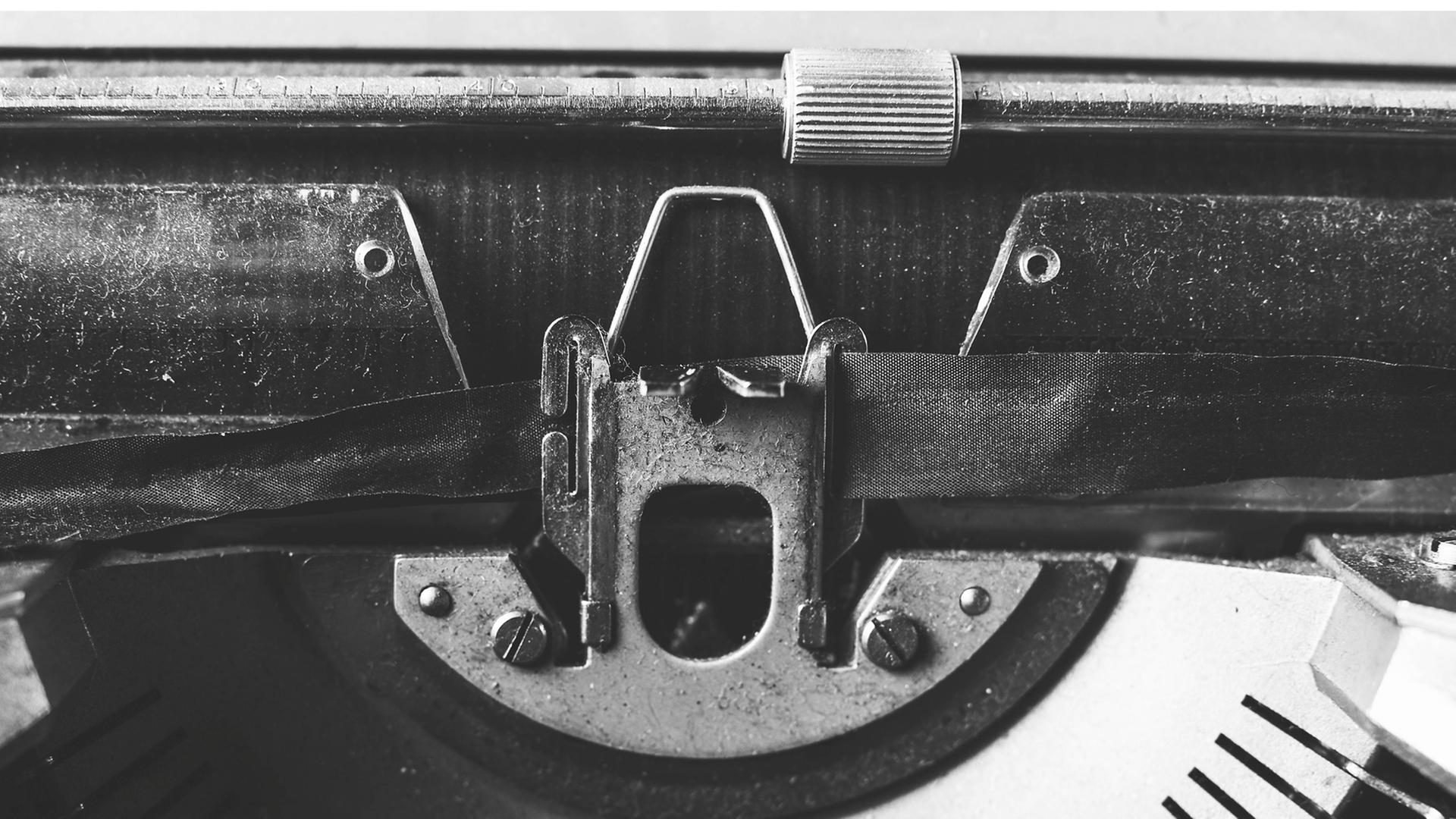
Oft sind Einschätzungen über die Hässlichkeit der deutschen Sprache ja mit einem wenig schmeichelhaften Blick auf die deutsche Mentalität verknüpft. "Der Deutsche" gilt zwar als erfolgreich und zielstrebig, aber auch als pedantisch und gefühlskalt, im schlimmsten Falle gar als autoritär und überheblich. Im Ausland ist die deutsche Sprache ambivalent konnotiert; sie gilt oft nicht nur als hässlich und roh, sondern auch als besonders effizient, - und daher als geradezu ideal für Soldaten und Ingenieure. Diese Einschätzungen scheinen unentwirrbar verquickt mit der Wahrnehmung der Deutschen als streitlustig und autoritär, als arrogant, wobei Amerikaner in der Regel auch das Ernsthafte, den Fleiß und die Disziplin der Deutschen loben und man ihnen zuweilen anmerkt, dass sie dafür Sympathien hegen.
Auf Facebook und Twitter posten die Leute gerne kleine Listen mit Sprachbeispielen, die ungewöhnlich oder kurios erscheinen. Dazu zählen Wörter, die keine Entsprechung in einer anderen Sprache haben - im Deutschen sind das zum Beispiel "Weltschmerz", "Kummerspeck", "Eselsbrücke", "Ohrwurm" oder "Fremdschämen". Beliebt sind auch ungewöhnlich lange, aus mehreren Komponenten zusammengesetzte Wörter, zum Beispiel "Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitän" - und dabei ist das noch nicht einmal das Längste.
Viele dieser Dinge geben zum Schmunzeln Anlass. Oder sie eröffnen ungewöhnliche Zugänge zum Thema Sprache. Einer der Hits in dieser Kategorie dürfte ein millionenfach angeklicktes Video auf YouTube sein: German Language compared to other Languages - die deutsche Sprache im Vergleich zu anderen Sprachen. Darin sprechen Menschen in typischer Landestracht nacheinander die gleichen Begriffe aus, zum Beispiel "surprise" (Französisch), "surprise" Englisch, "surpresa" (Italienisch), "surpresa" (Spanisch), und dann "Überraschung". Dabei trägt der zünftige Bayer das deutsche Wort aber eben nicht normal vor, wie es die anderen tun, sondern übertrieben energisch, verzerrt, aggressiv, ins Lächerliche gezogen: "ÜBERRASCHUNG."
Das emotionale Potenzial, das sich hinter solchen Videos verbirgt, wurde mir erst bewusst, als es in meinem eigenen Umfeld auf Facebook auftauchte: Ein amerikanischer Bekannter hatte es gepostet, worauf sich ein nicht enden wollender Kommentarstrom ergoss. Soweit ich das noch überblicken kann, fanden die meisten es lustig, klickten das liked, wenige steuerten dagegen und waren irgendwie not amused. Ich halte mich zwar nicht für völlig humorlos, aber ich fand das Video eher ermüdend. Fast ärgerlich. Ja, vielleicht fühlte ich mich sogar ein wenig angegriffen.
Korrelation von Sprache und Mentalität wird hergestellt
Auf der anderen Seite fiel mir auf, dass diejenigen, die erst einmal beschlossen hatten, eine Sprache für hässlich zu halten, davon nur noch ganz schwer abzubringen waren. Als handelte es sich dabei um eine höhere Wahrheit, als könnte es ernsthaft Kriterien geben, die eine Sprache für alle Welt sichtbar als hässlich oder schön kennzeichneten. Überrascht musste ich feststellen, dass die Wissenschaft zu dieser Frage kaum etwas beizutragen hatte.
Oft sind Einschätzungen über die Hässlichkeit der deutschen Sprache ja mit einem wenig schmeichelhaften Blick auf die deutsche Mentalität verknüpft. "Der Deutsche" gilt zwar als erfolgreich und zielstrebig, aber auch als pedantisch und gefühlskalt, im schlimmsten Falle gar als autoritär und überheblich. Im Ausland ist die deutsche Sprache ambivalent konnotiert; sie gilt oft nicht nur als hässlich und roh, sondern auch als besonders effizient, - und daher als geradezu ideal für Soldaten und Ingenieure. Diese Einschätzungen scheinen unentwirrbar verquickt mit der Wahrnehmung der Deutschen als streitlustig und autoritär, als arrogant, wobei Amerikaner in der Regel auch das Ernsthafte, den Fleiß und die Disziplin der Deutschen loben und man ihnen zuweilen anmerkt, dass sie dafür Sympathien hegen.
Man kann sich fragen, ob da der Neid auf den wirtschaftlichen Erfolg der Deutschen eine Rolle spielt. Stecken aktuelle politische Unstimmigkeiten dahinter? Oder handelt es sich eher um eine Nachwirkung des Nationalsozialismus, gewissermaßen gespeist aus dem Tiefengedächtnis der Nationen?
Was die Attraktivität von "Deutsch als Fremdsprache" betrifft, liefert der Versuch einer Bestandsaufnahme gemischte Resultate: Die Zeit, als Deutsch noch internationale Wissenschaftssprache war, liegt schon länger zurück. Andererseits erleben viele Goethe-Institute seit einiger Zeit einen stärkeren Zulauf von Menschen, die Deutsch lernen wollen - sei es, um sich auf einen Studienaufenthalt vorzubereiten, sei es, weil sie sich bei der Jobsuche bessere Chancen ausrechnen.
Wer Deutsch spricht, kann sparen
Vielleicht haben sie auch von der These des Yale-Verhaltensökonomen Keith Chang gehört, der die Vorzüge von Sprachen hervorhebt, die wie das Deutsche ohne Zukunftsform auskommen. Wer Deutsch spricht, sagt Chang, hätte es zum Beispiel leichter mit dem Sparen. Was ist eine "zukunftslose Sprache"? Im Deutschen beschreibt man Ereignisse, die in der Zukunft eintreten, häufig mit einer Verbform aus der Gegenwart. "Ich gehe nachher nach Hause" statt: "I will go home". Und dadurch, so die These von Chang, liegt die Zukunft im Deutschen immer deutlich näher an der Gegenwart als in einer Sprache, in der man sozusagen gewohnt ist, die Zukunft weiter vor sich herzuschieben. Tatsächlich machen Muttersprachler mit zukunftslosen Sprachen statistisch gesehen weniger Schulden.
Aber das hat auf den Klang der Sprache eher einen geringen Einfluss.
Also zurück zu den konkreten Lauten.
Von Kehl- und Knacklauten
Kritiker des Deutschen stören sich zum Beispiel an den Guttural- oder Kehllauten wie in "Ach", oder dem Zungenspitzen-, dem Zäpfchen "R". Typisch für das Deutsche sind die sogenannten Knacklaute bei Worten, die im Anlaut einen Vokal haben, weil sich die Stimmbänder plötzlich öffnen und die angestaute Luft auf einmal entweicht. Das lässt die Sprache hart klingen. Andere mokieren sich über die langen Wortkompositionen oder dass man bis zum Ende des Satzes warten muss, um endlich das Verb zu erfahren.
Einem deutschen Muttersprachler fallen diese Merkmale gar nicht so ohne Weiteres auf. Es gehört einige Distanz dazu, sich vorzustellen, wie die eigene, vertraute Sprache in fremden Ohren, gewissermaßen von außen wahrgenommen, klingen mag.
Der irische Komödiant Dylan Moran sagt, die deutsche Sprache klinge "wie eine Schreibmaschine, die Alufolie frisst und die Kellertreppe hinuntergetreten wird".
Es überrascht vielleicht, dass derartige Einschätzungen nicht erst aus der jüngsten Vergangenheit stammen, sondern weit zurückreichen. Karl V., Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, soll vor 500 Jahren gesagt haben: "Ich spreche Spanisch zu Gott, Italienisch zu den Frauen, Französisch zu den Männern und Deutsch zu meinem Pferd." Schon damals kam die deutsche Sprache also nicht gerade gut weg, - auch wenn sie seinerzeit völlig anders geklungen hat als das Deutsch, das wir heute sprechen, ja, wir vermutlich nicht einmal eine Chance hätten, es zu verstehen.
Twains "Schrecken der deutschen Sprache"
Der amerikanische Schriftsteller Mark Twain, der einen Aufsatz mit dem Titel "Die Schrecken der deutschen Sprache" verfasste, den er 1897 vor dem Presse-Club in Wien vorgetragen hat, nannte "das Studium des Deutschen ein aufreibendes und erbitterndes Unternehmen". Er schrieb weiter: "Es gibt ganz gewiss keine andere Sprache, die so unordentlich und systemlos daherkommt und dermaßen jedem Zugriff entschlüpft." Twain wollte sich damit nicht einfach abfinden. Tatsächlich wollte er die "edle Sprache" - wie er sie dennoch nannte - verbessern, üppige, weitschweifige Konstruktionen vereinfachen, "die ewige Parenthese unterdrücken, abschaffen, vernichten; die Einführung von mehr als dreizehn Subjekten in einen Satz verbieten; das Zeitwort so weit nach vorne rücken, bis man es ohne Fernrohr entdecken kann." Sein Ziel: "eine prachtvolle deutsche Sprache".
Hundertfünfzig Jahre später kann man feststellen, dass seine Bemühungen nicht von Erfolg gekrönt waren. Versuche, eine Sprache lenkend zu verändern, zielen meistens ins Leere.
Marcel Proust dürfte als der Schriftsteller bekannt sein, der wie sonst kaum jemand ein Gespür für Gerüche, Geräusche und eben auch Klänge hatte. Und er schien eine Sympathie für die deutsche Sprache zu hegen. Und zwar entfesselte sie sich dort, wo man das gar nicht erwartet hätte, - im Namen des Fürsten Pfaffenheim.
Oder war das womöglich ironisch gemeint?
Man möge sich selbst ein Urteil bilden, hier der Ausschnitt aus dem Roman Auf der Suche nach der verlorenen Zeit:
"Der Name des Fürsten enthielt in der Frische, mit der die ersten Silben - musikalisch gesprochen - einsetzten und in der stotternden Wiederholung, die sie skandierte, den Schwung, die gezierte Unbefangenheit, die schwerfällige germanische "Feinheit", die wie grünes Blattwerk über den düsterblauen Schmelz des ‚Heims‘ fällt, wo hinter den abgeblaßten, fein ziselierten Vergoldungen des deutschen 18. Jahrhunderts Mystik eines rheinischen Kirchenfensters sich entfaltet."
Lärm einbrechender Felsen
Der französische Romantiker Charles Nodier schrieb 1828 über die "erhabene Emphase" des Griechischen, "ähnlich dem Geräusch der Ströme des Peneios". Das Italienische rolle "in seinen Silben das Rauschen der Wasserfälle und das Zittern der Olivenbäume". Anders in den kalten Ländern, wo die Wörter grob und konsonantenreich seien: "Ihre schallenden und holprigen Klänge erinnern an das Flüstern der Wildbäche, den Schrei der vom Unwetter gebogenen Tannen und dem Lärm einbrechender Felsen", sagte Nodier.
Selbst wenn man sich dem Vergleich zwischen Sprache und Landschaft anschließen möchte, bleiben viele Fragen offen: Ist eine "harte" Sprache automatisch hässlich und eine "weiche" immer schön? Fühlen sich Menschen, die selbst hart klingende Sprachen sprechen, womöglich eher zu weicher klingenden hingezogen? Das könnte eine Erklärung dafür sein, dass Deutsche in die melodischen romantischen Sprachen des Südens geradezu vernarrt sind.
Sprechmelodie und Nasallaute im Französischen
Das Französische etwa zeichnet sich durch eine ausgeprägte Sprechmelodie aus - die Stimmhöhe des Sprechenden schwankt relativ stark. Hinzu kommen die für diese Sprache typischen, als musisch empfundenen Nasallaute. Auch das Italienische hat viele Vokale, weist dafür aber vergleichsweise wenige Höhen und Tiefen auf, was einen staccatoartigen Eindruck erzeugt und das Gefühl, dass die Sprache schneller gesprochen würde.
"Melanzane parmigiana con spinaci,”... "Mozzarella! Parmigiani! Gorgonzola!”
Vielleicht erinnern Sie sich an die amerikanische Filmkomödie Ein Fisch namens Wanda, in der Jamie Lee Curtis immer dann schwach wird, wenn ihr Filmpartner mit sonorer Stimme ein paar Halbsätze Italienisch spricht - oder das, was man dafür hält, denn das Italienisch ist nicht wirklich authentisch, klingt eher wie eine Aneinanderreihung von kulinarischen Köstlichkeiten und Bruchstücken aus einem Sprachreiseführer.
Genauso muss eine italienische Oper offenbar in Italienisch gesungen werden, damit richtige Kenner sie wirklich genießen können - auch wenn nur wenige Zuhörer der Sprache tatsächlich irgendeine Bedeutung abzuringen vermögen und sich besser schon im Vorfeld über die Handlung der Oper in Kenntnis gesetzt haben.
Arabisch - rau und hart durch Rachenlaute
Als kleiner Trost mag den Deutschen gereichen, dass ihre Sprache unter den ungeliebten Idiomen nicht ganz alleine dasteht. Das Arabische zum Beispiel ist bekannt für seine ausgeprägten Rachenlaute; der hintere Teil der Zunge wird dort stärker beansprucht. Das klingt in europäischen Ohren rau und hart, wird tendenziell negativ konnotiert, zumindest als befremdlich wahrgenommen, zumal man kaum eine Chance hat, ein Wort zu erkennen - abgesehen von "Allah" oder "habibi" vielleicht. Und all die kulturellen Unterschiede - auch wenn oft nur Missverständnisse - und politischen Gemengelagen machen es nicht einfacher, dieser Sprache mit der Offenheit zu begegnen, die sie eigentlich verdient hätte.
Viele können wiederum dem Klang des Dänischen nur wenig abgewinnen - anders als beim Norwegischen oder dem ungleich melodiöseren Schwedischen - wobei beide Sprachen mit dem Dänischen eng verwandt sind und sich die Sprecher untereinander problemlos verstehen können. Man sagt, die Phonologie des Dänischen sei derartig kompliziert, dass sie nicht in einfache Regeln gefasst werden kann. Als Besonderheit gilt ein Stoßlaut, der so häufig vorkommt, dass er die Lautung des Dänischen dominiert. Außerdem werden geschriebene Konsonanten in der Aussprache geschluckt.
Keine Formel für die Schönheit der Sprache
Auf der Suche nach einer Gesetzmäßigkeit für die Schönheit einer Sprache könnte man nun auf die Idee verfallen, sie in ihre Einzelheiten zu zerlegen. Liegt der Schlüssel vielleicht im Verhältnis von Vokalen zu Konsonanten? Es wäre zu schön, wenn man eine mathematische Formel entwickeln könnte, nach der sich die ästhetische Überlegenheit einer bestimmten Sprache beweisen ließe.
Doch diese Formel gibt es nicht. Auch weil die Bewertungen von Kultur zu Kultur variieren. Noch ein Beispiel: In Großbritannien etwa gilt ein Kehlkopfverschluss- oder Knacklaut als hässlich, in Farsi – also Persisch - dagegen als Kennzeichen sorgfältiger, stilistischer Brillanz und ein Verzicht darauf eher als ein Zeichen von Schludrigkeit.
Die Gebrüder Schlegel haben vor über zweihundert Jahren die deutsche, griechische, italienische und französische Sprache personifiziert und in einen kuriosen Wettstreit treten lassen, bei dem jede "Sprachperson" selbstbewusst ihre besonderen Qualitäten hervorhebt. Sie beziehen sich auf Klopstocks "grammatische Gespräche", der übrigens nicht verlegen war, eine besondere Verwandtschaft von deutscher und altgriechischer Sprache zu behaupten. Die Brüder zitieren ihn in diesen Dialogen zum Teil direkt. Darin verwehrt sich der Deutsche etwa gegen die "weichliche Sprache" des Italieners, ja meint sogar, sie dürfe gegen die "männliche" deutsche Sprache "gar nicht den Mund öffnen". Und wirft ihr vor, sie würde beinahe zerfließen, sei einförmig und ihre Endungen seien fast immer weiblich. Woraufhin der Italiener selbstbewusst Beispiele dafür anführt, dass seine Sprache "das Starke der Gegenstände" weit besser bezeichnet. Er nennt "Rauco, forte, fracasco, rimbombo, orrore, squarciare, mugghiando, spaventoso”. Worauf der Deutsche "Heiser, stark, Getöse, Wiederhall, Schauer, zerreißen, brüllend, furchtbar" erwidert.
Eine Lösung oder einen Sieger gibt es bei dem Ganzen erwartungsgemäß nicht.
Es gibt Menschen, die eine besondere Begabung besitzen und viele Sprachen sprechen, damit eigentlich den besten Überblick haben. Als ausgesprochen polyglott gilt zum Beispiel Ioannis Ikonomou, der als Übersetzer bei der Europäischen Kommission in Brüssel arbeitet. Der gebürtige Grieche spricht nicht weniger als 32 Sprachen fließend und versteht zudem sogar auch ein paar tote Sprachen wie Maya und Alt-Iranisch.
"Keine Sprache ist nicht schön"
Seine Antwort auf die Frage, welche Sprache schön und welche weniger schön sei, ist klar: "Ich finde überhaupt keine Sprache nicht schön. Auch weiß ich nicht, was eine Sprache interessant macht. Man verliebt sich eben in eine Sprache. Zumindest tue ich es." Und wie bei einem Menschen, in den man sich verliebt, will Ikonomou eben auch die ganze Geschichte der Sprache kennenlernen. "Sprache ist wie Liebe" - schön gesagt!
Es kann eine große Rolle für die individuelle Wahrnehmung spielen, ob sie von einer Frau oder einem Mann gesprochen wird, weil sich die jeweilige Diktion erheblich unterscheidet. Allerdings verändert sich der Stimmklang der Frauen derzeit beträchtlich - zumindest in Mitteleuropa. Soziologen haben herausgefunden, dass sich Frauenstimmen in den vergangenen Jahrzehnten im Schnitt um eine Terz, also um zwei bis drei Halbtöne, gesenkt haben und sie führen das auf die Emanzipation zurück. Denn: eine selbstbewusste Frau mit einer Piepsstimme? Das passt einfach nicht.
Finden wir es eher charmant, vielleicht sogar sexy, wenn ein Franzose, Amerikaner oder Chinese Deutsch mit seinem Akzent spricht - oder unangenehm, weil wir meinen, er oder sie würden es nicht richtig aussprechen?
In der Wochenzeitung "Die Zeit" gab es vor Längerem eine Rubrik mit dem Titel "Völkerverständigung". Darin fand sich zum Beispiel die folgende Anweisung zum: "Deutsch sprechen wie die Italiener".
1. Endet ein Wort mit einem Konsonanten, hängen Sie grundsätzlich ein "e" an. Beispiel: Chefe statt Chef
2. Stehen -en oder -er am Wortende, lassen Sie das "n" oder "r" weg. Beispiel: laufe, Ärge
3. Steht ein "ch" am Anfang oder Ende eines Wortes, wird es wie "sch", steht es in der Mitte, wie "k" ausgesprochen. Beispiel: "Mikaele Schumaker"
4. Sprechen Sie nie ein "H" am Anfang eines Wortes. Beispiel: "Unde" für "Hund", "Ondurase" für "Honduras"
5. Vertauschen Sie "der" und "die". "Das" entfällt ganz. Beispiel: "die Auto", "der Frau"
6. Sagen Sie nach jedem Satz "ä".
Am Ende des Kurses konnten die Leser dann in perfektem Italienischdeutsch den Satz bilden:
"Die Auto von Mikaele Schumake fährte langsame alse die Onda vone meine Chefe, ä."
Von Linguisten sind keine ästhetischen Wertungen über Sprachen zu erwarten. Dafür liefern sie eine These, wie es zu solchen ästhetischen Urteilen kommen kann.
Der israelische Linguist Guy Deutscher ist Autor des internationalen Bestsellers Im Spiegel der Sprache - Warum die Welt in anderen Sprachen anders aussieht und forscht an der Universität von Manchester. Er hat mir das folgendermaßen erklärt:
"Manche Laute wie m, b, g und d gibt es in fast allen Sprachen, andere dagegen sind seltener und sie erscheinen in weniger Sprachen, zum Beispiel das Schwedische ‚sj‘, das Deutsche/Niederländische ‚ch‘ wie in ‚Buch‘, das Englische ‚th‘. Weist eine Sprache Laute auf, die seltener vorkommen, gibt es für Sprecher anderer Sprachen, die nicht mit diesen Lauten vertraut sind, das Risiko, dass diese für ihre Ohren weniger angenehm klingen. Dasselbe gilt auch für seltenere Lautkombinationen wie zum Beispiel Konsonantenhäufungen, nehmen Sie zum Beispiel die Kombination ‚lbstv‘ in ‚selbstverständlich‘. Italienisch hat hingegen sehr wenige Laute (wenn überhaupt), die nicht in anderen europäischen Sprachen vorkommen, und auch wenige Konsonantenhäufungen, es wird allgemein als ‚schöne‘ Sprache gesehen. Das dürfte kein Zufall sein. Natürlich spielen auch kulturelle Vorurteile eine Rolle."
Von der türkischen Sprache zum Beispiel war ich in Berlin seit frühesten Kindertagen umgeben. Ich nahm sie zur Kenntnis, besonders schön klang sie in meinen Ohren nicht. Aber die ersten Kurse an der Volkshochschule halfen mir, Worte zu identifizieren und zu verstehen. Bald wurde mir klar, dass die türkische Sprache, die zur großen Familie der Turksprachen zählt, völlig anders aufgebaut ist als die indoeuropäischen. Sie unterscheidet, dass Bedeutung tragende Einheiten an Wörter angehängt werden, Linguisten sprechen von einer agglutinierenden Sprache. Dem, der das nicht gewöhnt ist, verlangt es einiges an mentaler Akrobatik ab.
Ich höre Türkisch heute mit anderen Ohren. Auch mit einer gewissen Hochachtung vor Menschen, die diese schwierige Sprache so gut beherrschen.
Im englischsprachigen Raum hat sich ein erstaunlicher Wandel im Verhältnis zur deutschen Sprache vollzogen. Bis vor rund einhundert Jahren wurde Deutsch in Verbindung gebracht mit Künstlern der Romantik, mit Philosophen, Musikern und Intellektuellen. Man rechnete dem Deutschen eine gewisse Naivität und Passivität zu - auf jeden Fall sah man darin keine Bedrohung.
Es ist kein Zufall, dass die Vorbehalte gegenüber der deutschen Sprache gerade in Amerika bis heute sehr tief sitzen. An einem bestimmten Punkt gab es einen Bruch: Mit dem Eintritt der Vereinigten Staaten in den Ersten Weltkrieg im Jahre 1917 wurden die deutsche Sprache und überhaupt jegliche Manifestation deutscher Nationalität suspekt und geächtet, vielfach sogar verfolgt. Im Rahmen einer Kampagne der 1915 ins Leben gerufenen American Defense Society wurde Deutsch dann als "Hunnensprache" gebrandmarkt. Als Unterrichtssprache war es fortan verboten, sogar Straßen wurden umbenannt, die Deutsche Sparkasse wurde zur Central Savings Bank, die Germania Life Insurance. Wurde zur Guardian Life Insurance. Und Sauerkraut durfte nur noch liberty cabbage genannt werden, aus dem Hamburger wurde das Salisbury Steak.
Während die Japaner den Ruf, eine "gelbe Gefahr" darzustellen, im Laufe der Jahrzehnte abschütteln konnten, erweisen sich die Vorurteile gegenüber den Deutschen als zählebiger. Warum sie immer weiter fortgeschrieben werden, obwohl Amerikaner, Engländer und Deutsche heute in vielerlei Hinsicht Verbündete sind, bleibt eine erklärungsbedürftige Frage. Denn im Grunde genommen liegen Englisch und Deutsch sprachgeschichtlich recht dicht beieinander.
Die inherent value hypothesis
Vorurteile in Bezug auf eine bestimmte Sprache finden auf der Ebene der regionalen Varianten ihre Fortsetzung. Es ist heute schwer nachzuvollziehen, aber bis vor ein paar Jahrzehnten hatte die absurde "c" viele Anhänger. Diese Hypothese besagt, dass das Ansehen einem Standarddialekt gewissermaßen inhärent sei oder eine biologische Grundlage besitze. Erstaunlicherweise konnte sich diese Hypothese lange halten, obwohl sie leicht zu entkräften ist. Ein Beispiel: Sprecher des kanadischen Französisch empfinden ihre Sprachvariante als weniger ästhetisch als das in Frankreich gesprochene Standardfranzösisch. Spielt man aber beide Varianten Walisern vor, die das Französische nicht beherrschen, können sie keinerlei ästhetische Unterschiede feststellen.
Anders formuliert: Ästhetische Urteile, die die Mentalität oder Persönlichkeit einer bestimmten Volksgruppe betreffen, sind nichts weiter als soziale Mythen. Das heißt natürlich nicht, dass solche Gedankengebilde ohne Bedeutung wären, sie können trotzdem große Kraft entfalten und sich dabei allen rationalen Erklärungsversuchen widersetzen.
Sprachwissenschaftler nennen die entgegengesetzte Position die social connotations hypothesis. Demnach ist es eine Folge gesellschaftlicher Konventionen, dass ein Dialekt mit angenehmen oder unangenehmen Assoziationen in Verbindung gebracht wird. Eine Standard- oder Hochsprache ist nicht aus sich selbst heraus schon überlegen oder elegant, das Urteil wird vielmehr gesellschaftlich konstruiert.
Umgekehrt lassen sich an Dialekten sehr wohl soziale Unterschiede festmachen. Zwischen Stadt und Provinz etwa. Zwischen Erwachsenen- und Jugendkultur. Wie jemand spricht, erlaubt oft Rückschlüsse auf seine Herkunft, seine ethnische Gruppe, seine Bildung, das Milieu - der friesische Bauer mit seinem Platt, der Russlanddeutsche mit seinem rollenden "R", der Genitiv des Bildungsbürgers, das Oxford-Englisch der Oberschicht.
Sie mögen in Wirklichkeit reich an Nuancen, Metaphern oder auch ausländischen Lehnwörtern sein - Mundarten werden gesellschaftlich eher abgewertet, tendenziell mit der Unterschicht assoziiert, mit der gemeinen Landbevölkerung, als vulgär verunglimpft oder nur in der Freizeit oder Verwandtschaft gesprochen. Schlimmer noch: Beherrscht einer die Standardsprache nicht, bleiben ihm womöglich bestimmte berufliche Möglichkeiten verwehrt, Leitungsfunktionen zum Beispiel.
Hier verbirgt sich umgekehrt eine politische Kraft - das Sprechen eines Dialektes kann eine Form der Selbstbehauptung einer unterdrückten Minderheit sein. Mit ihm kann man Dinge verklausulieren, die anders gemeint sind. Man denke an die subversive Rolle, die ihre Sprache für die Emanzipation der Afro‑Amerikaner gehabt hat.
Fremde, exotische Sprachen hören zu können, ist ein Vorteil unserer globalisierten Welt. Wir können uns heute mit ein paar Mausklicks in beinahe jeden Fernseh- oder Radiosender der Erde einwählen und dem Klang der Fremde lauschen.
Hässlich - hart - unmelodisch? Es kommt mir nicht besonders klug vor, da mit einer schnellen Bewertung zur Hand zu sein. Es lohnt sich zu überlegen, wie wir dazu kommen, eine Sprache so oder so zu sehen. Wir müssen erkennen, dass unsere eigene Sprache nur eine Facette in einem gigantischen Klangmosaik ist.
Bernd Brunner lebt in Berlin und Istanbul und hat Bücher und Essays zur "Kunst des Liegens", zur "Erfindung des Weihnachtsbaumes" und zum Verhältnis von Menschen und Bären veröffentlicht.