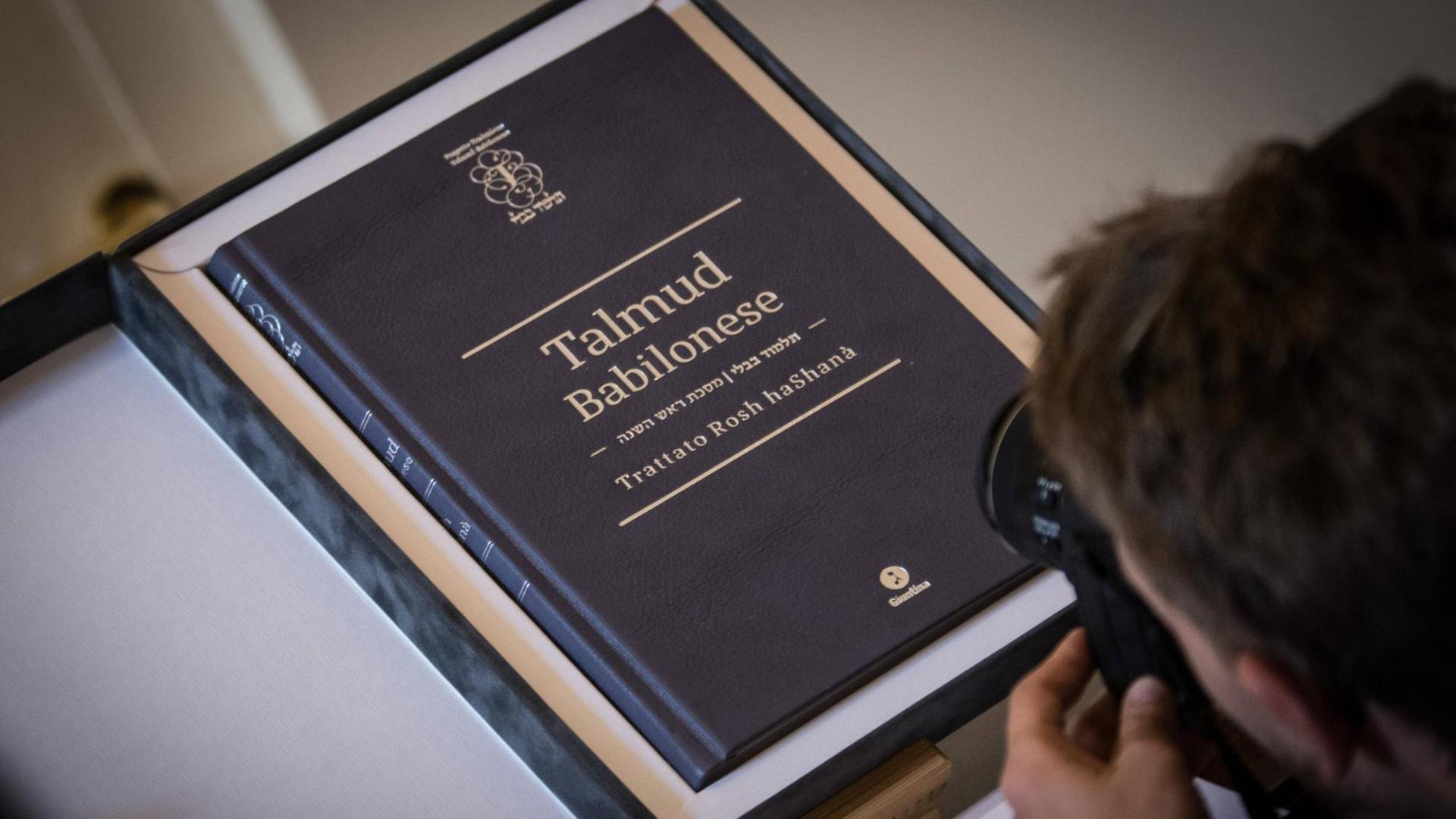Pocitos, ein bürgerlicher Stadtteil der uruguayischen Hauptstadt Montevideo. Es ist Freitagabend, und in der Synagoge NCI, Abkürzung für Nueva Congregación Israelita, feiert die Gemeinde Kabbalat Schabbat, den Beginn des jüdischen Ruhetags. Die NCI ist eine der größten jüdischen Gemeinden Uruguays. In den 1930er Jahren von Flüchtlingen aus Nazi-Deutschland gegründet, hat sich die Gemeinde längst auch für Juden anderer geographischer Herkunft geöffnet.
Ende der 70er Jahre legte die NCI den orthodoxen Ritus ab, der etwa die Trennung von Männern und Frauen während des Gottesdienstes vorsah, und schloss sich der konservativen Masorti-Bewegung an. Rabbiner Daniel Dolinsky:
"Die Entscheidung für das konservative Judentum bescherte unserer Gemeinde großen Zulauf: Menschen, denen die jüdischen Werte wichtiger waren als die Rituale. Im Masorti-Judentum sind Männer und Frauen gleichberechtigt. Unsere Herausforderung in dieser Gemeinde ist, die Bewahrung der Tradition und die konstante Veränderung, die das Leben mit sich bringt, zu vereinen."

Die jüdische Gemeinschaft ist geschrumpft
In Uruguay ist die konservative NCI heute die liberalste aller Synagogen – die anderen fünf Gemeinden sind orthodox ausgerichtet, eine Reformsynagoge gibt es nicht. Einst lebten 40.000 bis 50.000 Juden in dem südamerikanischen Land – vor allem wegen der Immigration aus Osteuropa und Deutschland. Aber seit den 1960er Jahren ist die jüdische Gemeinschaft geschrumpft und hat heute nur noch rund 15.000 Mitglieder, erklärt der Soziologe Rafael Porzecanski:
"Vor allem während Uruguays Wirtschaftskrisen sind viele Juden nach Israel emigriert, aber auch in andere Länder wie Argentinien oder Spanien. Die jüdische Gemeinschaft Uruguays zeichnet aus, dass sie sehr zionistisch ist und sich dem Staat Israel eng verbunden fühlt. Was nicht heißt, dass alle mit der derzeitigen israelischen Regierung einverstanden sind."
Rafael Porzecanski ist Verfasser des Buchs "El Uruguay Judío" – "Das jüdische Uruguay". Darin beschreibt er das Milieu, in dem er selbst aufgewachsen ist und das von einem starken Zugehörigkeitsgefühl geprägt ist: Zwei Drittel der uruguayischen Juden haben eine Bindung an jüdische Gemeinden oder Organisationen – das muss aber nicht heißen, dass sie religiös sind.
"Wir Juden werden im Allgemeinen von den Gesellschaften geprägt, in denen wir leben", sagt Porzecanski: "So wie in Uruguay viele Katholiken ihren Glauben nicht praktizieren, tun das auch viele Juden nicht. Sie sind laizistisch, aber zugleich traditionsbewusst. Aus diesem Traditionsbewusstsein heraus feiern die meisten Familien die jüdischen Feste."
"Uruguay - die Schweiz von Amerika"
Nachmittags in der NCI-Gemeinde, eine Feier der gemeinnützigen Stiftung Tzedaká für Überlebende des Holocausts. An den festlich gedeckten Tischen wird Spanisch gesprochen, aber einige Gäste wechseln im Gespräch mit der Journalistin ins Deutsche. Helmut Simson ist 88 und lebte bis zum Alter von zehn Jahren in Berlin:
"Berlin Schöneberg, Badensche Straße 44. 38 sind wir ausgewandert, erst nach Belgien, dann nach Frankreich. Wir wollten nach Rio, aber da gab's keinen Eintritt, also Montevideo. Mein Vater, meine Mutter sagte: Aber Arthur, Du weißt doch, das Lied: 'Montevideo ist keine Stadt für meinen Leo'. Aber trotzdem: Montevideo. Und dann haben wir die Staatsbürgerschaft bekommen. Heute habe ich zwei Bürgerschaften: die deutsche und die uruguayische."

Auch für Rafael Winter, den Sohn des langjährigen Rabbiners der NCI-Gemeinde, ist Deutsch die Muttersprache. Sein Vater Fritz Winter hatte in Berlin unter anderem bei Leo Baeck studiert. Nach der Flucht gründete er die jüdische Gemeinde in Bolivien mit und übernahm 1950 die Rabbiner-Stelle in Montevideo.
Rafael Winter: "Man hat ihn akzeptiert und er ist gekommen nach Uruguay am 1. August 1950. War eine ganz andere Zeit. Uruguay um die Zeit hat man genannt 'Die Schweiz von Amerika'. Demokratie, ein Land wo war eine gute Mittelklasse, war eine ganz andere Zeit. Mein Vater war Rabbiner von der NCI 34 Jahre."
"Juden und Uruguayer – wir sind beides"
Sohn Rafael, in Montevideo geboren, hat heute nur noch selten Gelegenheit, Deutsch zu sprechen. In Uruguay und Israel hat er die Universität besucht, ist Historiker und Judaistik-Dozent geworden. Winter unterrichtet an jüdischen Schulen und an der jüdischen Universität ORT, der größten privaten Hochschule Uruguays. Außerdem bereitet er Jungen und Mädchen in mehreren Gemeinden auf die Bar Mitzwa und die Bat Mitzwa vor:
"Zwar ist die Zahl der Juden in Uruguay zurückgegangen, aber der Anteil derer, die sich der Religion nähern, ist in jüngster Zeit gewachsen – und darunter sind viele junge Leute."
Die 22-jährige Michelle Geisinger ist zwar nicht religiös, aber dem Judentum eng verbunden. Sie studiert an der katholischen Universität von Montevideo Pädagogische Psychologie:
"Ich bin in einem komplett jüdischen Umfeld aufgewachsen. Ich war auf jüdischen Schulen, meine ganze Familie ist jüdisch, ich ging in die Synagoge, ich kannte quasi keine Nicht-Juden. Bis ich auf die Uni gekommen bin. Mit zwanzig Jahren hatte ich zum ersten Mal nichtjüdische Freundinnen. Und seitdem mache ich die Erfahrung, erklären zu müssen, was das jüdische Volk ist, unsere Religion, unsere Bräuche."

Zurück in der NCI-Gemeinde: Zu Beginn des Kabbalat Schabbat läuft Rafael Winter, der Sohn des langjährigen Rabbiners Fritz Winter, durch die Stuhlreihen und begrüßt Freunde und Bekannte. In dieser Gemeinde ist Rafael Winter groß geworden:
"Zwar versucht unsere jüdische Gemeinschaft, ihre Identität zu pflegen und zu bewahren, aber sie ist zugleich zutiefst in die uruguayische Gesellschaft integriert. Juden und Uruguayer - wir sind nicht das eine oder das andere, wir sind beides.