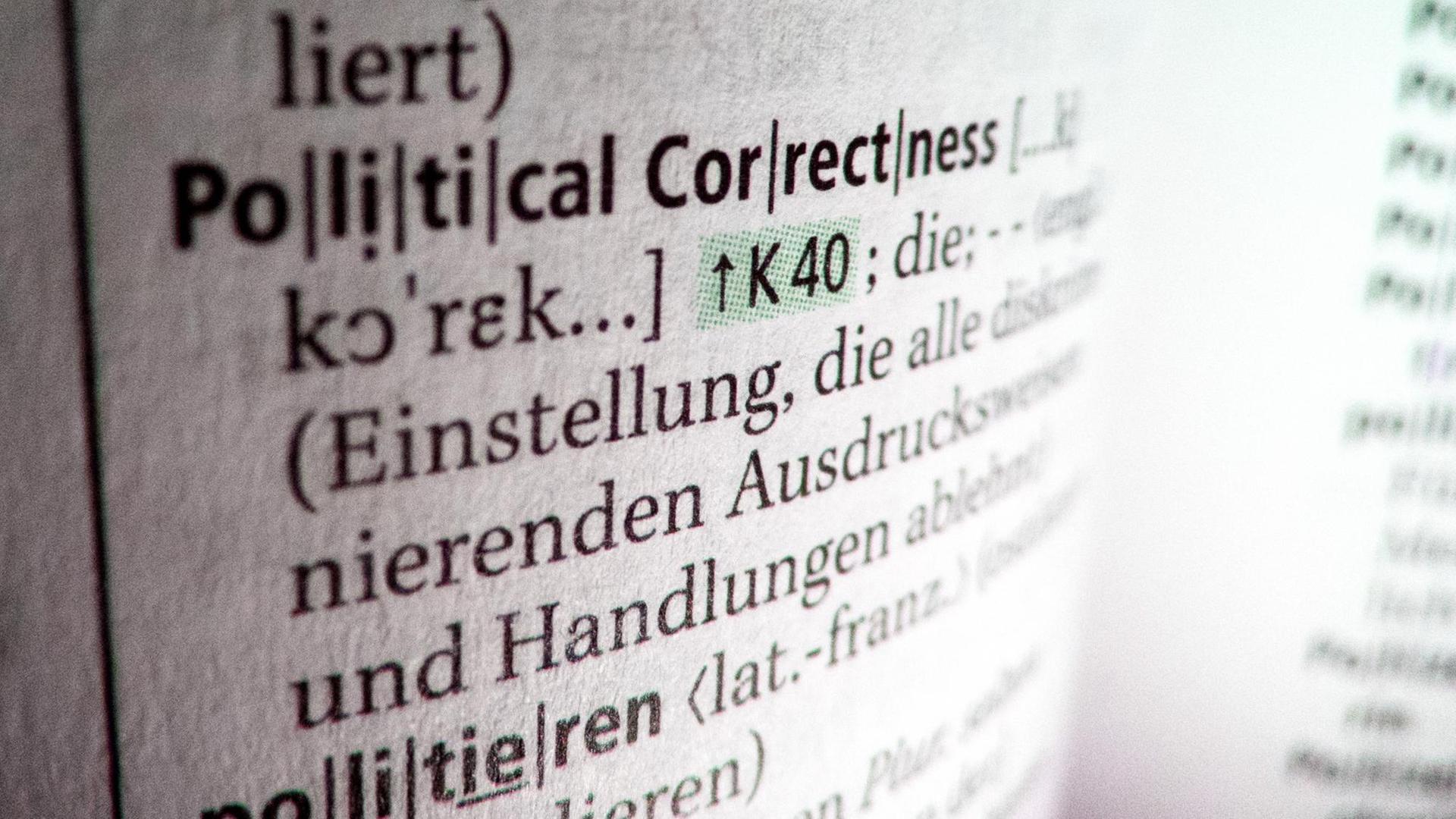
Für eine Medienkolumne ist angesichts der MDR-Geschichte die Frage interessant: Was ist da eigentlich journalistisch passiert, wenn so eine Sendung derart angelegt und beworben wird? Schon der Tweet zur Sendung ist fehlerhaft - also die Formulierung, Zitat: "Warum ist politische Korrektheit zur Kampfzone geworden?", Zitat Ende.
Der Begriff "politische Korrektheit" ist nie etwas anderes gewesen als eine Kampfzone. Der Begriff hat diese Kampfzone eingerichtet, ihr einen Namen gegeben, weil mit der Formulierung "politische Korrektheit" verunglimpft wird, was früher Anstand oder Respekt hieß. Begriffe, gegen die sich gerade ein Theologe wie der zur MDR-Diskussion eingeladene Peter Hahne nicht ohne Weiteres sperren würde.
"Politische Inkorrektheit" klingt schicker als "Rassismus"
Daran kann man schön sehen, was für eine Nebelkerze die Konstruktion "politische Korrektheit" ist: Sie erlaubt es einem Moralapostel wie Hahne erst, sich gegen die Dinge zu wenden, für die er an anderer Stelle werben würde: Anstand und Respekt.
Auch weil die sogenannte "politische Korrektheit" ihr selbstausgedachtes Gegenteil gleich mitbringt, die "politische Inkorrektheit". Die klingt schicker, märtyrerhafter, mutiger als etwa "Rassismus". Zu dem würden sich wohl nicht mal Frauke Petry und Peter Hahne bekennen, die für die Sendung als Alles-sagen-können-dürfen-Woller gecastet waren.
Die Frage ist das Problem
Die Begriffsgeschichte der sogenannten politischen Korrektheit kann man nachlesen in einigen, zugegeben wenigen klugen Büchern und Artikeln. Aber selbst wenn dafür keine Zeit ist bei der Sendungsplanung, könnte einem ja durchaus auffallen, dass die Frage, was man eigentlich noch sagen darf, seit Jahrzehnten immer wieder gestellt wird. Daraus kann man natürlich wie das selbsternannte Sachsenradio schließen, dass das Thema ein Dauerbrenner ist.
Es könnte einem aber auch auffallen, dass die Frage das Problem ist, weil sie gar nicht nach einer Antwort sucht: Sie will nur wieder und wieder gestellt werden. Und sie widerspricht sich dadurch permanent selbst: Denn wenn die Frage gestellt wird, wird immer auch zugleich gedurft, also gesagt, was man angeblich nicht mehr sagen darf. Man darf; die Frage ist falsch gestellt, und der Tweet von MDR Sachsen mit dem "N-Wort" illustriert das gut.
Journalistisch dünn
Und damit tut der Sender zum anderen döfer, als er ist. Bernhard Holfeld, der Programmchef des selbsternannten Sachsenradios, hat gestern im Interview mit @mediasres gesagt, dass er das N-Wort selbst nicht verwenden würde. Wenn man aber der Überzeugung ist, einen furchtbaren Begriff nicht zu verwenden, wofür es auch noch gute Gründe gibt, die sich wiederum in Büchern und Artikeln nachlesen lassen: Wieso verwendet man ihn dann?

Journalistisch ist die Performance von MDR Sachsen also dünn. Journalistisch wäre es, Themen weiterzudrehen, eingefahrene Debatten aus einer anderen Perspektive zu betrachten, etwas Neues abzubilden.
Die Fragen anders stellen
Wenn das selbsternannte Sachsenradio ankündigt, die ausgefallene Sendung nachzuholen, wäre es gut beraten, noch einmal journalistisch darüber nachzudenken. Und die Frage anders zu stellen.
Etwa: Vier nicht-weiße Menschen einzuladen und die zu fragen, was sie immer schon mal sagen wollten zu Sendungen, in denen darüber geredet wird, was man angeblich nicht mehr sagen darf. Oder: Man wird ja wohl noch sagen dürfen, was man wissen kann - Wo Rassismen in unserer Alltagskultur überlebt haben.
Oder auch: Was heißt hier eigentlich Dürfen? - Warum wir weißen Deutschen von diskriminierenden Begriffen nicht lassen wollen wie von Süßigkeiten mit zuviel Kalorien? Dazu könnte man dann sogar Frauke Petry und Peter Hahne einladen. Und dann redeten die mal von sich selbst. Von ihren Ängsten und ihren Abwehrreaktionen. Das wäre journalistisch preiswürdig. Und der Bildungsauftrag würde damit erfüllt.



