"Man muss die Missstände ganz klar benennen"
13:22 Minuten

Michael Kraske im Gespräch mit Christian Rabhansl · 18.04.2020
Der Journalist Michael Kraske beobachtet seit Jahren, wie in Sachsen rechte Strukturen in der Bevölkerung und in den Behörden Fuß fassen und demokratische Kräfte eingeschüchtert werden. Er hat darüber das Buch "Der Riss" geschrieben und fordert einen „New Deal Ost“.
Christian Rabhansl: Seitdem in Dresden Pegida marschiert und seitdem im Osten Deutschlands die AfD massive Erfolge einfährt, seitdem die Radikalisierung zunimmt, seither fragen sich viele im Rest der Republik: Was ist da nur los im Osten? Und manche geben sich dann auch gleich die Antwort – Sie erinnern sich ja wahrscheinlich noch an das "Spiegel"-Coverbild mit dem Wut- und Hutbürger und der Schlagzeile "So isser, der Ossi". Das ist eine Schlagzeile, die eigentlich wenig erklärt, aber viel kaputt gemacht hat.
Der Leipziger Journalist Michael Kraske versucht das besser zu machen, ohne Pauschalisierungen, ohne Kollektivverurteilung, aber deswegen noch lange nicht ohne Schärfe. "Der Riss: Wie die Radikalisierung im Osten unser Zusammenleben zerstört", so heißt sein Buch, und ich habe mit Michael Kraske darüber gesprochen. Herzlich willkommen in der "Lesart", herzlich willkommen Herr Kraske!
Michael Kraske: Hallo, guten Tag!
Rabhansl: Ja, ich habe Sie gerade vorgestellt als Leipziger Journalist, das ist aber nur die halbe Wahrheit, Sie kommen nämlich aus Iserlohn aus dem Westen. Und der erste Satz in Ihrem Buch, der lautet: "Ich bin ein Einheitsmensch." Was macht denn Sie zu einem Einheitsmenschen?
Kraske: Ja, ich bin tatsächlich ein Kind dieser Einheit, und ich beschreibe das auch in meinem Buch, indem ich mir die "Heimat" vornehme, diesen ganz schwierigen, schönen und so häufig missbrauchten Begriff. Ich war Iserlohner mit Leib und Seele, bin dann der Liebe wegen nach Leipzig gegangen. Irgendwann habe ich dann angefangen, dieses Leipzig meine Heimat zu nennen, weil ich wichtige und sehr intime Begegnungen mit Menschen hatte, die mir viel erklärt haben, wo wir in einen Austausch gekommen sind. Und das meint dieser "Einheitsmensch", dass ich tatsächlich nicht mehr nur der Wessi bin. Ich werde immer der Zugezogene bleiben, aber ich bin eben inzwischen auch Leipziger.
"Ich fühle mich hier heimisch"
Rabhansl: Ich habe den Eindruck, Ihr Buch, das beginnt mit einer wirklichen Liebeserklärung an Leipzig, und ich habe mich gefragt: Stellen Sie das deswegen so prominent an den Anfang, um abzufedern, was dann noch kommt?
Kraske: Nein, ich stelle das vor allen Dingen deshalb an den Anfang, weil das das vorherrschende Gefühl ist, weil ich diese Stadt genieße, weil ich mich hier heimisch fühle und weil ich hier inzwischen fest verwurzelt bin und weil mir das Leben hier so unglaublich vieles gibt. Und natürlich muss man wissen, dass die Kritik, die ich übe, diejenige eines teilnehmenden Beobachters ist, der eben nicht schnell hier reinschneit, wie das vielleicht manchmal Kollegen tun, wenn es hier gerade mal wieder brennt, sondern der viele Jahre Vorlauf hat. Das ist vielleicht ein anderer Blick, als ihn viele andere haben. Diese deutsch-deutsche Perspektive erst mal aufzumachen, das war eigentlich der Ansatz für dieses Buch.
Rabhansl: Wann kamen Ihnen denn dann die Zweifel an Ihrer neuen sächsischen Heimat?
Rabhansl: Wann kamen Ihnen denn dann die Zweifel an Ihrer neuen sächsischen Heimat?
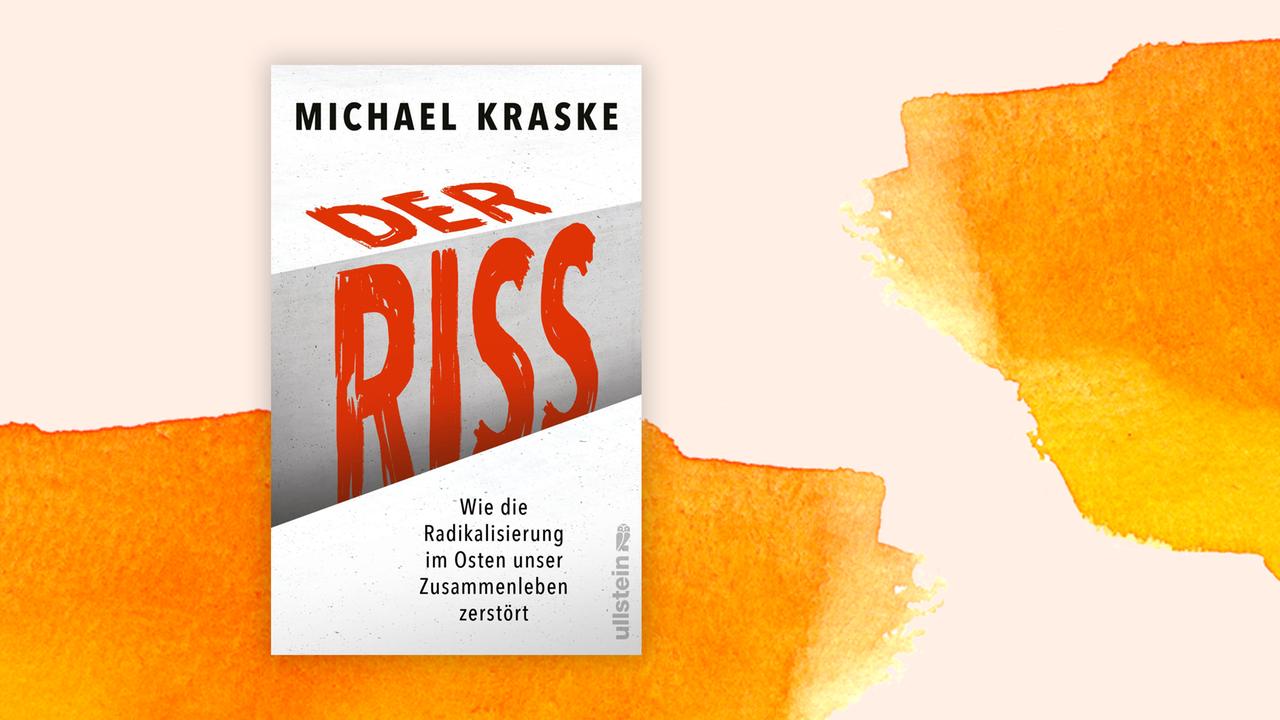
„Die Kritik, die ich übe, ist diejenige eines teilnehmenden Beobachters, der eben nicht schnell hier reinschneit, wie das vielleicht manchmal Kollegen tun“, so Michael Kraske.© ullstein / Deutschlandradio
Kraske: Ich bin dann als Journalist seit Jahren in Sachsen unterwegs gewesen, und ich habe da erschütternde Erlebnisse bei der Recherche gemacht, die aber nicht groß nach draußen gedrungen sind, die dann doch in meiner publizistischen Nische geblieben sind. Ich habe da zum Beispiel erlebt, wie junge Leute, die sich in Demokratievereinen engagiert haben, permanent von Neonazis gejagt und auch geschlagen wurden, wie deren Eltern, die darauf aufmerksam machen wollten – ich denke da an Limbach-Oberfrohna –, immer wieder nahezu zu Nestbeschmutzern erklärt worden sind.
Ich musste in diesen Orten manchmal diese Vereine gar nicht suchen, sondern ich habe einfach nach den Häusern Ausschau gehalten, wo keine Scheiben mehr drin waren, sondern Bretterverschläge, weil es schon so viele Überfälle gab. Und es gab eben auch Strafverfolgungsbehörden, die dem Ganzen nicht konsequent nachgegangen sind, im Gegenteil, die Opfer wurden leider zu oft auch als Täter betrachtet und behandelt. Da hat es über lange Jahre schon eine Gewöhnung an rechte Gewalt und auch an Rassismus und rechtsextreme Ideologie gegeben, lange bevor das dann mit der Flüchtlingsfrage noch mal wirklich richtig hochgekocht ist.
Rechte Gewalt hat sich "normalisiert"
Rabhansl: Sie schreiben in Ihrem Buch, als Sie plötzlich mit diesen Ereignissen konfrontiert sind, mit diesen Gewalttaten, mit nicht richtig gut ermittelnder Polizei, da haben Sie nicht etwa gedacht, wie der Rest der Republik: Oh, das sind aber schreckliche neue Entwicklungen. Sondern Sie haben gedacht: Die 90er sind zurück.
Kraske: Ja, ja, aus den 90ern, da haben mir Freunde zum Beispiel auch erzählt, was sie da selber erlebt haben. Ein Freund, der aus Chemnitz stammt, der hat erzählt, wenn er seine Oma besucht hat, das konnte er eigentlich schon kaum machen, weil er wusste, er muss sich da vor Neonazis in Acht nehmen, er ist dann da auch im Treppenhaus überfallen worden. Eine Flüchtlingshelferin aus Dresden, die hat mir geschildert, dass ihre Jugend im Grunde genommen permanent aus Flucht bestanden hat. Wenn die rote Rücklichter gesehen hat, dann war das für die ein Alarmzeichen, weil sie dann dachte, da steigen Nazis aus dem Auto, und sie muss wieder flüchten.
Das hat sich dann in ganz vielen Orten - auch hier in der sächsischen Provinz, auch in Brennpunkten - normalisiert. Zum Beispiel in Wurzen, was mal als national befreite Zone galt, da gab es Fortschritte. Aber ich bin dann nach Wurzen wieder hingefahren, da hat mir dann ein Sozialarbeiter erzählt, dass der Verein, das Netzwerk für Demokratische Kultur in Wurzen, gerade wieder überfallen worden ist von einer Reihe junger Neonazis. Da wächst also eine neue Generation heran, und man muss sehen, dass das Ganze eine Entwicklung genommen hat, wo die Flüchtlingskrise eigentlich nur ein Katalysator war und wo es einen langen Vorlauf gibt und wo es vor allen Dingen mit Pegida und der AfD Akteure gibt, die ein Klima schaffen, in dem Rassismus wieder ganz offen gelebt wird. In diesem Klima fühlen sich dann auch manche berufen, zu Gewalttaten zu greifen.
Das hat sich dann in ganz vielen Orten - auch hier in der sächsischen Provinz, auch in Brennpunkten - normalisiert. Zum Beispiel in Wurzen, was mal als national befreite Zone galt, da gab es Fortschritte. Aber ich bin dann nach Wurzen wieder hingefahren, da hat mir dann ein Sozialarbeiter erzählt, dass der Verein, das Netzwerk für Demokratische Kultur in Wurzen, gerade wieder überfallen worden ist von einer Reihe junger Neonazis. Da wächst also eine neue Generation heran, und man muss sehen, dass das Ganze eine Entwicklung genommen hat, wo die Flüchtlingskrise eigentlich nur ein Katalysator war und wo es einen langen Vorlauf gibt und wo es vor allen Dingen mit Pegida und der AfD Akteure gibt, die ein Klima schaffen, in dem Rassismus wieder ganz offen gelebt wird. In diesem Klima fühlen sich dann auch manche berufen, zu Gewalttaten zu greifen.

Kundgebung von Pegida auf dem Altmarkt in Dresden im Oktober 2019.© picture alliance/dpa/Matthias Rietschel
"Der Rechtsstaat handelt nicht mehr so, wie er sollte"
Rabhansl: Sie bezeichnen das als eine Gewöhnung an rechte Gewalt, und die habe rechtsstaatsgefährdende Folgen. Wie meinen Sie das?
Kraske: Ich meine das so, dass das tatsächlich auch auf die Institutionen abfärbt, was da passiert. Es hat eine Sozialarbeiterin, die Opfer rechter Gewalt in Thüringen betreut, erzählt, dass beispielsweise Anzeigen in Thüringen auf dem Land von Menschen, die Opfer rassistischer Gewalt werden, teilweise von der Polizei gar nicht mehr aufgenommen werden. Oder da ist einem Mann in einem Club in Nordthüringen der Kiefer gebrochen worden aus rassistischen Motiven, und dieser Mann musste seine Anzeige dann in einem Polizeifahrzeug aufnehmen lassen, wo der Täter mit drinsitzt, was zur Folge hat, dass dann natürlich der Täter auch die Anschrift des Opfers erfährt.
Das heißt, das sind manchmal nur kleine Haarrisse, wo aber der Rechtsstaat offensichtlich nicht mehr so handelt, wie er sollte. Das ist verheerend, weil diese rassistische Gewalt tatsächlich überhand genommen hat. Hinter jeder von diesen Geschichten und von diesen Zahlen stecken natürlich Menschen mit ihren Schicksalen. Sehr in Erinnerung geblieben ist mir eine 19-jährige schwangere Frau aus Eritrea, im siebten Monat schwanger, die in Wurzen von zwei Vermummten angegriffen und verletzt worden ist, die musste ins Krankenhaus. Die Täter wollten offenbar, dass kein schwarzes Baby mehr geboren wird, man wollte ihr klarmachen, dass sie hier nichts zu suchen hat. All das findet nicht mehr die notwendige Aufmerksamkeit – damit würde es anfangen –, aber die Opfer dieser rechten Gewalt werden auch leider zu häufig allein gelassen.
Sehr mangelhafte Aufarbeitung des NSU
Rabhansl: Nun schreiben Sie auch, spätestens mit dem Auffliegen des NSU hätte es eigentlich eine Zäsur geben müssen. Gerade in Sachsen, schreiben Sie. Aber ich habe den Eindruck, Sie finden nicht, dass es eine war.
Kraske: Der NSU hatte tatsächlich alles, wo man einen wirklichen Schnitt hätte machen müssen, wo man alles hätte auf den Prüfstand stellen müssen. Leider war die Aufarbeitung gerade in Sachsen sehr mangelhaft. Die zwei Untersuchungsausschüsse haben weit weniger getagt als in anderen Ländern. Ganz am Anfang bestand die Aufarbeitung darin, dass es ein dünnes Papier des Innenministeriums gab, wo man die Schuld mehr oder weniger nach Thüringen rübergeschoben hat. Bei der Vorstellung des zweiten Abschlussberichts im sächsischen Landtag, da hat die Opposition Dutzende sehr konkrete Vorschläge gemacht, wie man zum Beispiel stärker gegen Hasskriminalität vorgehen kann, dass die Zählweise geändert werden muss, dass man sich aber auch ganz klar die Institutionen angucken muss, wie verbreitet sind beispielsweise rechtsextreme Ideologie und Rassismus bei der Polizei.
Das Ganze ist von den Regierungsparteien CDU und SPD in fünf Minuten abgelehnt worden, das heißt, da ist eine riesige Chance vertan worden. Dass Sachsen da tatsächlich auch in gewisser Weise gefordert ist, das zeigt sich ja auch daran, dass es auch nach dem NSU schon wieder drei Terrorgruppen gab, die neu losgelegt haben. Da war die Oldschool Society, da war die Gruppe Freital und da war die Revolution Chemnitz. Man muss nach den Gründen fragen, und man muss vor allen Dingen den Rechtsstaat und die Institutionen fit machen.
Die Opfer werden allein gelassen
Rabhansl: Welchen Vorwurf machen Sie den sächsischen Landesregierungen der letzten Jahre, Jahrzehnte?
Kraske: Na, vielleicht mal ein drastisches Beispiel: Im vergangenen Jahr ist der Justizminister noch durchs Land gezogen und hat gesagt, dass es jetzt null Toleranz gegen Bagatelldelikte geben würde. Es sollte nichts mehr ungeahndet bleiben, das Schwarzfahren und was man sich da alles auch noch vorstellen kann. Aber zur gleichen Zeit gab es das Verfahren gegen eine rechtsextreme Hooliganbande, Faust des Ostens, das war schon 2013 angeklagt worden. Die haben gegen politische Gegner und gegen Migranten massiv Gewalt angewendet, und dieses Verfahren ist über Jahre nie eröffnet worden.
Das Landgericht Dresden sah sich immer überarbeitet, konnte das angeblich nicht verhandeln. Das Signal, das damit gesetzt wird, ist natürlich ganz fatal, das lässt die Opfer allein, und das ist das Gegenteil von der Konsequenz, die man immer nach außen trägt. All das spielt jetzt zusammen, dass wir diese sächsischen Zustände hier haben.
Rabhansl: Sie haben jetzt eine ganze Menge aufgezählt, was eine Radikalisierung im Osten ausmacht, was diese vielleicht noch befördert. Sie wollen ja aber mit Ihrem Buch eigentlich nicht spalten, nach dem Motto, der Osten ist eben rechtsradikal, sondern Sie wollen ja differenziert herangehen. Wie wollen Sie das schaffen, wenn Sie mit einer solchen Wucht diese Vorwürfe abladen?
Rabhansl: Sie haben jetzt eine ganze Menge aufgezählt, was eine Radikalisierung im Osten ausmacht, was diese vielleicht noch befördert. Sie wollen ja aber mit Ihrem Buch eigentlich nicht spalten, nach dem Motto, der Osten ist eben rechtsradikal, sondern Sie wollen ja differenziert herangehen. Wie wollen Sie das schaffen, wenn Sie mit einer solchen Wucht diese Vorwürfe abladen?

Demonstration "Herz statt Hetze" im Oktober 2018 in Dresden gegen die Pegida-Bewegung und für Weltoffenheit.© picture alliance/dpa/ZB/Oliver Killig
Kraske: Man muss erst mal die Probleme und die Missstände ganz klar benennen und kritisieren, ohne dass das auch gleich wieder zum Beispiel als Sachsen-Bashing abgetan wird. Und man muss auf der anderen Seite auch sehen, dass es natürlich unglaublich viele zivilgesellschaftliche Organisationen gibt, auch Leute, die bereit sind, sich für die Demokratie zu engagieren. Nur werden die eben beispielsweise in kleinen Orten auch zu häufig allein gelassen. Man muss ganz dringend jetzt die Strukturen schaffen, dass Demokratie gefördert wird, man muss aber zum Beispiel auch aus diesem riesigen Wutberg, den es hier ja im Osten gibt, die ganz real existierenden Ungerechtigkeiten auch wirklich angehen und lösen.
"Ostdeutsche verdienen 17 Prozent weniger Lohn"
Rabhansl: Das nennen Sie im Buch einen "New Deal Ost", der Ihnen Hoffnung macht. Können Sie das mal erklären? Der besteht ja aus diesen zwei Elementen: Demokratie stärken und echte Probleme angehen. Haben Sie da Beispiele für?
Kraske: Ostdeutsche verdienen 17 Prozent weniger Lohn als im Westen bei gleicher Arbeit – das geht nicht, da muss man ran. Es gibt ein Drittel, die für einen Niedriglohn arbeiten, obwohl sie Vollzeit arbeiten. All diese Probleme sind tatsächlich vernachlässigt worden, weil man sich lieber mit Sündenbock-Diskussionen eben um Flüchtlinge beschäftigt hat. Und auch in dem Demokratiebereich, da kann man ganz viel tun. Also: In den Institutionen muss man sich tatsächlich angucken, dass Beamte, die beispielsweise auf einen Tag X hinsteuern und dieses System abschaffen wollen, natürlich nichts im Polizeidienst zu tun haben. Aber zum Beispiel auch viel bessere und mutigere politische Bildung in den Schulen.
Ich meine damit nicht predigen, die Demokratie ist schön, sondern nein, das sind Zeitzeugengespräche, das ist Schüleraustausch, das sind wirkliche Diskurse zu aktuellen Themen, die auch in die Schulen reingehören. Und die Akteure, die es in ganz, ganz vielen Orten im Osten und auch in Sachsen hier gibt, die die Demokratie voranbringen, die muss man stärken, die muss man dauerhaft absichern. Das ist bisher Flickwerk. Und zuallerletzt muss man ein Leitbild entwickeln, das eben nicht auf Herkunft und auf Hautfarbe abzielt, in dem es nicht darauf ankommt, wer schon immer hier Deutscher war, sondern auf Teilhabe. Ich glaube, die Coronakrise zeigt sehr deutlich, dass das eine Gesellschaft ist, die wir brauchen, weil alle gebraucht werden, die hier sind und die sich einbringen und die für diese Gesellschaft eintreten.
Rabhansl: Gebürtig, wie gesagt, kommen Sie aus Iserlohn, darüber haben wir ganz am Anfang schon gesprochen. Jetzt haben Sie einige Jahre schon Sachsen zu Ihrer neuen Heimat gemacht. Nach dieser ganzen Recherche: Bleibt Sachsen Ihre Heimat?
Kraske: Sachsen bleibt meine Heimat, auch wenn das ein bisweilen schwieriger Ort ist. Aber natürlich gibt es unglaublich tolle Begegnungen, die ich hier habe, auch mit Menschen, die sich sorgen, die feinfühlig ein Gespür dafür haben wirklich, wenn andere zurückbleiben. Ich glaube, wir müssen wegkommen von diesen ganz großen Trennungen und von "Ost gegen West". Das ist gar nicht die Realität, die viele Leute erleben, sondern wir erleben uns, glaube ich, viel stärker als Familienmenschen, in den Schulen, als Vereinsmenschen. In diesen Identitäten, in diesen Zwischenräumen und Schnittmengen, da findet das Leben statt, und das muss man stärken.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandfunk Kultur macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.






