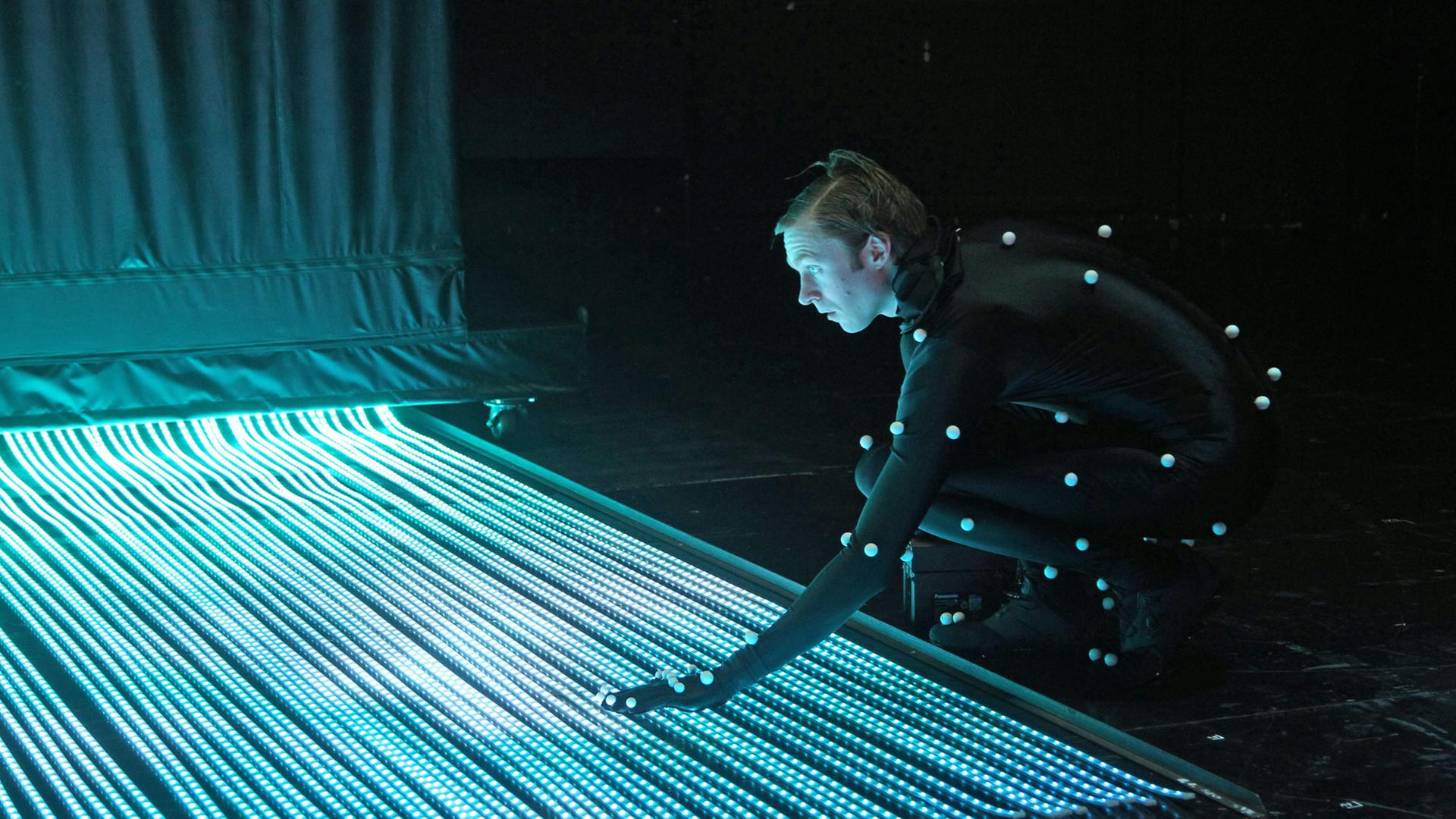Eine einzelne weiße Feder segelt herab auf die mit dunkelblauem Samt ausstaffierte Guckkastenbühne. Eine zweite Feder fliegt hinterher. Und eine dritte. Durch das Dunkel tappt ein weißes Zotteltier, das an Samson aus der Sesamstraße erinnert – und verschwindet. Es folgt eine Frau mit gigantischem Blusenknopf, größer als ein Wagenrad. Dahinter ein Gorilla mit roten Brüsten. Dann schließt sich der goldene Vorhang vor diesen Traumgebilden und auf den breiten Treppenstufen vor dem Guckkasten versammelt sich eine Kleinfamilie aus den biederen 50ern: der Mann mit Hut, Anzug und Aktentasche; die blond gelockte Frau in gelbem Kleid und Strickjacke; die Kinder mit kurzen Hosen und Röckchen, dazu weiße Kniestrümpfe. Und das Verwechslungsspiel beginnt.
Der Mann 2: "Ein Mann sitzt am Tisch,"
Die Frau: "neben ihm seine Frau,"
Die Tochter: "seine Tochter,"
Der Sohn: "sein Sohn,"
Die Frau: "der Tisch ist gedeckt, Abendessen,"
Die Tochter: "Abendbrot -"
Der Mann 2: "und dann geht die Tür auf,"
Der Mann 1: "und der Mann, der doch schon am Tisch sitzt, kommt zur Tür herein. Ich bin zuhause!"
Der Mann 2: "Entsetzen."
Der Mann 1: "Wer bist du?, fragt der Mann in der Tür."
Der Mann 2: "Ein Mann sitzt am Tisch,"
Die Frau: "neben ihm seine Frau,"
Die Tochter: "seine Tochter,"
Der Sohn: "sein Sohn,"
Die Frau: "der Tisch ist gedeckt, Abendessen,"
Die Tochter: "Abendbrot -"
Der Mann 2: "und dann geht die Tür auf,"
Der Mann 1: "und der Mann, der doch schon am Tisch sitzt, kommt zur Tür herein. Ich bin zuhause!"
Der Mann 2: "Entsetzen."
Der Mann 1: "Wer bist du?, fragt der Mann in der Tür."
Die hässliche Fichte im Vorgarten
Roland Schimmelpfennig setzt auf das altbekannte Doppelgänger-Spiel. In seinem Stück können die Figuren die Szenen allerdings immer wieder zurückspulen, wiederholen, kommentieren und ändern. "Oder andersherum" heißt es dann – und plötzlich ist es die Frau, die ihren Ehemann in doppelter Ausführung vorfindet, während er seine Spaltung gar nicht bemerkt. Nach dem Mann trifft auch die Frau auf ihr Double: Als sie ins Bett kommt, liegt da schon eine andere und knutscht mit dem neuen Ehemann. Das Doppelgänger-Paar ist abenteuerlustiger, mutiger, triebgesteuerter und lebendiger als die redlichen Eheleute. Es schläft ungehemmter miteinander, ist weniger routiniert, flirtet und schafft ab, was stört – die hässliche Fichte im Vorgarten etwa, die den Mann schon seit Jahrzehnten nervt, wird kichernd bei Nacht und Nebel umgehauen. Es ist die ewige Frage nach der Identität, die Schimmelpfennig in seinem kleinen, surreal komischen, philosophischen Gedankenexperiment umkreist: Wie viele Ichs stecken in einer Person? Wie lebt man all das, was in einem schlummert? Ein uraltes Motiv, das nicht erst die Postmoderne erfunden hat – Kleists Verwechslungskomödie "Amphitryon" hat hier Pate gestanden; darin verführt der Doppelgänger die nichts ahnende Ehefrau des Titelhelden und wirkt am Ende sogar authentischer als der echte Ehemann.
Bei Schimmelpfennig führt die Doppelgängerin der Frau, die selbst gern Sängerin geworden wäre, als laszive Chansonnière in Rot das Dilemma ad absurdum:
Die Frau 2: "Wenn du nicht da bist, wo du bist, wo bist du dann, bist du dann da, wo du nicht bist, bist du doch da, und bist es nicht, wo du auch bist, und bist es nicht."
Bei Schimmelpfennig führt die Doppelgängerin der Frau, die selbst gern Sängerin geworden wäre, als laszive Chansonnière in Rot das Dilemma ad absurdum:
Die Frau 2: "Wenn du nicht da bist, wo du bist, wo bist du dann, bist du dann da, wo du nicht bist, bist du doch da, und bist es nicht, wo du auch bist, und bist es nicht."
Durchaus unterhaltsam – keineswegs verstörend
Anne Lenk gibt Schimmelpfennigs Identitätsspiel als eine Mischung aus groteskem Märchen und Freud’schem Trieb-Traum, bei dem das Unterbewusste und Monströse stets hinterm glitzernden Vorhang hervor bleckt.
Das ist bildreich und fantasievoll und über den kurzen 70minütigen Abend durchaus unterhaltsam – aber keineswegs verstörend. Dafür sind die Plüschtiere dann doch zu drollig und das Ehepaar zu brav. Dass die Inszenierung nicht unter die Haut gehen kann, liegt letztlich aber an der Vorlage. Schimmelpfennigs kontrolliert durchkonstruiertes Experiment findet mit Probanden statt, nicht mit Menschen aus Fleisch und Blut. Eine kleine Etüde, eine Fingerübung ist das zu einem bereits ausbuchstabierten Thema – kein großer Wurf also, aber ein fein kalkuliertes Gedankenspiel.
Das ist bildreich und fantasievoll und über den kurzen 70minütigen Abend durchaus unterhaltsam – aber keineswegs verstörend. Dafür sind die Plüschtiere dann doch zu drollig und das Ehepaar zu brav. Dass die Inszenierung nicht unter die Haut gehen kann, liegt letztlich aber an der Vorlage. Schimmelpfennigs kontrolliert durchkonstruiertes Experiment findet mit Probanden statt, nicht mit Menschen aus Fleisch und Blut. Eine kleine Etüde, eine Fingerübung ist das zu einem bereits ausbuchstabierten Thema – kein großer Wurf also, aber ein fein kalkuliertes Gedankenspiel.