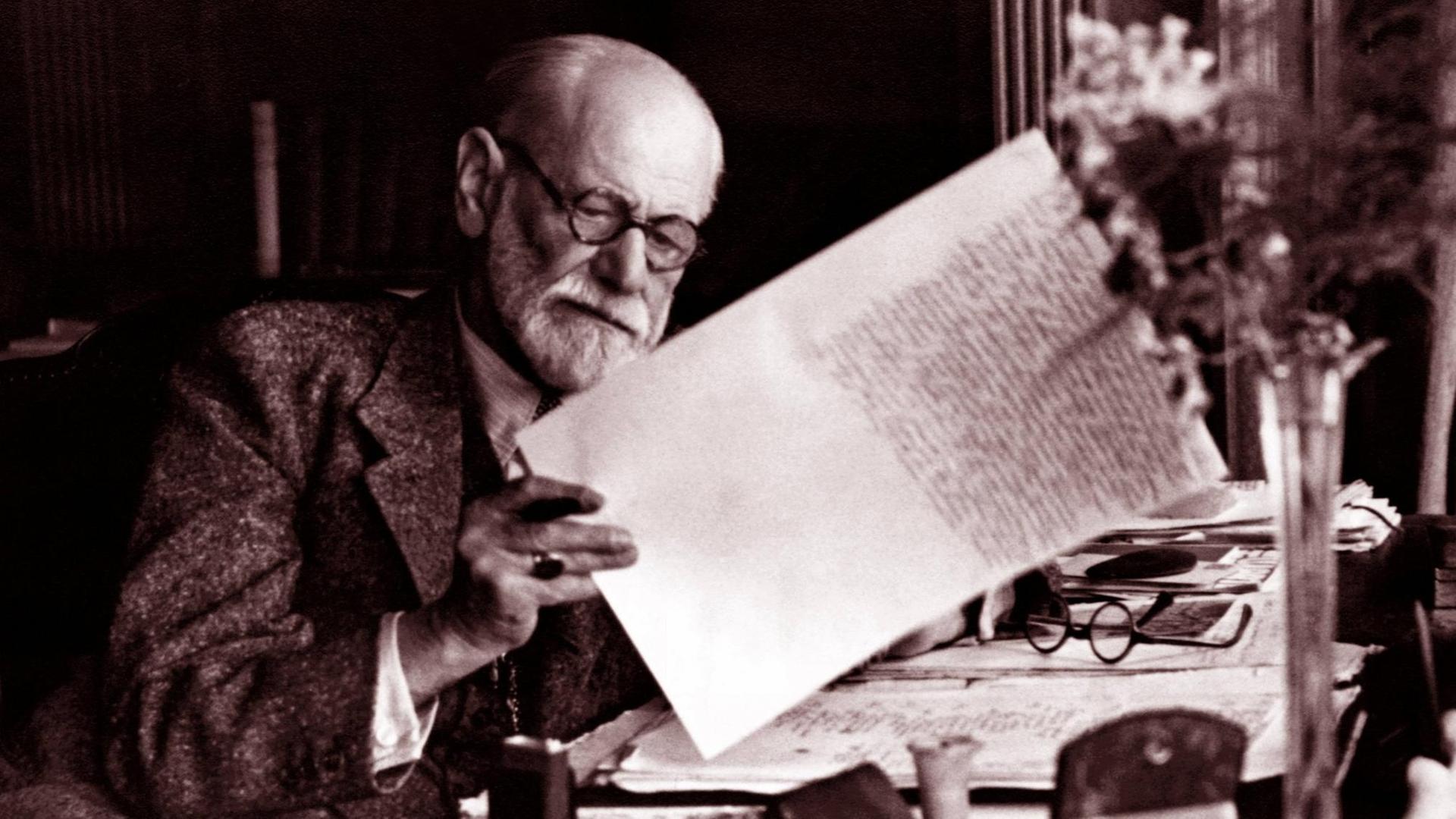
Der Vater der Psychoanalyse Sigmund Freud erzählte einmal mit süffisanter Ironie, wie ein ausgezeichneter Mann, der sich rühmte, sein Freund zu sein, ihn zur Religion habe bekehren wollen. Der Wiener Psychoanalytiker zeigte sich überrascht, denn er hatte ihm zuvor sein religionskritisches Pamphlet Die Zukunft der Illusion geschickt. In seinem Brief erzählte ihm der Bekannte, dass er in der Religion ein Gefühl von "Ewigkeit", von etwas "Unbegrenztem" verspürt. Er empfinde sogar ein "ozeanisches Gefühl". Freud erwiderte darauf in seiner bekannt trockenen Art: Dieses "ozeanische Gefühl" habe er selbst niemals an sich entdeckt. Allerdings könne er sich als Psychoanalytiker sehr wohl vorstellen, dass dieses Gefühl in der Sexualität anzutreffen ist. So schreibt er in dem 1930 publizierten Aufsatz Das Unbehagen in der Kultur:
"Auf der Höhe der Verliebtheit droht die Grenze zwischen Ich und Objekt zu verschwimmen." (Bd. XIV, 423)
Sigmund Freud bleibt bei der menschlichen Psyche, um dieses Gefühl zu ergründen. Er entdeckt es beim Säugling, der sein Ich noch nicht von der Außenwelt scheiden kann. Ein Ichgefühl entsteht nämlich erst - so Freud - durch die Trennung von Innen- und Außenwelt. Das ursprüngliche Gefühl von Einheit, das vom Kleinkind empfunden wird, bleibt in den tiefen Schichten des Seelenlebens erhalten. Als Psychoanalytiker sah Sigmund Freud nur zwei Wege, dieses Gefühl zu ergründen: Entweder seine im seelischen Haushalt abgelagerten "Spuren" in der therapeutischen Praxis offen zu legen. Oder aber: Das mysteriöse, allumfassende Gefühl in ein Jenseits zu projizieren. So wie es Freuds Bekannter machte und dabei die Religion entdeckte.
Der Düsseldorfer Psychoanalytiker Bernd Nitzschke beschreibt Freuds Leistung als radikale und nüchterne Entmystifizierung:
"Freud hat sich nicht dazu geäußert, ob es Gott gibt oder nicht. Er hat gefragt, warum glauben die Menschen an Gott."
Erlösung vom Übel der Welt
Gäbe es keinen Grund, nach dem Sinn des Lebens zu fragen, dann gäbe es auch keine Religion. Seitdem die Menschen entdeckt haben, dass Leid und Krieg, Krankheit und Tod nicht aus der Welt zu schaffen sind, suchen sie nach einer übergeordnet-jenseitigen Instanz, die sie vom Weltenübel erlöst. Bernd Nitzschke:
"Wenn Sie die Schrift 'Unbehagen in der Kultur' nehmen, da ordnet er die Religion in die Gruppe der Maßnahmen ein, die die Menschen erfunden haben, um sich die Not des Lebens zu erleichtern."
In der 1927 erschienenen Polemik "Die Zukunft einer Illusion" fasst der 70-jährige Sigmund Freud den Kern der Religion mit folgenden Worten zusammen: Gott allein ist stark und gut, der Mensch aber schwach und sündhaft.
"Über jedem von uns wacht eine gütige, nur scheinbar gestrenge Vorsehung, die nicht zulässt, dass wir zum Spielball der überstarken und schonungslosen Naturkräfte werden: der Tod selbst ist keine Vernichtung, keine Rückkehr zum anorganisch Leblosen, sondern der Anfang einer neuen Art von Existenz" (Bd. XIV, 340).
Opium des Volks
Die Religion als universale Tröstung, die dem hilflosen Wesen in der Not beisteht, verweist auf einen anderen Philosophen des 19. Jahrhunderts, der seine religionskritischen Schriften - anders als Freud - als junger Revolutionär verfasste. 1844 schrieb der 26-jährige Karl Marx in seiner neuen Heimat Paris:
"Die Religion ist die allgemeine Theorie dieser Welt, ihr allgemeiner Trost- und Rechtfertigungsgrund. Das religiöse Elend ist in einem der Ausdruck des wirklichen Elends. Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist das Opium des Volks."
Der junge Marx diagnostiziert die Religion, ebenso wie später der gealterte Sigmund Freud, also als Illusion:
"Die Aufhebung der Religion als des illusorischen Glücks des Volkes ist die Forderung seines wirklichen Glücks. Die Forderung, die Illusionen über seinen Zustand aufzugeben, ist die Forderung, einen Zustand aufzugeben, der der Illusionen bedarf."
Bernd Nitzschke erzählt, Freud habe zwar nur wenig von Karl Marx gelesen, dafür aber als junger Student begierig die religionskritischen Schriften von Ludwig Feuerbach verschlungen, die auch den jungen Philosophen Marx begeisterten:
"Wir wissen aus seinen Briefen, dass er als Student ganz intensiv und eifrig Feuerbach gelesen hat. Er hatte eine Zeit als Student, wo er sagte, das ist der wichtigste Philosoph, den er gelesen hat. Wie Marx und Feuerbach auch geht er ja von der Projektionsthese aus: Gott ist ein menschliches Wesen, das wir in den Himmel projiziert haben - unsere Wünsche, unsere Wunscherfüllung, die wir im Jenseits erwarten. Das sind Feuerbach'sche Gedanken"
Projektion des Himmelsvaters
Der Münchner Psychoanalytiker Herbert Will kommentiert, dass Sigmund Freud die philosophische Religionskritik eines Feuerbach und Marx zum ersten Mal psychoanalytisch formulierte: Wir projizieren - meinte Freud - nicht allein ein menschliches Wesen in den Himmel: Es ist der Vater, mit seinen Stärken und Schwächen, der zum allmächtigen und schutzspendenden Gott-Vater erhoben wird:
"Wichtig ist das Argument der Vatersehnsucht: dass die Menschen, die einer Religion anhängen, im Grunde einem psychischen Infantilismus anhängen, also noch Kinder geblieben sind und nicht Erwachsene geworden sind, weil sie - wie ein Kind an seinem Vater hing -, so dann an dem Gott hängen."

Religion und Vatersehnsucht blieben lebenslang ein heikles Kapitel in Freuds Biographie. Mit seinem Vater Jacob, einem armen jüdischen Händler aus einem mährischen Schtetl, las der junge Sigmund regelmäßig die Hebräische Bibel. Bis zum Tod des Vaters wurden in der Familie Freud getreu die Regeln des orthodoxen Judentums eingehalten. Für Bernd Nitzschke ist die Beziehung zum Vater Dreh- und Angelpunkt in Freuds Religionsverständnis.
Offenbar war der Vater kein strenggläubiger Familienpatriarch, denn der Wiener Medizinstudent bekannte einmal, er sei in einer "leidlich frommen Familie" aufgewachsen. Freud meinte, dass seine Familie, gemessen an der Herkunft des Vaters, erstaunlich tolerant war. Dafür gab es mehrere Anzeichen: Der deutsche Vornamen des Sohnes, der enge Kontakt mit seinem Religionslehrer Samuel Hammerschlag, der ein aufgeklärtes Judentum vertrat, und schließlich die katholische Kinderfrau, die ständig mit dem kleinen Sigmund die Messe besuchte.
Bruch mit dem Judentum
Trotz aller religiösen Einflüsse: Sigmund Freud vollzog als Erwachsener einen radikalen Bruch mit der jüdischen Tradition der Familie. Das ging nicht immer ohne Konflikte ab. Denn die Ehefrau Martha, die zeitlebens eine gläubige Jüdin blieb, musste akzeptieren, mit einem bekennenden Atheisten zusammenzuleben. Herberts Wills Düsseldorfer Kollege Bernd Nitzschke fügt eine weitere Anekdote aus dem Leben der Freuds hinzu:
"Er bekennt sich zum Judentum, aber nicht zur jüdischen Religion. Das geht ja bis in den Alltag hinein, dass er alle jüdischen Riten in der Familie nicht mehr fortsetzt, während seine Frau darunter leidet, ihr Großvater ist Rabbiner gewesen. Er lässt auch seine Söhne nicht beschneiden, also er hat eine ganz dezidiert antireligiöse Einstellung im Alltag."
Während der Vater in der Welt der jüdischen Riten gelebt hatte, vollzog der Sohn auf seine Weise den Vatermord. Nach dem Tod von Jacob Freud wurden die jüdischen Feste, mit Duldung der Mutter, eingestellt. Und in Sigmund Freuds eigener Familie hielt man sich lediglich an die Tradition christlicher und säkularer Feste.
Herbert Will versteht diesen Entschluss des angehenden Mediziners und Psychoanalytikers als Akt der Selbstbehauptung: Der Sohn wollte sich vom jüdischen Milieu seines Vaters Jacob, seines Großvaters Schlomo und seines Urgroßvaters, des Rabbis Ephraim, befreien. Befreien aus dem ärmlichen, ungebildeten Schtetl, dem Kosmos aus Thora und Talmudstudien, die seinen Vater lebenslang prägten. Sigmund, der sich ganz bewusst mit seinem säkularen Vornamen identifizierte, wählte die heroische Weltsicht des aufgeklärten Wissenschaftlers:
"Ich habe in meinem Buch über Freuds Atheismus von einer heroisch-stoischen Weltanschauung und Haltung gesprochen. Heldenhaft und stoisch sollte man anerkennen, was das Leben zu bieten hat."
Heroisches Weltbild
"Heldenhaft" beschäftigt sich der Begründer der Psychoanalyse nicht mit dem ewigen Leben, sondern mit den Problemen, die von den Menschen gerne verdrängt werden: Tod, Krankheit und Endlichkeit des Lebens. Bernd Nitzschke kommentiert:
"Er hat ja ein heroisches Weltbild: der Mensch müsse in der Lage sein, diese Endlichkeit anzuerkennen, und unter dieser Voraussetzung kann er dann mit seiner irdischen Existenz etwas ganz anderes anfangen, dann kann er den Sinn des Lebens in der irdischen Welt erkennen und versuchen, hier human zu leben."
Der Wiener Psychoanalytiker äußerte sich in seinen letzten Lebensjahren immer wieder kritisch über den Zustand der Kultur. In den revolutionären und krisenhaften 1920er Jahren waren derart kritische Stellungnahmen unter Intellektuellen an der Tagesordnung. Doch in den Schriften Freuds bildet der folgende Passus aus Die Zukunft einer Illusion eine Ausnahme. Es ist ein leidenschaftliches Plädoyer für eine humanistische Politik, abgeleitet aus der Anerkennung des Realitätsprinzips:
"Es ist ein unzweifelhafter Vorteil, Gott überhaupt aus dem Spiele zu lassen und ehrlich den rein menschlichen Ursprung aller kulturellen Einrichtungen und Vorschriften einzugestehen. Mit der beanspruchten Heiligkeit würde auch die Starrheit und Unwandelbarkeit dieser Gebote und Gesetze fallen. Die Menschen könnten verstehen, dass diese geschaffen sind, nicht so sehr, um sie zu beherrschen, sondern vielmehr um ihren Interessen zu dienen, sie würden ein freundliches Verhältnis zu ihnen gewinnen, sich anstatt ihrer Abschaffung nur ihre Verbesserung zum Ziel setzen. Dies wäre ein wichtiger Fortschritt" (Bd. XIV, 365)."

Freuds Selbstverständnis als "ganz gottloser Jude" verdeutlicht den Widerspruch, den er bewusst aushalten wollte. Mit den religiösen Riten seiner Väter und Urväter hatte er gebrochen. Die jüdischen Glaubensregeln waren für ihn wertlos geworden. Und dennoch bekannte er in seiner Schrift "Der Mann Moses und die monotheistische Religion", die er 1939 kurz vor seinem Tod im Londoner Exil veröffentlichte: Das Judentum sei die fortschrittlichste unter allen monotheistischen Religionen.
Kritik am Christentum
Überraschend ist sein Vorwurf gegenüber dem Christentum: Der neuen Religion hielt er "kulturelle Regression" vor, weil sie das jüdische Bilderverbot zurücknehme und - unter dem Zeichen von Marienkult und Dreifaltigkeit - auf das Stadium des Polytheismus zurückfalle. Von der sinnlichen zur geistigen Religion - das ist für Sigmund Freud das Signum des Fortschritts.
Bernd Nitzschke kommentiert die von Freud beanspruchte Höherwertigkeit des Judentums:
"Er will damit ja sagen, es fällt den Menschen schwer, auf bestimmte primitive Formen der Wunscherfüllung, wie sie die ursprünglichen polytheistischen Religionen mit ihren orgiastischen Festen dargeboten haben, zu verzichten. Dieser Triebverzicht, das ist das, was er im Judentum als Fortschritt der Geistigkeit propagiert. Zu dieser Tradition bekennt er sich, zum Judentum als aufgeklärte, fortschrittliche Stufe in der menschlichen Entwicklung. Christentum ist für ihn wieder ein Rückfall in der Entwicklung."
Wenn Sigmund Freud die jüdische Religionspraxis ablehnte, dann aber nicht das Judentum in seiner kulturellen Erscheinung. Freud pflegte eine recht traditionelle Auffassung, wenn er von der jüdischen "Rasse" sprach. Das Judentum verstand er als kulturellen Sonderstatus, den er beibehalten wollte. Deshalb half er aktiv bei der Gründung einer jüdischen Loge mit, die sich in Anspielung auf den mosaischen Bund "Söhne des Bundes" nannte. Herbert Will meint dazu:
"Er hat sich in seinem privaten Leben immer mit Juden und der jüdischen Kultur umgeben. Das war ganz wichtig, zentral für ihn. Er war von jüdischen Freunden und Familien umgeben, er war Mitglied einer Loge B'nai B’rith in Wien, also das war für ihn das Medium, in dem er in seinem privaten Leben lebte."
Selbstschöpfung im jüdischen Milieu
Seit seinem Studium in Wien fühlte sich Freud den westlichen Juden zugehörig, das heißt, im damaligen Verständnis, den höher stehenden und assimilierten Juden. Dabei verdrängte der Psychoanalytiker ganz offensichtlich, dass er dem ostjüdischen Milieu entstammte, das gemeinhin als ungebildet empfunden wurde. Über Sprache und Verhalten seiner einstigen Landsleute setzte sich der jugendliche Sigmund immer wieder hochmütig hinweg.
Die Wiener Universität bedeutete dagegen den Eintritt in eine andere Welt: Erst hier erlernte der junge Student die deutsche Sprache, und hier eignete er sich die Wissenschaft an, mit der er sich endgültig vom Ursprungsmilieu und seiner Religion entfernen konnte. Mit anderen Worten: Die Universität ermöglichte dem Wissenschaftler einen Akt der Selbstschöpfung.
Aber dennoch: Die Universität wurde auch zum Ort einer narzisstischen Kränkung. Denn als Freud sein Studium begann, war Wien die antisemitischste Stadt Europas. Angesehene Mediziner verbreiteten die Auffassung, Juden seien ungeeignet, als Ärzte zu praktizieren. Theodor Billroth, einer der renommiertesten Mitglieder der medizinischen Fakultät, hetzte 1876, zwei Jahre nach Freuds Immatrikulation, öffentlich gegen die Aufnahme von Juden. Der amerikanische Medizinhistoriker Sander Gilman schreibt dazu:
"Am 10. Dezember 1876 kam es in der medizinischen Fakultät zu gewalttätigen antisemitischen Ausschreitungen. Zwischen jüdischen und nicht-jüdischen Studenten brachen Handgreiflichkeiten aus, und Gruppen jüdischer Studenten wurden mit körperlicher Gewalt aus der Fakultät geschafft" (Sander L. Gilman: Freud, Identität und Geschlecht, S. 42).
Die Folge des grassierenden Antisemitismus: Trotz seiner außerordentlichen Qualifikation blieb Sigmund Freud die angestrebte akademische Karriere verwehrt. Ein Ordinariat war für jüdische Wissenschaftler nicht vorgesehen. Weswegen sich Freud, wie Herbert Will berichtet, für einen ungewöhnlichen Umweg entschied:
"Sie müssen sich vor Augen führen, dass er als Naturwissenschaftler begonnen hat. Er wollte eine Universitätskarriere als Naturwissenschaftler beginnen, was ihm als Jude verhindert wurde. Und er hat dann die pfiffige Idee gehabt, in der Praxis eines Nervenarztes seine Art der Wissenschaft zu entwickeln."
Anhänger eines "kämpferischen Judentums"
In der Folgezeit wurde der Antisemitismus großer Teile der Wiener Bevölkerung zur leibhaften Bedrohung der Juden. 1897 wurde schließlich der Politiker Karl Lueger, der die antisemitischen Stimmungen geschickt nutzte und anheizte, zum Bürgermeister gewählt. Lueger, den Hitler als sein Vorbild bezeichnete, leitete die Geschicke Wiens bis 1910. Die antisemitischen Anfeindungen bereiteten Sigmund Freud zusehends Sorge, weil die meisten Psychoanalytiker Juden waren und die Psychoanalyse als "jüdische Wissenschaft" galt. In Luegers letztem Amtsjahr ermahnte Freud seine Wiener Kollegen auf dem zweiten psychoanalytischen Kongress:
"Ihr seid zum großen Teil Juden und deshalb nicht geeignet, der neuen Lehre Freunde zu erwerben. Juden müssen sich bescheiden, Kulturdünger zu sein" (zit. n. Sander L. Gilman: Freud, Identität und Geschlecht, S. 42).
Der Antisemitismus begleitete Freud zeitlebens wie ein übermächtiger Schatten. 1939, als der Antisemitismus allmählich zur physischen Vernichtung der Juden überging, fragte sich Freud, wie es wohl zur "Intensität und Dauerhaftigkeit des Judenhasses der Völker" (Bd. XVI, 196) gekommen sei. Distanziert hat er sich niemals vom Judentum. Nicht einmal, als er mit ansehen musste, dass SS-Leute seine Bücher verbrannten. Nein, bis zu seinem Tod blieb Sigmund Freud, wie Bernd Nitzschke berichtet, dem kämpferischen Judentum verbunden:
"Das ist die berühmte Stelle aus der Traumdeutung, da erzählt Freud, wie er im Alter von 10 Jahren mit dem Vater spazieren geht. Der Vater erzählt ihm nun, wie er einmal spazieren ging und dann einem Antisemiten begegnet, der ihm die Mütze vom Kopf schlägt und sagt: 'Jud runter vom Trottoir!' Da bricht für Freud das Bild des vollkommenen Helden, Vaters zusammen. Freud sagt dann: Von dem Augenblick an hat er die Figur des Vaters ersetzt, nicht durch einen religiösen Führer, sondern durch einen Feldherrn, nämlich durch Hannibal. Seit meiner Gymnasialzeit, sagt er, ist Hannibal, also ein kriegerischer Held, sein neues Vorbild. Also er geht dabei nicht auf die religiöse Schiene, sondern in Richtung Aufklärung und Vernunft. Und dieses kriegerische Temperament, gegen Vorurteile anzutreten, sich in der Minderheit zu befinden, rechnet er dem Judentum an. Die Juden mussten immer um ihre Existenz kämpfen. In diesem Sinne ist er stolz auf die jüdische Tradition."


