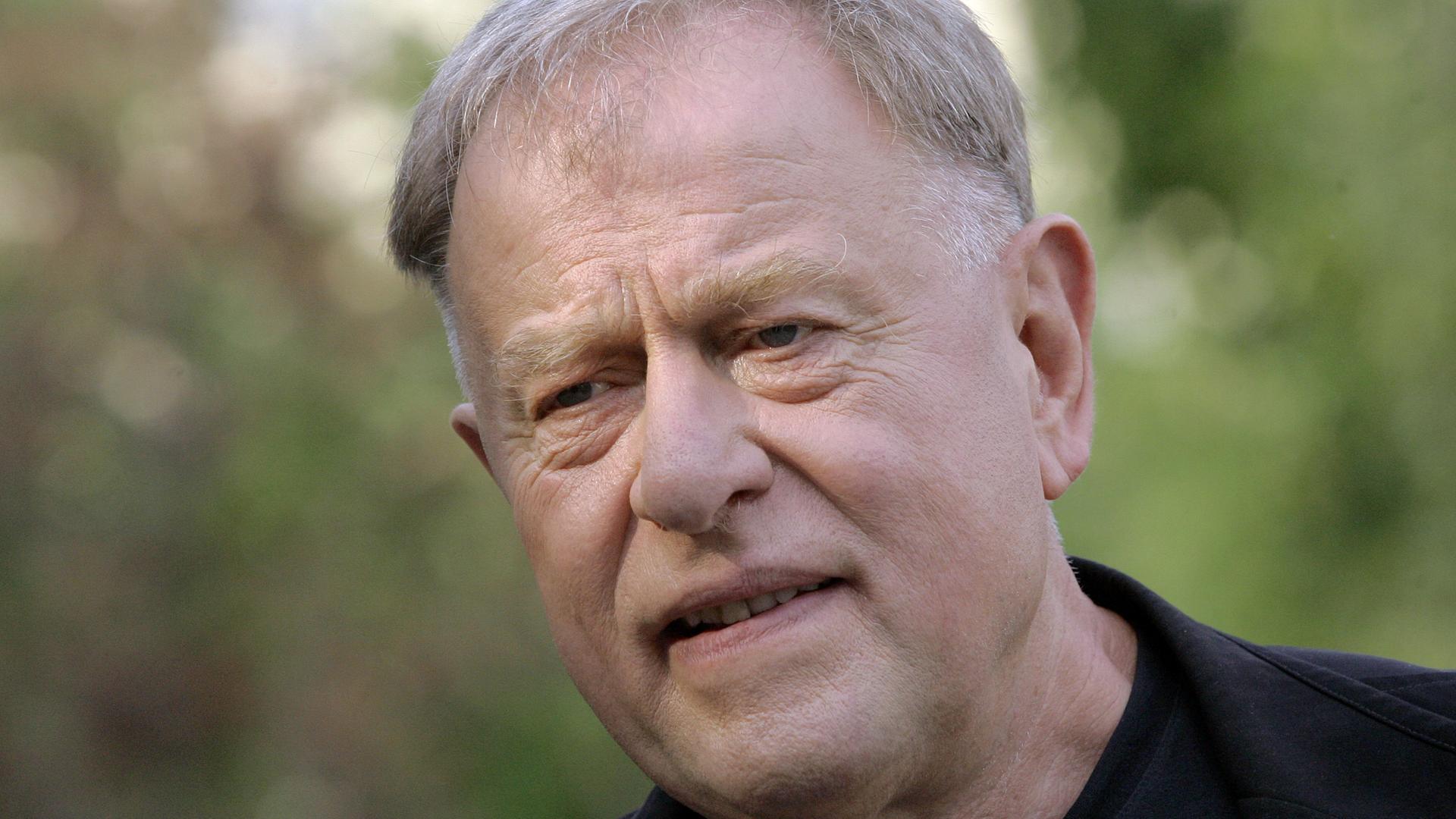
Gewaltige Puderwolken stieben aus dem Pelzumhang von Hofmarschall von Kalb empor. Und jede seiner Gesten hinterlässt einen kleinen weißen Nebel. Mit der plakativen Charakterisierung der höfischen Figuren wird in Peymanns "Kabale und Liebe" nicht gespart.
Der Präsident von Walter stakst auf Stelzen über die Bühne, die man in gewaltige Stiefel gesteckt hat. Sein intriganter Sekretär Wurm buckelt in einem kuriosen schwarzen Kunstlederfrack durchs Geschehen, zieht sich bei Gelegenheit einen Damenstrumpf übers Gesicht und erinnert ein wenig an Maikäfer Sumsemann aus Peterchens Mondfahrt. Lady Milford schwebt im blassrosa Kleid auf ihrer Schaukel über die Bühne und Präsidentensohn Ferdinand tritt mit zünftigem Schnurrbart, im weißen Hemd unter schwarzer Weste auf wie ein Musketier.
Die Herren bei Hofe sind vorwiegend schwarz, die kleine bürgerliche Stadtmusikantenfamilie Miller ist durchgängig cremeweiß. Der simple Farbkontrast ist wörtlich zu nehmen; hie die Unschuld der gottgefälligen Menschen, die ihr Verhalten nach moralischen Grundsätzen richten, dort die korrupten Mächtigen, die für ihre Karriere, ihr Plaisir und ihre Geltungssucht über Leichen gehen. Wer sich mit ihnen einlässt, dem schwärzt die Tinte das zuvor reinliche Kleidchen.
So ergeht es der Luise Millerin, die mit einem großen Tintenfleck auf Gewand und Seele zurechtkommen muss, nachdem sie Wurm zu einem getürkten Liebesbrief gezwungen hatte, den man dem eifersüchtig verliebten Präsidentensohn Ferdinand zuspielt, um ihn von seiner Liebe zu dem Bürgermädchen abzubringen.
"Jetzt erst gefällt sie mir, deine Tochter! So schön war sie nie, die Schminke ist ab, womit die Tausendkünstlerin die Engel hintergangen hat. Es ist ihr schönstes Gesicht, es ist ihr erstes wahres Gesicht! Schriebst du diesen Brief?"
"Ich schrieb ihn."
Sabin Tambrea verkörpert den ausgetricksten Präsidentensohn, dem eitle Naivität zum Verhängnis wird, Antonia Bill die zwischen Moralgesetzen und bösen höfischen Spielchen verhedderte Luise. Wenn das zentrale Paar nun schon von einer Schar von Clowns umringt ist, die nicht eine Spur von Figurenentwicklung auszeichnet, so sähe man doch bei ihnen gerne wenigstens Spuren von Gefühlen, die sie immerhin bis in den Tod treiben und um derentwillen das ganze Theater zweieinhalb Stunden veranstaltet wird. Aber so wenig wie ihre Körper einander berühren, sowenig berühren sich ihre Worte.
Es ist kurios: Hier will ein Theater erklärtermaßen die Stücke der Klassiker möglichst werktreu auf die Bühne bringen und kann doch trotz massiver Striche nicht einmal den Plot halbwegs plausibel vom Anfang bis zum Ende durch erzählen. Stattdessen ergreift Ferdinand eine Geige und Bogen, die an Fäden vom Schnürboden herabhängen, kratzt wild und böse auf den Saiten herum, bevor er das Instrumentchen zertrümmert. Der mächtige Präsident des Joachim Nimtz ist nichts als ein lächerlichen Popanz, die kleine kontrollsüchtige Vaterliebe wird im Spiel des Martin Seifert zu clownesker Umtriebigkeit.
Claus Peymann stellte vor gut sechs Jahren mit der Schillerschen Jungfrau von Orleans eine unzeitgemäße und utopische Frauenfigur auf die Bühne. Nun aber macht er mit der Luise Miller und ihrer Tragödie weder eine historische Distanz sichtbar, bei der man über das Verhalten der Figuren wenigstens erstaunen könnte, noch skizziert er Verbindungslinien, in denen die bürgerliche Tragödie aus heutiger Sicht wieder aufleuchten könnte. Da ist buchstäblich nichts zu sehen außer aufgedrehten Witzfiguren rings um hohle Floskeln deklamierende Protagonisten.
Die Trübnis wird noch forciert durch ein schnoddriges Universaldekor, in dem man vermutlich 95 Prozent des Dramenrepertoires genauso gut, genauso schlecht inszenieren könnte. In das kahle schwarze Bühnenhaus hat Achim Freyer einen Ring mit zwölf Scheinwerfern gehängt. Sie schweben mal höher, mal tiefer und schließlich auch schräg wie ein gewaltiger Heiligenschein über einem kreisrunden Kampfplatz. Zwei Stühle hängen da auch herunter, ein kleiner fürs Bürgerliche, ein mit Stelzen versehener fürs Höfische. Gestrichen hat Peymann das Ende, die späte Schuldeinsicht des Präsidenten. Das ist nur konsequent: Was hätte eine solch lächerliche Macht schon in der Seele von Menschen anrichten können? Vom Ende her wird klar: Kabale und Liebe hat hier einfach nicht stattgefunden.
Der Präsident von Walter stakst auf Stelzen über die Bühne, die man in gewaltige Stiefel gesteckt hat. Sein intriganter Sekretär Wurm buckelt in einem kuriosen schwarzen Kunstlederfrack durchs Geschehen, zieht sich bei Gelegenheit einen Damenstrumpf übers Gesicht und erinnert ein wenig an Maikäfer Sumsemann aus Peterchens Mondfahrt. Lady Milford schwebt im blassrosa Kleid auf ihrer Schaukel über die Bühne und Präsidentensohn Ferdinand tritt mit zünftigem Schnurrbart, im weißen Hemd unter schwarzer Weste auf wie ein Musketier.
Die Herren bei Hofe sind vorwiegend schwarz, die kleine bürgerliche Stadtmusikantenfamilie Miller ist durchgängig cremeweiß. Der simple Farbkontrast ist wörtlich zu nehmen; hie die Unschuld der gottgefälligen Menschen, die ihr Verhalten nach moralischen Grundsätzen richten, dort die korrupten Mächtigen, die für ihre Karriere, ihr Plaisir und ihre Geltungssucht über Leichen gehen. Wer sich mit ihnen einlässt, dem schwärzt die Tinte das zuvor reinliche Kleidchen.
So ergeht es der Luise Millerin, die mit einem großen Tintenfleck auf Gewand und Seele zurechtkommen muss, nachdem sie Wurm zu einem getürkten Liebesbrief gezwungen hatte, den man dem eifersüchtig verliebten Präsidentensohn Ferdinand zuspielt, um ihn von seiner Liebe zu dem Bürgermädchen abzubringen.
"Jetzt erst gefällt sie mir, deine Tochter! So schön war sie nie, die Schminke ist ab, womit die Tausendkünstlerin die Engel hintergangen hat. Es ist ihr schönstes Gesicht, es ist ihr erstes wahres Gesicht! Schriebst du diesen Brief?"
"Ich schrieb ihn."
Sabin Tambrea verkörpert den ausgetricksten Präsidentensohn, dem eitle Naivität zum Verhängnis wird, Antonia Bill die zwischen Moralgesetzen und bösen höfischen Spielchen verhedderte Luise. Wenn das zentrale Paar nun schon von einer Schar von Clowns umringt ist, die nicht eine Spur von Figurenentwicklung auszeichnet, so sähe man doch bei ihnen gerne wenigstens Spuren von Gefühlen, die sie immerhin bis in den Tod treiben und um derentwillen das ganze Theater zweieinhalb Stunden veranstaltet wird. Aber so wenig wie ihre Körper einander berühren, sowenig berühren sich ihre Worte.
Es ist kurios: Hier will ein Theater erklärtermaßen die Stücke der Klassiker möglichst werktreu auf die Bühne bringen und kann doch trotz massiver Striche nicht einmal den Plot halbwegs plausibel vom Anfang bis zum Ende durch erzählen. Stattdessen ergreift Ferdinand eine Geige und Bogen, die an Fäden vom Schnürboden herabhängen, kratzt wild und böse auf den Saiten herum, bevor er das Instrumentchen zertrümmert. Der mächtige Präsident des Joachim Nimtz ist nichts als ein lächerlichen Popanz, die kleine kontrollsüchtige Vaterliebe wird im Spiel des Martin Seifert zu clownesker Umtriebigkeit.
Claus Peymann stellte vor gut sechs Jahren mit der Schillerschen Jungfrau von Orleans eine unzeitgemäße und utopische Frauenfigur auf die Bühne. Nun aber macht er mit der Luise Miller und ihrer Tragödie weder eine historische Distanz sichtbar, bei der man über das Verhalten der Figuren wenigstens erstaunen könnte, noch skizziert er Verbindungslinien, in denen die bürgerliche Tragödie aus heutiger Sicht wieder aufleuchten könnte. Da ist buchstäblich nichts zu sehen außer aufgedrehten Witzfiguren rings um hohle Floskeln deklamierende Protagonisten.
Die Trübnis wird noch forciert durch ein schnoddriges Universaldekor, in dem man vermutlich 95 Prozent des Dramenrepertoires genauso gut, genauso schlecht inszenieren könnte. In das kahle schwarze Bühnenhaus hat Achim Freyer einen Ring mit zwölf Scheinwerfern gehängt. Sie schweben mal höher, mal tiefer und schließlich auch schräg wie ein gewaltiger Heiligenschein über einem kreisrunden Kampfplatz. Zwei Stühle hängen da auch herunter, ein kleiner fürs Bürgerliche, ein mit Stelzen versehener fürs Höfische. Gestrichen hat Peymann das Ende, die späte Schuldeinsicht des Präsidenten. Das ist nur konsequent: Was hätte eine solch lächerliche Macht schon in der Seele von Menschen anrichten können? Vom Ende her wird klar: Kabale und Liebe hat hier einfach nicht stattgefunden.
