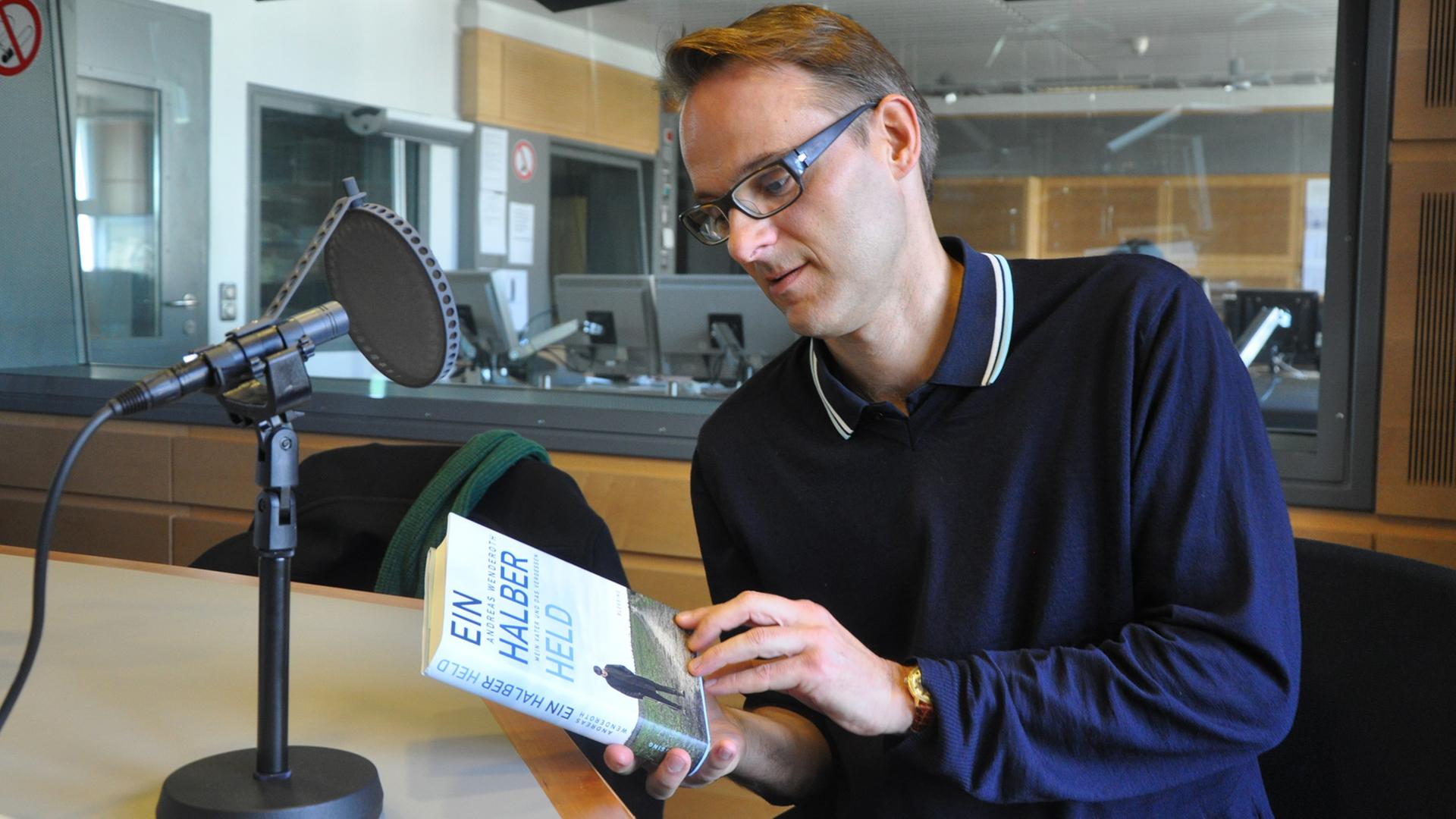Shirin Sojitrawalla: Warum ist das Wort Demenz nie in ihrer Familie gefallen?
Inge Jens: Weil es, meine Söhne würden sagen: "kein Thema" war. Heute gibt es wahrscheinlich keine Familie, die sich nicht irgendwann einmal über Demenz unterhalten hat. Aber damals, als wir jung waren aber auch, als mein Mann dann krank wurde, gab es das Wort "Demenz" eigentlich im normalen Sprachgebrauch nicht. Man wusste zwar vielleicht, jemand ist dement. Das hieß so viel wie: Er ist verrückt, aber das war nicht auf eine bestimmte Krankheit bezogen. Jedenfalls umgangssprachlich nicht.
Sojitrawalla: Von Ihrem neuen Buch sagen Sie selbst, es sei vermutlich ihr letztes. Es versammelt von Ihnen geschriebene Briefe aus den Jahren 2005 bis 2013. Warum haben Sie sich denn entschlossen, diese Briefe, also Briefe, in denen die Krankheit Ihres Mannes im Zentrum steht, nun zu veröffentlichen?
Jens: Es war eigentlich Zufall. Ich habe meinen Computer aufgeräumt. Dabei habe ich diese Briefe gefunden, habe mir die auf die Demenz meines Mannes bezogenen Stellen ausgedruckt und sie chronologisch geordnet, weil ich plötzlich das Bedürfnis fühlte, diese zufällige, wirklich sehr zufällige Gelegenheit zu benutzen, noch einmal den ganzen Krankheitsablauf Revue passieren zu lassen. Mich noch einmal dessen zu vergewissern, was da gewesen war in den letzten zehn Jahren. Es muss ein Moment gewesen sein, wo ich mich auch wieder psychisch in der Lage fühlte, diese Rückschau überhaupt leisten zu können.
Sojitrawalla: Und nach welchen Kriterien haben Sie jetzt die Briefe für dieses Buch ausgesucht?
Jens: Nach der Art und Weise, in der sie den Krankheitsverlauf schilderten. Die Anzahl der Empfänger ist ja auch begrenzt. Und die Kontinuität kam zum Teil auch dadurch zustande, dass ich in den zehn Jahren vielleicht an 10 Empfänger geschrieben habe. Aber immer wieder an die gleichen – und nicht auf jede Zuschrift oder mir fremde Menschen geantwortet habe.
"Es war ein Leben, auf das ich gern zurückblicke."
Sojitrawalla: Die Zeit an der Seite ihres kranken Mannes beschreiben Sie auch als einen Lernprozess. Das Menschsein sei nicht an geistige Kräfte gebunden, haben Sie kürzlich noch mal in einem Interview gesagt. An was ist es gebunden?
Jens: Naja, er war ja auch nicht irgendein Mensch, sondern es ist ja immer auf meinen Mann bezogen. Immer auf den Partner, der mich 50 Jahre meines Lebens hindurch begleitet hat, mit dem zusammen ich eigentlich das Leben geführt habe. Es war ein Leben, auf das ich gern zurückblicke, das ihn mir als Gesunden immer wieder vor Augen führt. Und dass ich ihn da nicht verlasse in dem Moment, wo er krank ist, wo er nicht mehr der ist, der er war, das bedarf ja wohl keines Kommentars.
Sojitrawalla: Mehr als 50 Jahre hat er Sie begleitet oder Sie ihn. Sie haben 1951 geheiratet, und Sie schreiben in Ihrem Buch: "Es gibt mehr Grund zur Dankbarkeit als zum Hadern." Haben Sie das wirklich immer so empfunden?
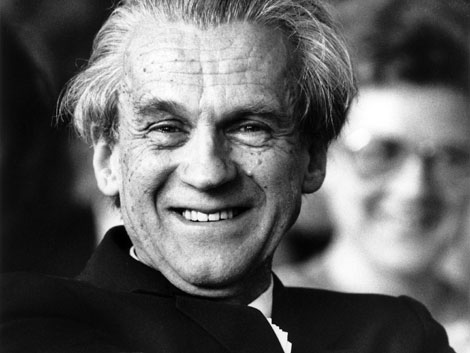
Jens: Während der Krankheit meines Mannes? Ja. Ja, und ich bin davon überzeugt, ein sehr privilegiertes Leben gehabt zu haben. Ebenso bin ich davon überzeugt, dass man kein Anrecht hat, ein privilegiertes Leben bis ans Ende seiner Tage zu führen. Mein Mann ist krank geworden. Er ist nicht gefragt worden, und ich bin auch nicht gefragt worden. Und das hat unsere Gemeinschaft völlig verändert. Aber es hat nicht einen Moment zur Debatte gestanden, ihn zu verlassen. Dass ich ihn nicht von zuhause weggeben musste, erfüllt mich mit großer Dankbarkeit. Ich habe für ihn eine fantastische Pflegerin gefunden, die mir alle körperlichen Arbeiten abnahm, die ich einfach – dank meines Alters sozusagen – nicht mehr leisten konnte. Aber ich bin doch die ganze Zeit bei ihm gewesen. Er hat zuhause leben können, dank der Hilfe, die diese wunderbare Frau damals geleistet hat.
Sojitrawalla: Es gibt inzwischen – im Gegensatz zu früher – viele Bücher zum Thema. Erfahrungsberichte, die sich zumeist mit der Demenz der Eltern oder Großeltern beschäftigen. Etwa Arno Geigers "Der alte König in seinem Exil". Lesen Sie so was?
Jens: Den Geiger habe ich damals gelesen. Das von Geiger geschilderte Leben seines Vaters unterschied sich vom Leben meines Mannes in nahezu allem. Der Vater Geiger zeigte Seltsamkeiten, aber er war doch immer noch als der erkennbar, der er einmal gewesen ist. Mein Mann dagegen war zum Schluss nicht mehr als der erkennbar, der er Gottseidank die weitaus längste Zeit seines Lebens hat sein dürfen.
"Er hat damals immer gesagt: 'So will ich unter keinen Umständen leben!'"
Sojitrawalla: In Ihrem Buch sagen Sie oder schreiben Sie: "Was lebt, will leben" Was macht sie da so sicher?
Jens: Die Beobachtung, die ich bei meinem Mann gemacht habe. Wir haben uns natürlich viel auch über derartige Krankheiten unterhalten. Und er hat damals immer gesagt: "So will ich unter keinen Umständen leben! Wenn ich einmal von einer solchen Krankheit befallen werden sollte, dann will ich nicht mehr. Dann will ich sterben dürfen." Und er ist sogar so weit gegangen, dass er gesagt hat: "Dann bitte ich dich, alles zu tun, um mir dazu zu verhelfen, sterben zu dürfen."
Sojitrawalla: Und Sie waren sich aber dann sicher, als er sehr erkrankt war, dass es nicht mehr sein Wunsch war?
Jens: Ich sah, dass er durch seine Krankheit zwar ein völlig Anderer geworden war, aber ein Mensch, der in einer viel intensiveren Weise in gewissen Art lebte, als er es vorher getan hat. Vorher hat er in seiner geistigen Welt gelebt, in der Welt seiner Bücher, in der Welt der Literatur. Jetzt lebte er, zum Teil jedenfalls, auf dem Hof seiner Pflegerin, die nahm ihn nachmittags mit rauf. Und hier lebte er zusammen mit Tieren. Er, der sich nie für Tiere interessiert hat, entdeckte plötzlich das Dasein von Wesen, zu denen er aus unerklärlichen Gründen Vertrauen fasste. Die er auf den Schoß nahm, die er fütterte. Alles Dinge, die ich mir von ihm als gesundem Menschen niemals hätte vorstellen können. Und deswegen war auch die Forderung oder die Übereinkunft, die wir getroffen hatten, das war mit einem Mal nicht relevant. Denn ich sah, dass er in diesem anderen, zweiten Leben auch sehr, sehr viele Glücksmomente hatte. Völlig anderer Art, als er sie von früher kannte. Aber ich wage zu bezweifeln, dass sie weniger intensiv auf ihn eingewirkt haben, als zum Beispiel früher das Glück eines ihn sehr interessierenden Buches, das er lesen konnte.
"Ich habe dem Wunsch meines Mannes nicht nachkommen können."
Sojitrawalla: Das, was Sie schildern und erfahren haben, macht doch eine Einrichtung wie die Patientenverfügung fragwürdig, weil wir ja alle nicht absehen können, wie wir reagieren, wenn wir dann tatsächlich krank werden.
Jens: Das glaube ich auch. Ich würde das Wort "fragwürdig" nicht benutzen. Ich würde sagen: Jeder soll eine Patientenverfügung niederschreiben. Es entbehrt nicht einer gewissen Würde, sich als gesunder Mensch Gedanken zu machen, wie möchte ich versorgt werden? Wie möchte ich mein Leben oder mein Sterben führen dürfen in dem Augenblick, wo ich unheilbar krank bin? Das ist schon wichtig, sich einmal sehr intensiv darüber Gedanken zu machen. Das halte ich für wichtig. Es ist ja keine unrevidierbare Geschichte, so eine Verfügung aufzuschreiben. Jetzt können Sie mir natürlich vorhalten: Sie haben diesen Willen in keiner Weise erfüllt. Nein, das habe ich nicht. Ich habe dem Wunsch meines Mannes nicht nachkommen können, das bekenne ich. Ob ich Recht oder Unrecht getan habe, wage ich nicht zu entscheiden.
Sojitrawalla: Der zweite Teil Ihres Buches besteht aus kritischen Anmerkungen zum Alltag in unseren Pflegeeinrichtungen. Woran mangelt es diesen Ihrer Meinung nach am meisten?
Jens: Es mangelt zunächst einmal an Menschen, die ausgebildet sind, oder die man sensibilisiert hat für diese Art von Kranken. Die gelernt haben, mit ihnen umzugehen, auf ihre Bedürfnisse einzugehen. Um es ganz krass zu sagen: Es mangelt an Verständigen. Es mangelt überhaupt an Personal. Überall, wo Sie hinkommen, in jedem Altersheim, würden sie sagen: Wir würden ja gerne. Und ich glaube ihnen, dass sie gerne würden. Aber wir können nicht, denn wie sollen wir das alles schaffen? Da Abhilfe zu schaffen, meine ich, sei eine Aufgabe, die man einklagen muss. Als Angehörige, aber auch als einer, der sich ausrechnen kann, dass es unter Umständen ja auch einmal diesen Eingriff in sein eigenes Leben geben kann. Dass er dafür gewappnet ist. Und überhaupt, dass er, wenn er es erlebt, aufgerufen ist, die Gesellschaft auf dieses Problem aufmerksam zu machen. Denn es wird ein gesamtgesellschaftliches Problem. Es ist kein Problem von einzelnen Familien mehr. Das ist es ohnehin.
Inge Jens: "Langsames Entschwinden. Vom Leben mit einem Demenzkranken"
Rowohlt Verlag, Berlin 2016. 160 Seiten, 14,95 Euro.
Rowohlt Verlag, Berlin 2016. 160 Seiten, 14,95 Euro.