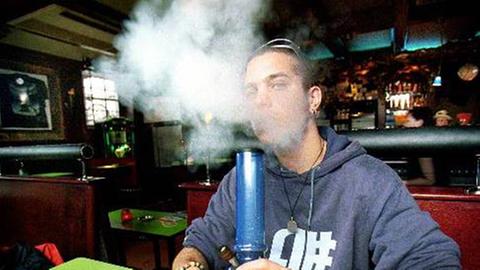Peter Kapern: Das ist Klasse, Rappen kann er auch noch, das Multitalent Hans-Christian Ströbele: Rechtsanwalt, Bundestagsabgeordneter der Grünen und 68er. Den Cannabiskonsum will er also legalisiert haben, und damit steht er im Bundestag nicht allein. Die Bundestagsfraktion der Linken kämpft auch für die Legalisierung weicher Drogen. Deshalb will sie in Deutschland unter anderem sogenannte Cannabis-Clubs zulassen. Das muss man sich als so eine Mischung aus urdeutschem Skatverein und Kifferhöhle vorstellen. Der schleswig-holsteinische Gesundheitsminister Garg von der FDP hat deshalb schon vorgeschlagen, Die Linke besser von der Drogenfahndung beobachten zu lassen als vom Verfassungsschutz. Heute gibt es jedenfalls in Sachen Legalisation eine Expertenanhörung im Bundestag, und zu der wird auch Rainer Thomasius anreisen. Er arbeitet als Psychiater am Zentrum für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters an der Uniklinik in Hamburg-Eppendorf. Ihn habe ich vor der Sendung gefragt, was er von den Legalisierungsplänen der Linken hält.
Rainer Thomasius: Ich halte wenig davon, Herr Kapern, aus drei wesentlichen Gründen, nämlich Cannabis kann vor allen Dingen bei regelmäßigem intensivem Gebrauch zu körperlichen, psychischen, sozialen Schäden führen. Zweitens ist in Deutschland mittlerweile unter jungen Menschen die größte Inanspruchnahme-Population im Suchthilfesystem die Gruppe der Cannabisabhängigen. Und drittens hat sich das Beispiel der Coffeeshops in den Niederlanden vor allen Dingen auf die Gruppe der Kinder und Jugendlichen sehr ungünstig ausgewirkt. Diese drei Gründe insgesamt lassen mich zu dem Schluss kommen, dass es gut ist, dass wir ein Betäubungsmittelgesetz in Deutschland haben, das vor den Gefahren von Drogenkonsum schützen will.
Kapern: Schauen wir doch noch mal auf die einzelnen Gründe, die Sie da gerade genannt haben.
Thomasius: Gerne.
Kapern: Fangen wir an mit der grassierenden Abhängigkeit, Cannabisabhängigkeit unter Jugendlichen. Wie sieht so eine Abhängigenkarriere eines Jugendlichen aus, der bei Ihnen landet, so eine typische Karriere?
Thomasius: Na ja, der typische Konsument steigt sehr früh in den Cannabisgebrauch ein, nämlich so mit 13, 14 Jahren, hat ein Jahr nach Konsumbeginn ein tägliches Gebrauchsmuster, kifft dann ein bis zwei Gramm Cannabis pro Tag und kann in der Schule die Leistungen nicht mehr erbringen, es gibt immer mehr Ärger natürlich zu Hause, der Freundeskreis wird vernachlässigt, die Hobbys, und möglicherweise beginnt zu diesem Zeitpunkt dann auch der Gebrauch anderer Drogen, nämlich Amphetamine, teilweise sogar Kokain, und es vergehen drei Jahre dieser Konsumkarriere, bis die Jugendlichen sich bei uns oder andernorts im Suchthilfesystem vorstellen und um Hilfe bitten. Noch nie in Deutschland war die behandelte Population der Patienten im Suchthilfesystem so jung, wie das heute der Fall ist, seitdem wir die Konsumenten mit cannabisbezogenen Problemen haben. Die sind so zwischen 20 und 25 Jahren in der Regel alt. Bisher waren wir in der Suchthilfe gewohnt, konfrontiert zu werden mit den 50- bis 60-jährigen Alkoholabhängigen, oder mit den 30- bis 40-jährigen Opiatabhängigen.
Kapern: Das ist ziemlich schrecklich, was Sie uns da schildern, Herr Thomasius, und trotzdem stellt sich die Frage, alles das kann das deutsche Drogenrecht nicht verhindern. Hat es dann nicht doch völlig versagt?
Thomasius: Na ja, nachweislich – und das sind ja nicht nur Erfahrungen aus dem klinischen Bereich – birgt Cannabisgebrauch ein gesundheitliches Risiko. Da sind vor allen Dingen die psychischen Störungen zu nennen, die Psychosen, die Entwicklungsstörungen in der Adoleszenz, die Motivationsstörungen, aber auch Steigerungen von Herzinfarktrisiko, Atemwegserkrankungen. Dieses alles zusammengenommen rechtfertigt doch die Schlussfolgerung, dass es sich um eine Substanz handelt, die nicht verkehrsfähig ist.
Kapern: Darf ich da mal eben eingreifen, Herr Thomasius. Das ist ja immer so eine Sache mit den Studien, die einem von Experten vorgehalten werden. Sie berufen sich da auf Erkenntnisse ihres Fachs und auf Erkenntnisse der Medizin. Die Befürworter der Legalisierung tun das auch. Die verweisen zum Beispiel auf eine Studie aus der Zeitschrift "The Lancet" im Jahr 2010, der zu entnehmen ist, dass Cannabis im Vergleich zu Nikotin und Alkohol geradezu harmlos ist.
Thomasius: Das ist die Studie aus den USA, von der Arbeitsgruppe um "NAD" entstanden. Die ist international nicht unkritisch reflektiert worden von der Wissenschaftlergemeinde, weil es doch Experten gibt, die das Suchtpotenzial von Cannabis höher einstufen würden als die Mitarbeiter um "NAD" herum. Natürlich: Im Vergleich zu Nikotin, im Vergleich zu den Opiaten hat Cannabis ein geringeres Suchtrisiko. Aber immerhin: Zehn Prozent aller Cannabiserfahrenen entwickeln eine Abhängigkeit. Und es sind insbesondere die früh einsteigenden Konsumenten, also die besonders jungen, die eine solche Abhängigkeit entwickeln, auch weil ihr Suchtgedächtnis, ihr zentrales Nervensystem viel affiner ist für eine Suchtentwicklung. Wir müssen Kinder und Jugendliche dringend schützen. Und die Coffeeshops in den Niederlanden zeigen uns, dass im europäischen Vergleich der Cannabiseinstieg in den Niederlanden besonders früh geschieht und auch der Cannabisgebrauch unter den Jugendlichen besonders intensiv ist, und hier scheint mir doch das Betäubungsmittelgesetz eine gesetzliche Hilfestellung zu sein.
Kapern: Aber nun soll ja die Liberalisierung, die da gefordert wird von etlichen Politikern, gerade nicht für Jugendliche gelten.
Thomasius: Ja, das hat man sich in den Niederlanden auch gesagt. Aber als das Cannabisproblem unter Jugendlichen dort exazerbierte – man hatte ja zunächst auch den 16- bis 18-Jährigen Zugang in die Coffeeshops gegeben -, hat man die Schwelle höher gelegt und nur noch den über 18-Jährigen Zutritt verschafft, was dann zu einem deutlichen Rückgang des Cannabisgebrauchs führte, was auch noch mal ein Beleg dafür ist, was so gesetzgeberische Vorgaben alles bewirken können. Gleichwohl: Wenn Sie niederländische Jugendliche befragen, wie gefährlich sie denn den Gebrauch von Cannabis halten, und das auch im europäischen Vergleich wieder darstellen, dann zeigt sich, die Jugendlichen in den Niederlanden finden Cannabisgebrauch völlig harmlos. Das heißt, das Gesetz tut auch etwas auf die Einstellung, auf die Meinung bei Jugendlichen.
Kapern: Ist es denn eigentlich richtig, Herr Thomasius, das Gefahrenpotenzial eines Stoffes – sei es Cannabis, sei es etwas anderes – immer nur an Risikogruppen zu messen? Ich darf mal ein Beispiel bringen, das vielleicht abwegig klingt. Dürfte man mir als Sportler eigentlich die Teilnahme an einem Marathonlauf verbieten, weil so ein Lauf für Herzkranke lebensgefährlich sein könnte? Wo würden wir da gesellschaftlich landen, wenn wir durchgehend so verfahren?
Thomasius: Wir haben aus Australien vorliegen sehr schöne Studien, die die Ausfälle an Arbeitsfähigkeit, die Kosten durch Krankenbehandlung summieren, und hier stellt sich dar, dass für Europa, aber auch für andere hoch industrialisierte Länder der Krankheitsschaden gewissermaßen zwölf Prozent an allen Ausfällen durch Erkrankungen ausmacht, für den Bereich Alkohol, für den Bereich Tabak in der gleichen Größenordnung, und der Bereich illegale Drogen imponiert hier mit ein bis zwei Prozent. Wenn Sie also auf die Relativität ansprechen, gebe ich Ihnen recht: Alkohol ist gefährlicher für die Gesamtbevölkerung gesehen, Tabakgebrauch ist gefährlicher, und aus streng medizinischer Sicht würden Alkohol und Tabak, Nikotin ins Betäubungsmittelgesetz gehören. Da hat sich die Gesellschaft anders entschieden, das Rad ist da auch nicht mehr zurückzudrehen. Aber möglicherweise und aus meiner Sicht mit voller Überzeugung wird das Betäubungsmittelgesetz dazu beitragen, dass wir eine dritte, epidemiologisch wirklich wichtige Problemsubstanz in Deutschland einführen.
Kapern: Rainer Thomasius war das, Psychiater am Zentrum für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters an der Universitätsklinik in Hamburg-Eppendorf. Herr Thomasius, ich bedanke mich vielmals für das Gespräch und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Thomasius: Ja! Danke gleichfalls.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandradio macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.
Rainer Thomasius: Ich halte wenig davon, Herr Kapern, aus drei wesentlichen Gründen, nämlich Cannabis kann vor allen Dingen bei regelmäßigem intensivem Gebrauch zu körperlichen, psychischen, sozialen Schäden führen. Zweitens ist in Deutschland mittlerweile unter jungen Menschen die größte Inanspruchnahme-Population im Suchthilfesystem die Gruppe der Cannabisabhängigen. Und drittens hat sich das Beispiel der Coffeeshops in den Niederlanden vor allen Dingen auf die Gruppe der Kinder und Jugendlichen sehr ungünstig ausgewirkt. Diese drei Gründe insgesamt lassen mich zu dem Schluss kommen, dass es gut ist, dass wir ein Betäubungsmittelgesetz in Deutschland haben, das vor den Gefahren von Drogenkonsum schützen will.
Kapern: Schauen wir doch noch mal auf die einzelnen Gründe, die Sie da gerade genannt haben.
Thomasius: Gerne.
Kapern: Fangen wir an mit der grassierenden Abhängigkeit, Cannabisabhängigkeit unter Jugendlichen. Wie sieht so eine Abhängigenkarriere eines Jugendlichen aus, der bei Ihnen landet, so eine typische Karriere?
Thomasius: Na ja, der typische Konsument steigt sehr früh in den Cannabisgebrauch ein, nämlich so mit 13, 14 Jahren, hat ein Jahr nach Konsumbeginn ein tägliches Gebrauchsmuster, kifft dann ein bis zwei Gramm Cannabis pro Tag und kann in der Schule die Leistungen nicht mehr erbringen, es gibt immer mehr Ärger natürlich zu Hause, der Freundeskreis wird vernachlässigt, die Hobbys, und möglicherweise beginnt zu diesem Zeitpunkt dann auch der Gebrauch anderer Drogen, nämlich Amphetamine, teilweise sogar Kokain, und es vergehen drei Jahre dieser Konsumkarriere, bis die Jugendlichen sich bei uns oder andernorts im Suchthilfesystem vorstellen und um Hilfe bitten. Noch nie in Deutschland war die behandelte Population der Patienten im Suchthilfesystem so jung, wie das heute der Fall ist, seitdem wir die Konsumenten mit cannabisbezogenen Problemen haben. Die sind so zwischen 20 und 25 Jahren in der Regel alt. Bisher waren wir in der Suchthilfe gewohnt, konfrontiert zu werden mit den 50- bis 60-jährigen Alkoholabhängigen, oder mit den 30- bis 40-jährigen Opiatabhängigen.
Kapern: Das ist ziemlich schrecklich, was Sie uns da schildern, Herr Thomasius, und trotzdem stellt sich die Frage, alles das kann das deutsche Drogenrecht nicht verhindern. Hat es dann nicht doch völlig versagt?
Thomasius: Na ja, nachweislich – und das sind ja nicht nur Erfahrungen aus dem klinischen Bereich – birgt Cannabisgebrauch ein gesundheitliches Risiko. Da sind vor allen Dingen die psychischen Störungen zu nennen, die Psychosen, die Entwicklungsstörungen in der Adoleszenz, die Motivationsstörungen, aber auch Steigerungen von Herzinfarktrisiko, Atemwegserkrankungen. Dieses alles zusammengenommen rechtfertigt doch die Schlussfolgerung, dass es sich um eine Substanz handelt, die nicht verkehrsfähig ist.
Kapern: Darf ich da mal eben eingreifen, Herr Thomasius. Das ist ja immer so eine Sache mit den Studien, die einem von Experten vorgehalten werden. Sie berufen sich da auf Erkenntnisse ihres Fachs und auf Erkenntnisse der Medizin. Die Befürworter der Legalisierung tun das auch. Die verweisen zum Beispiel auf eine Studie aus der Zeitschrift "The Lancet" im Jahr 2010, der zu entnehmen ist, dass Cannabis im Vergleich zu Nikotin und Alkohol geradezu harmlos ist.
Thomasius: Das ist die Studie aus den USA, von der Arbeitsgruppe um "NAD" entstanden. Die ist international nicht unkritisch reflektiert worden von der Wissenschaftlergemeinde, weil es doch Experten gibt, die das Suchtpotenzial von Cannabis höher einstufen würden als die Mitarbeiter um "NAD" herum. Natürlich: Im Vergleich zu Nikotin, im Vergleich zu den Opiaten hat Cannabis ein geringeres Suchtrisiko. Aber immerhin: Zehn Prozent aller Cannabiserfahrenen entwickeln eine Abhängigkeit. Und es sind insbesondere die früh einsteigenden Konsumenten, also die besonders jungen, die eine solche Abhängigkeit entwickeln, auch weil ihr Suchtgedächtnis, ihr zentrales Nervensystem viel affiner ist für eine Suchtentwicklung. Wir müssen Kinder und Jugendliche dringend schützen. Und die Coffeeshops in den Niederlanden zeigen uns, dass im europäischen Vergleich der Cannabiseinstieg in den Niederlanden besonders früh geschieht und auch der Cannabisgebrauch unter den Jugendlichen besonders intensiv ist, und hier scheint mir doch das Betäubungsmittelgesetz eine gesetzliche Hilfestellung zu sein.
Kapern: Aber nun soll ja die Liberalisierung, die da gefordert wird von etlichen Politikern, gerade nicht für Jugendliche gelten.
Thomasius: Ja, das hat man sich in den Niederlanden auch gesagt. Aber als das Cannabisproblem unter Jugendlichen dort exazerbierte – man hatte ja zunächst auch den 16- bis 18-Jährigen Zugang in die Coffeeshops gegeben -, hat man die Schwelle höher gelegt und nur noch den über 18-Jährigen Zutritt verschafft, was dann zu einem deutlichen Rückgang des Cannabisgebrauchs führte, was auch noch mal ein Beleg dafür ist, was so gesetzgeberische Vorgaben alles bewirken können. Gleichwohl: Wenn Sie niederländische Jugendliche befragen, wie gefährlich sie denn den Gebrauch von Cannabis halten, und das auch im europäischen Vergleich wieder darstellen, dann zeigt sich, die Jugendlichen in den Niederlanden finden Cannabisgebrauch völlig harmlos. Das heißt, das Gesetz tut auch etwas auf die Einstellung, auf die Meinung bei Jugendlichen.
Kapern: Ist es denn eigentlich richtig, Herr Thomasius, das Gefahrenpotenzial eines Stoffes – sei es Cannabis, sei es etwas anderes – immer nur an Risikogruppen zu messen? Ich darf mal ein Beispiel bringen, das vielleicht abwegig klingt. Dürfte man mir als Sportler eigentlich die Teilnahme an einem Marathonlauf verbieten, weil so ein Lauf für Herzkranke lebensgefährlich sein könnte? Wo würden wir da gesellschaftlich landen, wenn wir durchgehend so verfahren?
Thomasius: Wir haben aus Australien vorliegen sehr schöne Studien, die die Ausfälle an Arbeitsfähigkeit, die Kosten durch Krankenbehandlung summieren, und hier stellt sich dar, dass für Europa, aber auch für andere hoch industrialisierte Länder der Krankheitsschaden gewissermaßen zwölf Prozent an allen Ausfällen durch Erkrankungen ausmacht, für den Bereich Alkohol, für den Bereich Tabak in der gleichen Größenordnung, und der Bereich illegale Drogen imponiert hier mit ein bis zwei Prozent. Wenn Sie also auf die Relativität ansprechen, gebe ich Ihnen recht: Alkohol ist gefährlicher für die Gesamtbevölkerung gesehen, Tabakgebrauch ist gefährlicher, und aus streng medizinischer Sicht würden Alkohol und Tabak, Nikotin ins Betäubungsmittelgesetz gehören. Da hat sich die Gesellschaft anders entschieden, das Rad ist da auch nicht mehr zurückzudrehen. Aber möglicherweise und aus meiner Sicht mit voller Überzeugung wird das Betäubungsmittelgesetz dazu beitragen, dass wir eine dritte, epidemiologisch wirklich wichtige Problemsubstanz in Deutschland einführen.
Kapern: Rainer Thomasius war das, Psychiater am Zentrum für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters an der Universitätsklinik in Hamburg-Eppendorf. Herr Thomasius, ich bedanke mich vielmals für das Gespräch und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Thomasius: Ja! Danke gleichfalls.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandradio macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.