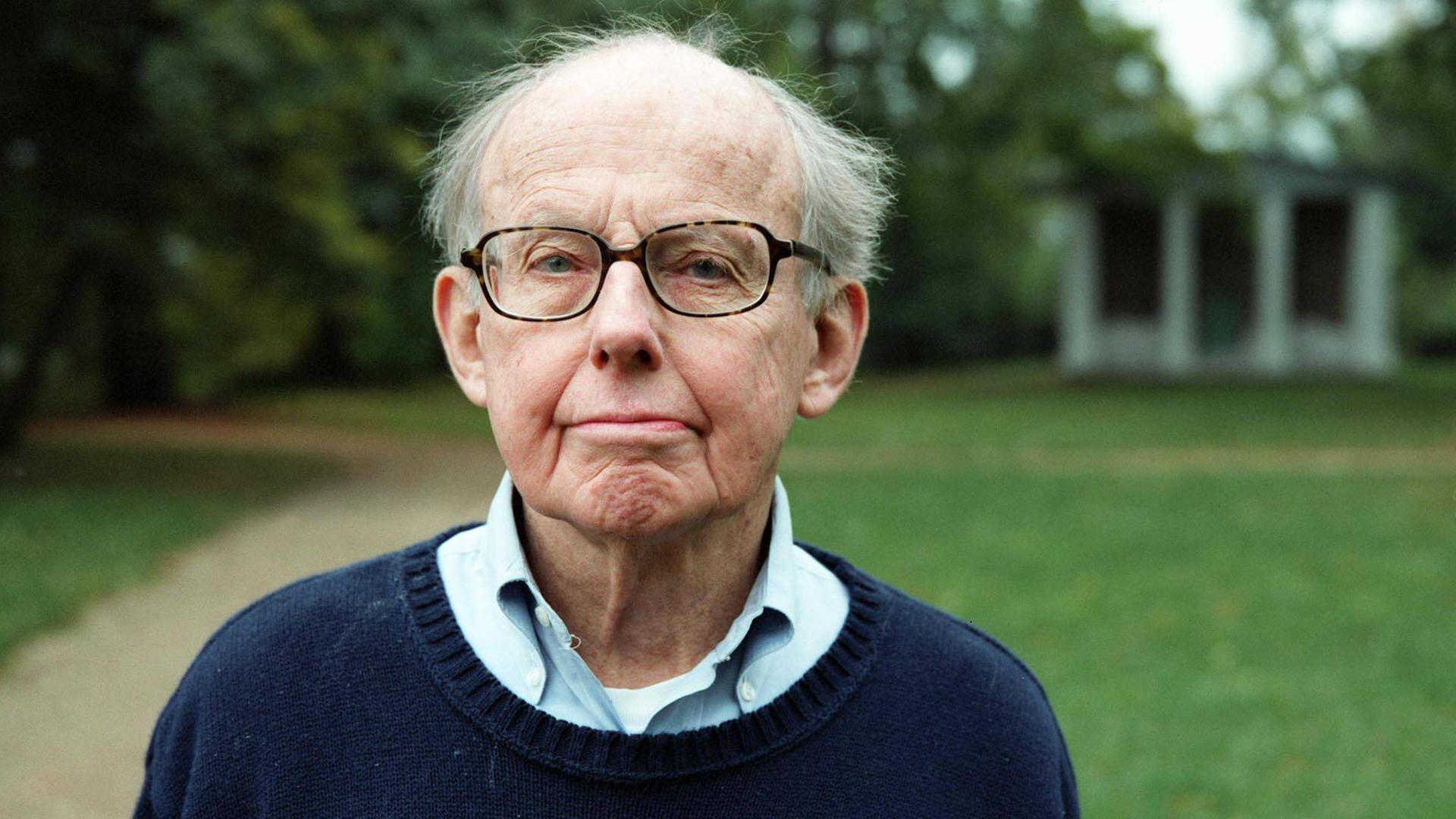1993 veröffentlichte der amerikanische Politikwissenschaftler Samuel Huntington einen Aufsatz mit dem Titel "The Clash of Civilizations?" – Kampf der Kulturen? – mit einem Fragezeichen. Geboren war eine neue, von den Medien rasch aufgegriffene Hypothese über das Weltgeschehen und die Gesetze der Geschichte. Drei Jahre später, 1996, entwickelte Huntington seine Ideen vom Kampf der Kulturen in einem gleichnamigen Buch weiter, diesmal ohne Fragezeichen.
Eine solche Universaltheorie, die gleichsam von oben herab auf Welt und Geschichte blickt, ist nichtsdestotrotz von ihrer Entstehungszeit geprägt. Huntington, so der Politikwissenschaftler Peter Nitschke, habe mit seiner Theorie auf einen ganz bestimmten intellektuellen Gegner reagiert:
"Intellektuell auf Francis Fukuyama mit seiner berühmt-berüchtigten These, dass der Westen, das marktwirtschaftliche System, die Freiheit, die Demokratie keine wirklichen Gegner mehr hat nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes und dem Niedergang der Sowjetunion - dass damit das Ende der Geschichte erreicht sei. Und da setzt er demgegenüber einen ganz anderen Interpretationsansatz, dass die Geschichte viel länger dauert und von grundsätzlichen Konflikten geprägt sei. Das hat er eben auf diese Formel gebracht: The Clash of Civilizations, was im Deutschen mit dieser berühmt-berüchtigten Kampfformel vielleicht etwas verzerrend wiedergegeben worden ist."
Ein Paradigmenwechsel
Dem realpolitischen Ende des Kalten Krieges folgte auch ein theoretischer Paradigmenwechsel, der wesentlich mit dem Namen Samuel Huntington verbunden ist. Nicht politisch-ideologisch begriffene Gegensätze wie Kapitalismus gegen Kommunismus, Demokratie gegen Parteidiktatur, sondern Unterschiede kultureller und im Kern religiöser Art seien entscheidend, wenn man das Weltgeschehen und seine Konflikte begreifen will, erklärte Huntington.
Zu diesem Paradigmenwechsel motivierten Huntington eine ganze Reihe zeitgeschichtlicher Ereignisse, erläutert Peter Nitschke von der Universität Vechta:
Zu diesem Paradigmenwechsel motivierten Huntington eine ganze Reihe zeitgeschichtlicher Ereignisse, erläutert Peter Nitschke von der Universität Vechta:
"Einer der Fakten, die ihn unmittelbar berührt haben, war zum Beispiel die Erstürmung der Moschee in Ayodhya 1992, das schreibt er auch, wo radikale Hindufanatiker eine muslimische Moschee gestürmt und letztlich niedergebrannt haben. Die Frage für Huntington war, und das ist natürlich die Frage für jeden Wissenschaftler: Weshalb passierte das? Das war mit einem marxistischen Materialismus nicht zu erklären, das hat auch nichts mit der Säkularisierung zu tun, sondern mit ganz anderen Interpretamenten."
Solche Interpretamente, also begriffliche Deutungsmittel findet Huntington, indem er große Kulturkreise definiert: den Westen, die islamische Welt, China, Japan und vier weitere Kulturkreise, die im Kern unveränderlich seien und ebenso unversöhnlich gegeneinanderstünden. An den Bruchlinien dieser großen Kulturkreise käme es notwendig immer zu Konflikten und Kriegen.
Kritik am Konzept "Kulturkreis"
Viele Wissenschaftler haben Huntington vorgeworfen, dass er Kulturkreise in ungeschichtlicher Weise festschreibt. Zum Beispiel der Historiker Hans-Heinrich Nolte, ein Osteuropa-Kenner, der lange in Russland gelebt und gelehrt hat. Nolte plädiert dafür, statt von Weltkulturkreisen von Weltregionen zu sprechen:
"Ich denke, dass der Begriff Weltregionen mobiler ist, man kann mehrere Konzepte darunter fassen, man kann ihn besser verändern und man kann besser auf die Bedeutung von Politik eingehen. Wenn man mal ein Beispiel nehmen will: Die Rumänen werden von Huntington zur orthodoxen Welt gerechnet, die rumänische Elite hat aber selbst entschieden: Nein, aufgrund der Romanità - wir sprechen eine romanische Sprache - gehören wir zur mediterranen Welt, und sie haben sich dann entsprechend entschlossen und haben zum Beispiel die kyrillische Schrift abgeschafft und sind ins Lateinische gegangen. Solche Veränderungen kann man besser mit einem weniger belasteten und mobileren Begriff fassen als mit Kulturkreis."
Huntington hat zwar unstrittig erkannt, dass in einer Zeit der Globalisierung Menschen verstärkt ihre Identität im Rückbezug auf Religion, Herkunft, Sprache und Traditionen suchen und sichern wollen. Aber die Weise, wie er Identitätsbildung bestimmt, ist problematisch. Huntington schreibt: "Wir wissen, wer wir sind, wenn wir wissen, wer wir nicht sind." Aber stimmt das denn? Braucht man tatsächlich die scharfe Abgrenzung vom Anderen, um die eigene Identität, um sich selber zu finden? Dazu Barbara Zehnpfennig, sie lehrt Politikwissenschaft an der Universität Passau:
"Identitätsbildung und Identitätsfindung ist natürlich einfacher, wenn sie negativ geschieht; denn das ist auch im individuellen Bereich so. Das, was man ist, das ist schwer festzustellen, denn es muss erst einmal gefunden und hergestellt werden. Und insofern bietet es sich an, erst mal darüber nachzudenken, was man nicht ist, was man nicht sein will. Insofern ist es menschlich verständlich, so vorzugehen, aber es ist sicherlich die zweitbeste Lösung."
Positive Identitätsbildung
Die drittbeste, das heißt schlechteste Lösung sei ihrer Ansicht nach, wenn man diesen Anderen von vornherein als Gegner betrachtet, wie Huntingtons Ansatz es tut. Barbara Zehnpfennig betont demgegenüber, dass es auch den Typus einer positiven Identitätsbildung gibt, zum Beispiel bei der Geschichte der USA:
"Ich glaube, die Kulturen, die aus sich heraus etwas Großes geschaffen haben, brauchten das nicht unbedingt: Erst einmal einen Feind zu definieren, von dem her sie sich selbst verstanden haben, sondern wenn man zum Beispiel die amerikanische Gründungsleistung betrachtet, die in der Etablierung einer Demokratie in einem Großflächenstaat bestand, die haben eigentlich diese positive Leistung als identitätsstiftenden Faktor gefunden, also es gibt auch Gegenbeispiele zu einer solchen negativen Abgrenzung, und das ist sicherlich vorbildlich. Aber es ist das Schwierigere."
Die Attentate des 11. September schienen Huntingtons Theorie zu bestätigen. Die These vom "Kampf der Kulturen" wurde zum Schlagwort. Doch je populärer eine Theorie wird, desto ärmer wird sie, desto verkürzter gerät ihr Inhalt. Bald assoziierte man bei Huntingtons Zivilisationstheorie nur noch den Gegensatz zwischen dem Westen und dem Islam. Dabei hatte er auch vor dem Aufstieg Chinas gewarnt.
Fundamentalisten gegen Fundamentalisten
Der Philosophieprofessor Gregor Paul, er hat lange in China und Japan gelebt, widerspricht Huntingtons Annahme einer grundsätzlichen Konfrontation der Kulturen, nicht nur im Falle Chinas:
"Meines Erachtens ist seine These nur so weit begründet, als es um den Zusammenprall, den Krieg zwischen fundamentalistischen Strömungen geht. Also ich sehe in Huntingtons These eine empirisch völlig unhaltbare und auch irreführende Verallgemeinerung des Jahrtausende alten und in vielen Kulturen nachweisbaren Sachverhalts, dass sich Fundamentalismen oft in kriegerischen Auseinandersetzungen begegnen und dass das im Besonderen für religiöse Fundamentalismen gilt."
Nicht die Kulturen ständen quasi naturgemäß in einem gegnerischen Verhältnis, sondern nur die Hardliner der jeweiligen Kulturen, seien sie nun religiös-fanatisch oder nationalistisch. Das Verhältnis zwischen Kulturen ist durchaus offen, wie die Geschichte zeigt. Es gab Phasen, wo aggressives Gegeneinander regiert, aber auch Perioden eines friedlichen Nebeneinanders oder einer fruchtbaren Durchmischung. Wie zum Beispiel im multikulturellen Andalusien des Mittelalters, wo Christen, Muslime und Juden gemeinsam für eine Blütezeit in Philosophie, Medizin und Architektur, in Handel und Handwerk sorgten.
Solche lebendigen Austauschprozesse zwischen Kulturen sind gerade für die gegenwärtige Welt besonders wichtig. Viele Wissenschaftler richten darauf ihr Erkenntnisinteresse, während Huntington auf Unterschieden und Abgrenzungen beharrt.
"Wir würden heute viel stärker die Transfers herausstellen zwischen den verschiedenen Kulturen, wir würden die Migrationen zwischen den Kulturen herausstellen, wo Leute von der einen in die andere Kultur gehen, die wirtschaftlichen Beziehungen über solche Grenzbereiche hinweg, diese Betonung der Grenzen als Bruchlinien, die stimmt mit unserer Ansicht von Geschichte nur selten überein, es kommt mal vor, aber es ist nicht die Regel."
Eine Theorie für den Komposthaufen?
Die Teilnehmer der Tagung waren sich weitgehend einig, dass Huntingtons Paradigmenwechsel - weg vom Primat der Ideologie und Ökonomie hin zu Kultur und Religion - große Bedeutung hat. Seine konservative Festschreibung von Kulturkreisen teilte jedoch kaum jemand. Folgt daraus, dass Huntington schon überholt ist und seine Theorie auf den Komposthaufen der Geschichte gehört? So einfach sei das nicht, meint Peter Nitschke:
"Wir sind zwar rechnerisch 20 Jahre weiter, aber die Effekte, die er 1993 und 1996 beschrieben oder prognostiziert hat, die haben sich ja zum Teil in ihrer fundamentalen Wirkung erst im ersten Jahrzehnt eingespielt, und weitere werden noch folgen. Entweder droht, was Huntington gar nicht meinte, ein großer nuklearer Gau, so ein Riesenmassaker, ein Genozid, oder aber eine sachliche Verständigung darauf, wer wir sind und wie wir in einer gemeinsamen Welt zusammenleben wollen und können."