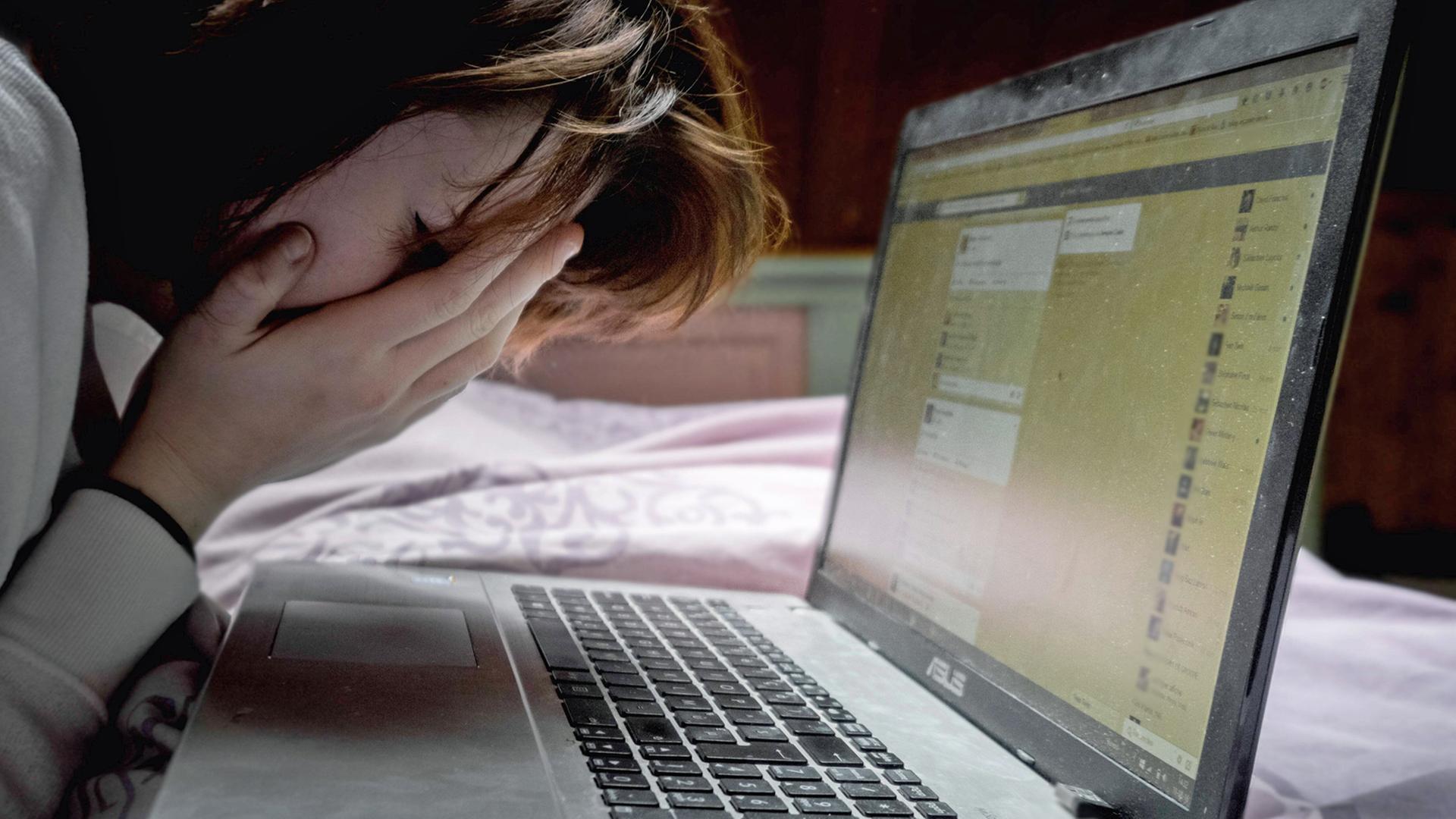"Ein Leben mit absoluter Sicherheit – ohne jedes Risiko - ist eine Fantasie ... lebendig zu sein bedeutet Risiko." So die französische Risikoforscherin und Philosophin Anne Dufourmantelle, die im letzten Sommer zwei Kinder vor dem Ertrinken gerettet hat - und dabei tragischerweise selbst zu Tode gekommen ist.
Doktor Thorsten Pachur vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin stellte dieses Zitat an den Anfang seines Vortrages über Risikoentscheidungen - und wie diese sich im Laufe des Lebens verändern. "No risk, no fun" – dieses Motto scheint eine Altersfrage zu sein – teilweise mit dramatischen Folgen.
"Wo sehr risikobereites Verhalten gezeigt wird, ist bei Teenagern, beispielsweise zwischen 16 und 20 findet man eine sehr starke Ausprägung von risikobereiten Verhalten, was leider Gottes auch sehr viele tragische Konsequenzen hat. Beispielsweise steigt da die Anzahl von bei Unfällen getöteten Menschen sehr stark an in diesem Altersbereich."
Doktor Thorsten Pachur vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin stellte dieses Zitat an den Anfang seines Vortrages über Risikoentscheidungen - und wie diese sich im Laufe des Lebens verändern. "No risk, no fun" – dieses Motto scheint eine Altersfrage zu sein – teilweise mit dramatischen Folgen.
"Wo sehr risikobereites Verhalten gezeigt wird, ist bei Teenagern, beispielsweise zwischen 16 und 20 findet man eine sehr starke Ausprägung von risikobereiten Verhalten, was leider Gottes auch sehr viele tragische Konsequenzen hat. Beispielsweise steigt da die Anzahl von bei Unfällen getöteten Menschen sehr stark an in diesem Altersbereich."
Angst als bester Freund
Das Ausüben von risikoreicheren Sportarten, aber auch Mutproben unter Jugendlichen spielen in diesem Zusammenhang eine Rolle.
"Und was man da findet, ist, dass insbesondere bei Teenagern die Präsenz von anderen dazu führt, dass die Risikobereitschaft steigt. Was darauf hindeutet, dass Risikobereitschaft bei dieser Personengruppe auch so eine Signalfunktion hat und möglicherweise auch verwendet wird, um den sozialen Status zu erhöhen."

Extremsportler haben kein ungesundes Verhältnis zur Angst
Immer wieder war auf der Tagung die Rede von sogenannter "sensation seeker", von Menschen, die neuartige, abwechslungsreiche und intensive Erlebnisse aufsuchen. Das sind zum Beispiel Extremsportler, die den Nervenkitzel brauchen. Einige sagen sogar, "die Angst ist mein bester Freund", wie Dr. Marie Ottilie Frenkel vom Institut für Sportwissenschaft an der Uni Heidelberg einen Speedskifahrer zitierte. Sie coacht Extremsportler und hat festgestellt, dass diese kein ungesundes Verhältnis zur Angst haben, das sei ein Mythos. Vielmehr würden sie ihre Angst zulassen, könnten sie regulieren und verfügten gleichzeitig über ein hohes Maß an Selbstkontrolle. Um das zu erreichen, kann zum Beispiel autogenes Training helfen.
Und mit noch einem Mythos wurde auf der Tagung aufgeräumt: Dass, je älter wir werden, wir umso mehr das Risiko scheuen. Das stimme nur bedingt, so Thorsten Pachur. In Laborstudien hat er mit seinem Team die Risikobereitschaft anhand monetärer Lotterieaufgaben gemessen:
"Wir haben in unserer Forschung eben zeigen können, dass die Risikobereitschaft von älteren Personen sehr stark davon abhängt, wie kognitiv aufwendig und komplex die Aufgabe ist. Und dass es durchaus Situationen gibt, die nicht so selten sind, wo ältere Erwachsene entgegen diesem Stereotyp risikofreudiger sind als jüngere Versuchspersonen."
Und mit noch einem Mythos wurde auf der Tagung aufgeräumt: Dass, je älter wir werden, wir umso mehr das Risiko scheuen. Das stimme nur bedingt, so Thorsten Pachur. In Laborstudien hat er mit seinem Team die Risikobereitschaft anhand monetärer Lotterieaufgaben gemessen:
"Wir haben in unserer Forschung eben zeigen können, dass die Risikobereitschaft von älteren Personen sehr stark davon abhängt, wie kognitiv aufwendig und komplex die Aufgabe ist. Und dass es durchaus Situationen gibt, die nicht so selten sind, wo ältere Erwachsene entgegen diesem Stereotyp risikofreudiger sind als jüngere Versuchspersonen."
Angsterkrankungen nehmen im Alter ab
Die Probanden mussten sich entscheiden, ob sie sich bei einem Glücksspiel für einen sicheren Geldbetrag mit einer hundertprozentigen Gewinnwahrscheinlichkeit entscheiden oder mit mehr Risiko die Aussicht auf eine höhere Summe wählen. In einer weiteren Versuchsanordnung hatten die Teilnehmer die Qual der Wahl zwischen zwei risikoreichen Varianten:
"Wir finden, dass in der Situation mit zwei risikoreichen Optionen, dass in dieser Situation die älteren Versuchspersonen risikobereiter sind als die jüngeren Versuchspersonen. Das dreht sich allerdings um, wenn eine der beiden Optionen eine sichere Option ist, Hier gehen die älteren Versuchspersonen eher auf die sichere Option. Wir haben verschiedene Experimente durchgeführt, die darauf hinweisen, dass diese Präferenz von älteren Erwachsenen für diese sichere Option nichts mit ihrer Risikobereitschaft zu tun hat, sondern vor allem damit, dass man diese sichere Option sehr leicht analysieren kann. Wenn man keine sichere Entscheidungsalternative hat, dann findet man, dass die älteren Erwachsenen risikobereiter sind."
"Wir finden, dass in der Situation mit zwei risikoreichen Optionen, dass in dieser Situation die älteren Versuchspersonen risikobereiter sind als die jüngeren Versuchspersonen. Das dreht sich allerdings um, wenn eine der beiden Optionen eine sichere Option ist, Hier gehen die älteren Versuchspersonen eher auf die sichere Option. Wir haben verschiedene Experimente durchgeführt, die darauf hinweisen, dass diese Präferenz von älteren Erwachsenen für diese sichere Option nichts mit ihrer Risikobereitschaft zu tun hat, sondern vor allem damit, dass man diese sichere Option sehr leicht analysieren kann. Wenn man keine sichere Entscheidungsalternative hat, dann findet man, dass die älteren Erwachsenen risikobereiter sind."
Höhere Lebenszufriedenheit bei Menschen über 60
Und die in diesem Fall höhere Risikobereitschaft bei Menschen über 60 Jahren hängt mit ihrer höheren Lebenszufriedenheit zusammen, so Pachur. Menschen im mittleren Erwachsenenalter haben oft mehr Stress und Angst aufgrund höherer Verantwortung in Beruf und Familie, was sich auf ihre Risikobereitschaft auswirkt. Mit zunehmendem Alter werden wir weniger ängstlich, mit dieser beruhigenden Aussicht wartete auch Borwin Bandelow auf, Professor für Psychiatrie und Psychotherapie an der Uni Göttingen:
"Sowieso ist es so, dass Angsterkrankungen mit dem Alter abnehmen. Zum Beispiel die Panikstörung ist am schlimmsten mit 39 Jahren und danach wird alles nur besser, statistisch gesehen. Da haben die Menschen Angst, in Fußgängerzonen plötzlich Panikattacken zu bekommen, oder sie kriegen die auch aus heiterem Himmel. Bei den Panikattacken hat man Herzrasen, Zittern, Schwitzen, Schwindel, Luftnot, und denkt, dass man sterben könnte daran, dass das Herz stehen bleiben könnte oder dass man einen Gehirnschlag kriegt.

Und diese Leute sind massiv durch die Panikattacken beeinträchtigt, haben bis zu mehrere am Tag und fangen dann auch an; bestimmte Situationen zu vermeiden."
Die Konfrontation mit der Angst
Oft sind es gar keine konkreten Erfahrungen mit großen Menschenansammlungen oder steckengebliebenen Fahrstühlen, die eine Panikattacke auslösen, sondern Angsterkrankungen sind auch genetisch bedingt, so Bandelow. Schließlich verdanken wir unseren Vorfahren, die zum Beispiel rechtzeitig vor dem Säbelzahntiger geflohen sind, unsere Existenz. Doch was hilft bei Panikattacken, von denen übrigens mehr Frauen als Männer betroffen sind?
"Wenn man das behandeln will, dann muss man einerseits die Panikattacken behandeln und andererseits das Vermeidungsverhalten. und dazu ist die Verhaltenstherapie geeignet: Man macht in einer Verhaltenstherapie Konfrontation, das heißt die Patienten werden genau in diese Situation gebracht, sie müssen dann zum Beispiel Bus fahren oder sie müssen in ein Fußballstadion gehen und eben lernen, diese Angst auszuhalten. Besser ist es, wenn der Therapeut dabei ist und das überwacht."
Sprich, wenn er die Klienten anfänglich in der für sie kritischen Situation zumindest teilweise begleitet.

Neben Panikattacken sind auch Phobien stark verbreitet, nicht nur solche gegen Spinnen oder andere Tiere. Von sozialen Phobien sind Frauen wie Männer gleichermaßen betroffen, das heißt, sie scheuen den Kontakt zu anderen Menschen, haben Angst, im Mittelpunkt zu stehen, fühlen sich ständig kritisch beäugt und vermeiden Prüfungssituationen. Besonders die Verhaltenstherapie scheint bei vielen Angsterkrankungen zu wirken, so Borwin Bandelow. Er hat auch an den Deutschen Leitlinien zur Behandlung von Angststörungen mitgewirkt und sechs Jahre lang weltweit sämtliche Angst-Studien ausgewertet sowie zwei Meta-Analysen zu Angsterkrankungen veröffentlicht. Das Ergebnis:
"Da muss man eben auch sagen, dass rauskam, dass Medikamente eben deutlich stärker wirken als eine Psychotherapie, was eigentlich bis dahin nicht so bekannt war, weil man eben diese Therapiemethoden bisher nicht mathematisch gut verglichen hat. Und jetzt muss man eigentlich sagen, dass man mit einer Psychotherapie nur 60% erreichen kann von der Wirkung eines durchschnittlichen Medikaments. Es gibt sog. Antidepressiva, die vorwiegend genommen werden, die auch nicht so extreme Nebenwirken machen, wie viele Leute befürchten.
"Da muss man eben auch sagen, dass rauskam, dass Medikamente eben deutlich stärker wirken als eine Psychotherapie, was eigentlich bis dahin nicht so bekannt war, weil man eben diese Therapiemethoden bisher nicht mathematisch gut verglichen hat. Und jetzt muss man eigentlich sagen, dass man mit einer Psychotherapie nur 60% erreichen kann von der Wirkung eines durchschnittlichen Medikaments. Es gibt sog. Antidepressiva, die vorwiegend genommen werden, die auch nicht so extreme Nebenwirken machen, wie viele Leute befürchten.
Insgesamt kann man Angsterkrankungen sehr gut behandeln, ich würde sagen wir haben sicher eine Erfolgsrate von 85%, wo wir es ganz wegkriegen können."
Angst und Stress wirken auf das Gedächtnis
Wie Angst und Stress auf das Gedächtnis wirken hat der Bielefelder Neuropsychologe Prof. Hans-Joachim Markowitsch erforscht. Er behandelt unter anderem Patienten, die plötzlich nicht mehr wissen, wer sie sind oder die sich an Monate oder Jahre ihres Lebens nicht erinnern.
"Wir finden das insbesondere dann, wenn Angst und Stresszustände schon im frühen Leben auftreten, das episodisch-autobiografische Gedächtnis zunehmend anfällig wird und möglicherweise dann, wenn im Erwachsenenleben weitere Stresserlebnisse hinzukommen, blockiert, man nicht mehr an die Vergangenheit, die eigenen Erinnerungen herankommen kann."
Diese Blockaden bilden sich auch im Hirn ab. Besonders in den für das Gedächtnis wichtigen Regionen, die für die Verbindung von Kognition und Emotion wichtig sind, zeigen sich Veränderungen. Die Zahl der Betroffenen hat in den letzten Jahren zugenommen, so Markowitsch,
"Wir finden das insbesondere dann, wenn Angst und Stresszustände schon im frühen Leben auftreten, das episodisch-autobiografische Gedächtnis zunehmend anfällig wird und möglicherweise dann, wenn im Erwachsenenleben weitere Stresserlebnisse hinzukommen, blockiert, man nicht mehr an die Vergangenheit, die eigenen Erinnerungen herankommen kann."
Diese Blockaden bilden sich auch im Hirn ab. Besonders in den für das Gedächtnis wichtigen Regionen, die für die Verbindung von Kognition und Emotion wichtig sind, zeigen sich Veränderungen. Die Zahl der Betroffenen hat in den letzten Jahren zugenommen, so Markowitsch,
"Wir haben Beispiele, wo Erwachsene wieder einer Feuersituation ausgesetzt waren, diese unbewusst schon in der Kindheit miterleben mussten oder dass gerade Waisenkinder eine problematische Jugend hatten, bis hin zu physischem und sexuellem Missbrauch und dass dann, wenn im Erwachsenenalter Ähnliches passiert, es dann zu einem Ausblenden der Vergangenheit kommt."
Hier sind oft längere Therapien erforderlich, wo nach einer Persönlichkeitsstabilisierung schrittweise versucht wird, die Erinnerungen wiederzubeleben.
Hier sind oft längere Therapien erforderlich, wo nach einer Persönlichkeitsstabilisierung schrittweise versucht wird, die Erinnerungen wiederzubeleben.
Mehr Angst vor neuen als vor bekannten Gefahren
Eins hat das Fürther Symposium eindrücklich gezeigt: Dass wir auf unsere immer komplexer werdende Welt und dem hohen Entscheidungsdruck, dem wir ausgesetzt sind, immer häufiger mit Angst reagieren. Auch wenn diese Ängste mit den tatsächlichen Gefahren oft wenig zu tun haben, wie der Göttinger Angstforscher Borwin Bandelow betonte:
"Das liegt daran, dass unser Angstsystem nicht so statistisch denken kann. Durch Kugelschreiber sterben 300 Menschen jedes Jahr in Deutschland, das ist deutlich mehr als durch Terroranschläge. Das sind Kinder oder ältere Menschen, die Kugelschreiber verschlucken. Wenn eine neue Gefahr kommt, wie zum Beispiel ein neues Virus oder Terroranschläge, oder jetzt haben wir Messerattacken, dann hat man davor mehr Angst als vor den bekannten Gefahren, wie zum Beispiel Autounfälle oder Reitunfälle. Wir haben ja 9.000 Tote jedes Jahr durch Freizeitunfälle oder auch 9.000 Tote jedes Jahr durch Haushaltsunfälle. Aber wenn eine neue Gefahr kommt, die vielleicht fünf Tote verursacht wie ein neues Virus, dann hat die ganze Nation Angst, dass wir davon befallen sein könnten.
"Das liegt daran, dass unser Angstsystem nicht so statistisch denken kann. Durch Kugelschreiber sterben 300 Menschen jedes Jahr in Deutschland, das ist deutlich mehr als durch Terroranschläge. Das sind Kinder oder ältere Menschen, die Kugelschreiber verschlucken. Wenn eine neue Gefahr kommt, wie zum Beispiel ein neues Virus oder Terroranschläge, oder jetzt haben wir Messerattacken, dann hat man davor mehr Angst als vor den bekannten Gefahren, wie zum Beispiel Autounfälle oder Reitunfälle. Wir haben ja 9.000 Tote jedes Jahr durch Freizeitunfälle oder auch 9.000 Tote jedes Jahr durch Haushaltsunfälle. Aber wenn eine neue Gefahr kommt, die vielleicht fünf Tote verursacht wie ein neues Virus, dann hat die ganze Nation Angst, dass wir davon befallen sein könnten.