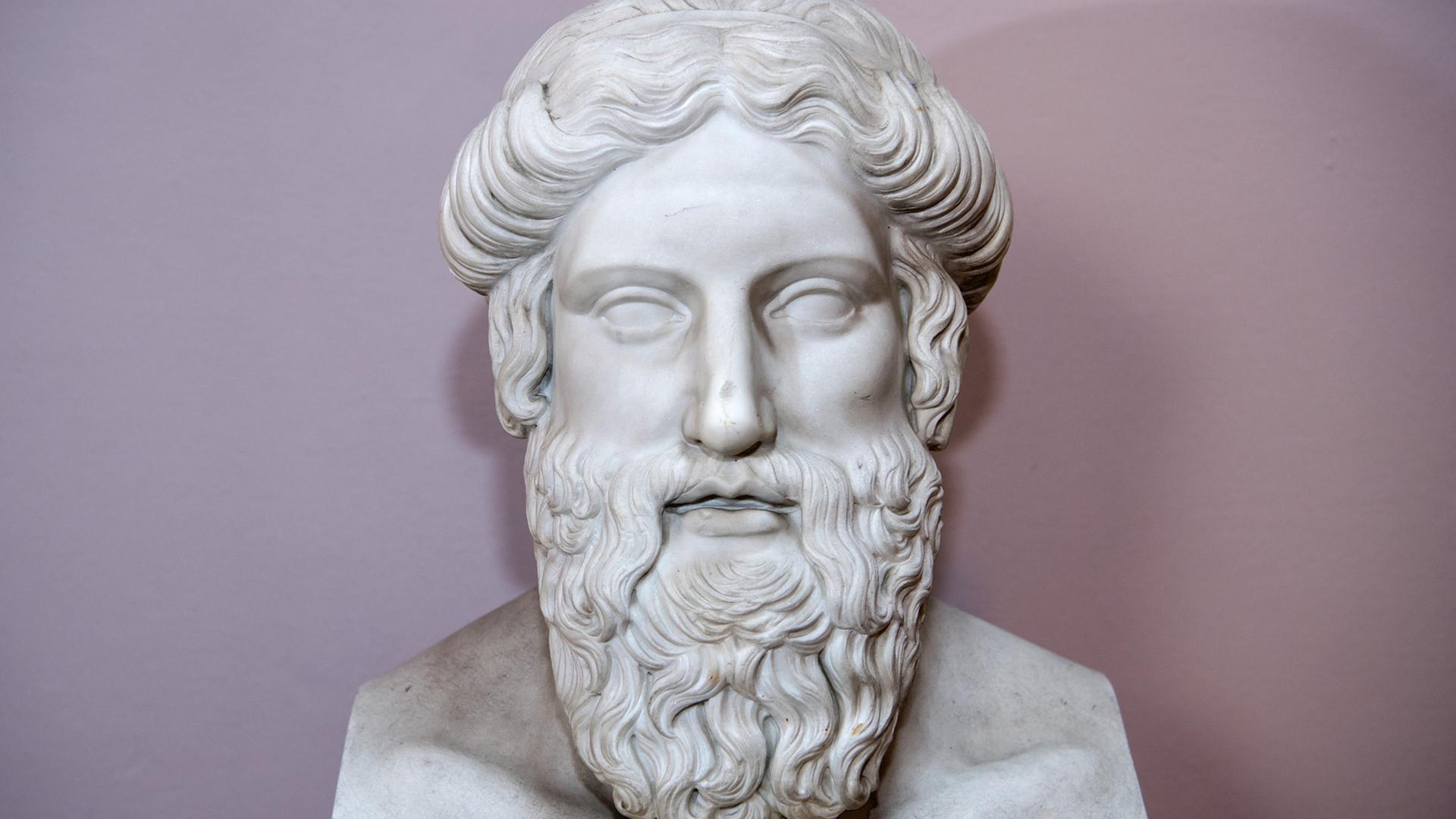In Straßburg kann man eine Ikone der klassischen Moderne besichtigen, nämlich das in den 1920er-Jahren von Theo van Doesburg und Sophie Taeuber-Arp eingerichtete Lokal in der "Aubette" an der Place Kléber. Die Innenarchitekten schufen damals ein abstraktes Gesamtkunstwerk, das mit geometrischen Formen und einer streng auf die Primärfarben (plus Schwarz und Weiß) reduzierten Farbgebung ein Gegenmodell zur bürgerlichen Gemütlichkeit sein wollte.
Viele Arbeiten bleiben hinter 20er-Jahre-Vorbildern zurück
Aber die von Doesburg und Piet Mondrian ins Leben gerufene "de Stijl"-Gruppe war ja nicht die einzige Vorhut der klassischen Moderne, die die abstrakte Malerei ins Räumliche und Funktionale hinein erweitern wollte. Das Bauhaus und die russischen Konstruktivisten taten Ähnliches – und kupferten auch voneinander ab.
Wenn das Straßburger "Musée d’Art Moderne et Contemporain" nun den Nachhall untersucht, den diese alten Avantgarden bei heutigen Künstlern auslösen, dann kann eigentlich nur eine Enttäuschung dabei herauskommen. Selbst wenn der Komponist Nicolas Godin die Architekturfilme des Xavier Veilhan virtuos und futuristisch grundiert: Viele der gezeigten Arbeiten bleiben, trotz wortreicher Kuratorenprosa, weit hinter den 1920iger-Jahre-Vorbildern zurück.
Edi Rama, Künstler und Ministerpräsident, bekämpft Tristesse mit starken Farben
Und dennoch: wenn man (im Video) sieht, wie der albanische Künstler Edi Rama, seit 2013 nebenbei Ministerpräsident seines Landes, allein mit Farbe die sozialistische Tristesse der Hauptstadt Tirana bekämpft, dann kann man fast den Glauben an die Kunst wieder gewinnen. Rama beschichtet Balkone und andere – oft quadratische – Außenelemente von sehr grauen Wohnblocks mit den Primärfarben und beweist dabei so viel Musikalität, dass ein fließender Rhythmus entsteht. Wie ausgetüftelt das ist, kann man an seinen Skizzen nachvollziehen.
Der Videokünstler Anri Sala fährt mit seiner Kamera nachts an diesen Häusern vorbei. Manche sind bunt, andere im Bau oder noch Ruinen, die Straße eine aufgerissene Baustelle; das Ganze ein heroisches Dokument - des Sieges der Farbe über die Gleichgültigkeit.
Die "Rayons", die (schwarzen) Strahlen, die der französische Künstler Xavier Veilhan als straff gespannte Seile im Museum installiert, sind dagegen in den Saal hinein erweiterte konstruktivistische Zeichnungen, die – wie Op-Art – den Besucher zunächst irritieren und ihm, je nach Perspektive und Standpunkt, immer neue Blicke auf das Kunstwerk ermöglichen. Noch imposanter sind Veilhans Videofilme: Seine Kamera fährt durch ausgewählte, leere Außenanlagen und zum Teil kubistisch inspirierte Privatvillen, Bauten der klassischen Moderne von Le Corbusier und Robert Mallet-Stevens. Schwarzgewandete Menschen stehen gleichgültig herum, manchmal tanzen sie, ein andermal schieben sie in Zeitlupe einen überdimensionierten Ball über die Balkonbrüstung – ein surreales Filmkunstwerk, das durch die Kompositionen von Nicolas Godin noch etwas zusätzlich Fremdes bekommt.
Nett, aber mehr auch nicht
Godin versucht, die architektonischen Linien und Geometrien in Musik zu bannen. Und das ist um einiges überzeugender als die vielen Spielereien, die sonst noch in dieser Ausstellung zu sehen sind. Alle haben einen Bezug zu den 1920er-Jahren – aber Michel Aubrys konstruktivistischer Pavillon oder Bertrand Lamarches überdimensionales Modell einer Wohnmaschine (für 12.000 Menschen) erzeugen beim Besucher eher das Gefühl eines Déjà-Vu.
Ebenso wie Haegue Yangs rotierende Geometrien oder Farah Atassis sterile Bilder, die sich auf Picasso und das Bauhaus beziehen. Und Ryan Ganders bunte Spielzeuge, die mit Bausteinen und Ikea-Tischen eine eigene Zeichensprache erzeugen, sind nett, aber mehr auch nicht. Verloren steht neben Ganders Arbeiten ein Aschenbecher aus van Doesburgs "Aubette" – man kann die Traditionslinien nicht herbeizwingen. Und von selbst stellen sie sich nicht her.