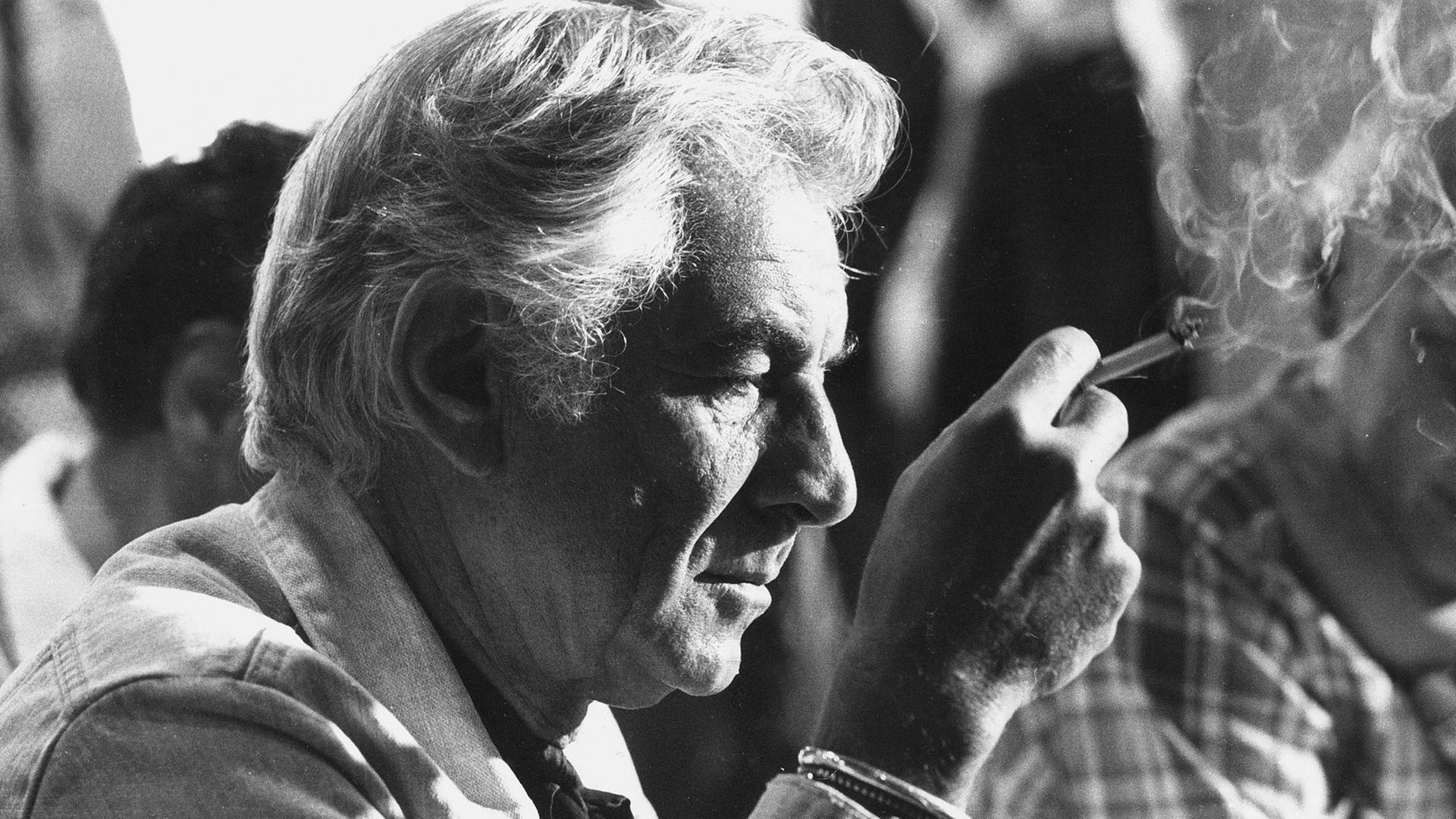Gus Christie lässt sich normalerweise nicht so schnell aus der Ruhe bringen. Der 53-jährige Enkel des Festivalgründers im südenglischen Glyndebourne sitzt seit 18 Jahren auf dem Chefsessel, brachte als erstes britisches Festival mindestens eine seiner jährlich sechs Opernproduktionen jeden Sommer auf die Kinoleinwand, holte Social-Media-Experten ins Haus und hob erstmals im Frühjahr dieses Jahres eine Fernseh-Castingshow für junge Opernsänger aus der Taufe, um auch jüngere Menschen für klassische Musik zu begeistern.
Die letzten Monate brachten aber auch ihn an seine Grenzen: "Dieses Jahr stehen wir vor einer Zäsur. Die Veränderungen halten an. Ich denke, wir haben aber jetzt eine klare Vision für die zukünftige Struktur des Festivalmanagement."
"Wir machen das weiter, was wir am besten können"
Seit der frühere Generaldirektor Sebastian Schwarz seinen Posten vor sieben Monaten mit sofortiger Wirkung hinschmiss, steht Glyndebournes Opernfestival ohne künstlerischen Leiter da. Schwarz hat das Programm zwar bereits bis 2021 durchkuratiert, Gus Christie erhoffte sich mit dem im ostdeutschen Rostock geborenen Musikmanager eine Zäsur der anderen Art. Doch nur Geldgeber für das traditionell komplett durch Sponsorengelder eigen finanzierte Festival einzuwerben, entsprach nicht Schwarz` Vision für Glyndebourne.
Zu spät für ihn, aber ein Teil der jetzigen Zäsur ist, dass der Posten des Generaldirektors auf zwei Stellen aufgesplittet wird. Der künftige künstlerische Leiter soll noch in diesem Monat bekannt gegeben werden. Gus Christie: "Wir machen hier mittlerweile sehr viel mehr als noch vor 20 Jahren. Das liegt einerseits natürlich an unserem Opernhaus, das mein Vater in den 90ern gebaut hat. Dadurch haben wir in der Liga der Sommerfestivals ein sehr hohes Niveau erreicht. Das ist auch gut so, aber wir zahlen einen hohen Preis dafür."
Nicht nur das Festival, sondern auch die Besucher. Um das künstlerische Angebot auf höchstem Niveau zu halten, baut Christie derzeit einen komplett neuen Produktionsstandort direkt neben dem Opernhaus. Maske, Kostüme, Malerwerkstätten, Bühnenbildner, alles unter einem Dach. Glyndebourne kleckert nicht, man klotzt. Und das in Zeiten des Brexit: Das britische Pfund ist auf einen Tiefststand von 1:1,1 gesunken, die Künstler werden teurer. Ein Ende ist nicht abzusehen.
Christie: "Aber was sollen wir tun? Wir machen das weiter, was wir am besten können. Keiner weiß, wie es mit dem Brexit weitergehen. Wir wissen nur, dass die Gagen für die Künstler, die wir haben wollen, steigen. Deshalb müssen wir die Ticketpreise erhöhen, auch gegen den Widerstand unseres Publikums. Derzeit stehen wir finanziell aber noch ganz gut da durch unsere Rücklagen."
Revival des amerikanischen Komponisten Samuel Barber
Gut, wenn dann ein lang vergessenes Werk auf die Bühne kommt, das durchaus für ein Revival des amerikanischen Komponisten Samuel Barber stehen kann: "Vanessa", vor 60 Jahren uraufgeführt mit pompösem Staraufgebot an der New Yorker Metropolitan Opera. Zwar lehnte Superstar Maria Callas ab, Sena Jurinac, der jugoslawische Star der Wiener Staatsoper und des Glyndebourne Festivals sprang dagegen ein. An ihrer Seite der schwedische Tenor Nicolai Gedda. Spötter meinten, nur durch diese Besetzung sei "Vanessa" überhaupt erst berühmt geworden. Das Wort vom Eklektizismus machte die Runde, Barber hätte abgekupfert – bei Puccini, Gershwin, Mahler. Zu traditionell, nicht avanciert genug.
Diese Meinung scheint sich gerade zu ändern. Es gäbe eine Barber-Renaissance ist Gus Christie, Chef des Glyndebourne-Festivals, überzeugt. Vor zwei Jahren triumphierte das auf selten gespielte Opern spezialisierte Festival im irischen Wexford damit, die Frankfurter Oper zeigte 2012 eine solide Inszenierung. Im kommenden Jahr steht es beim Schleswig-Holsteinischen Landestheater auf dem Programm. Und seit gestern auch in Glyndebourne. Aus der Hand des britischen Regisseurs Keith Warner, eigentlich Englands Wagner-Spezialist, der zuletzt "The great Gatsby" in Dresden auf die Bühne brachte, Peter Grimes in Frankfurt, Nabucco in Berlin und derzeit Wagners Ring für Covent Garden vorbereitet:
"Wenn man Opern mag, Leidenschaft für Musik und Drama, dann muss man dieses außergewöhnliche Werk lieben. Ich kenne es seit meinem Studium, habe viele Aufnahmen gehört und wollte es schon lange einmal auf die Bühne bringen", sagt Keith Warner.
Librettist Gian Carlo Menotti, Lebensgefährte von Samuel Barber, traf Keith Warner noch persönlich. Sie hätten viel über Opern, Musik und das Unausgesprochene in "Vanessa" gesprochen: "Seit dieser Zeit hat sich enorm viel in der amerikanischen Opernlandschaft geändert. Was er wollte, war das Unausgesprochene auf der Bühne zu zeigen, Dinge, über die man damals in den 50er Jahren nicht reden konnte, er hatte die Idee, dass das, was eben nicht gesagt wird genauso wichtig wird, wie das, was tatsächlich ausgesprochen wird."
Humorvolles Trauerspiel
Für Warner ein gefundener Spielplatz nun in Glyndebourne. Die erste Produktion des im Dezember urplötzlich ausgeschiedenen, früheren Generaldirektors Sebastian Schwarz. Eine Ahnung davon, wie Schwarz Glyndebourne künstlerisch umgebaut hätte. Nämlich hin zu einer experimentierfreudigen Bühne mit modernen Werken und einem Augenzwinkern. Denn was Regisseur Warner auf die Bühne stellt, ist kurz gesagt, ein humorvolles Trauerspiel rund um weibliche Gefühle, Trotz und falsch verstandene Moral.
Zeitlich verortet am Anfang des 20. Jahrhunderts im nordisch winterlichen Europa, inspiriert vom absurd-tragischen Ambiente eines Karen-Blixen Settings oder einer nicht weniger bizarren Ibsen-Familienstory entfaltet Warner die Geschichte dreier Frauen: die alte Baroness, deren Tochter Vanessa und deren Nichte Erika, die ihren verflossenen Liebschaften nachtrauern. Allen voran die züchtig gekleidete Vanessa, deren Liebhaber Anatol vor Jahren verschwand. Nun soll er zurückkehren, doch wer da in der Tür steht, ist sein Sohn Anatol, ein Don Juan, ein Lebemann, nah am Heiratsschwindler, aalglatt gesungen von dem litauischen Tenor Edgaras Montvidas.
Natürlich verführt dieser gleich am ersten Abend nicht Vanessa, sondern die Nichte Erika, die, upps, gleich schwanger wird. Eine herrlich naive Rolle für die französische Mezzosopranistin Virginie Verrez, bis vor kurzem Mitglied des Jugendprogramms der MET. Vom Selbstmordversuch der Nichte bis zur Verlobung der wesentlich älteren Vanessa mit dem Tunichtgut Anatol sind es nur wenige Minuten des dreistündigen Abends.
Man verfolgt amüsiert bis ungehalten die krude Story, begleitet von einem fulminanten London Philharmonic Orchestra unter dem tschechischen Dirigenten Jakub Hrusa. Die Zwischentöne, das Ungesagte geschieht bei Regisseur Warner in einem bezaubernden Bühnenbild von Asley Martin-Davis, der zuvor schon in Bregenz, Straßburg, Frankfurt und Lyon Produktionen illustrierte. Ashley-Martin stellt in Glyndebourne ein Panoptikum von überdimensionalen Bilderrahmen, dann wieder Buchdeckel, je nach Sichtweise, neben-, gegen- und ineinander, das sich der Zuschauer fragt, was hier echt und was Illusion ist?
Keine eigene Barber-Sprache
Ob der alte Doktor, der die Nichte nach dem Selbstversuch untersucht, nicht der ehemalige Liebhaber der alten Baroness ist? Ob die Nichte nicht eigentlich die Tochter von Vanessa und dem älteren Anatol ist? Und ob der junge Anatol nicht eigentlich nur eine Projektion der dem Jugendwahn verfallenen Vanessa ist? Alles kurzweilige Gedankenspiele, derweil es aus dem Orchestergraben nach Filmmusik klingt, nach Pucchini, nach Gershwin.
Es gibt keine eigene Barber-Sprache, da wurde zusammengemixt, was die Musikgeschichte um 1958 so hergab. Warum genau diese Oper nun ein Revival an den Opernhäusern erfährt? Wohl, weil es derzeit in der Gesellschaft beim Umgang mit Traditionen und Geschichte ähnlich zugeht.