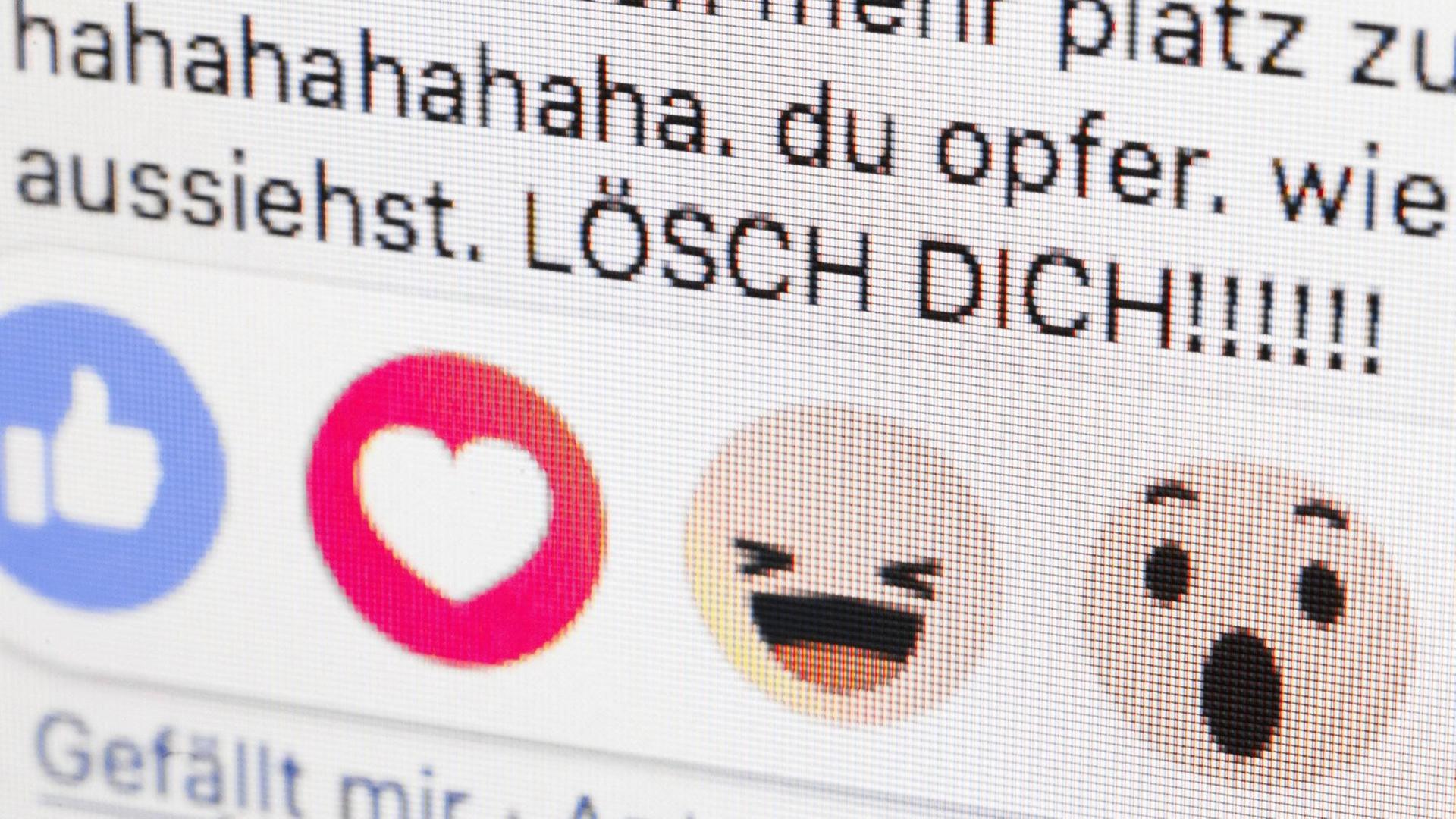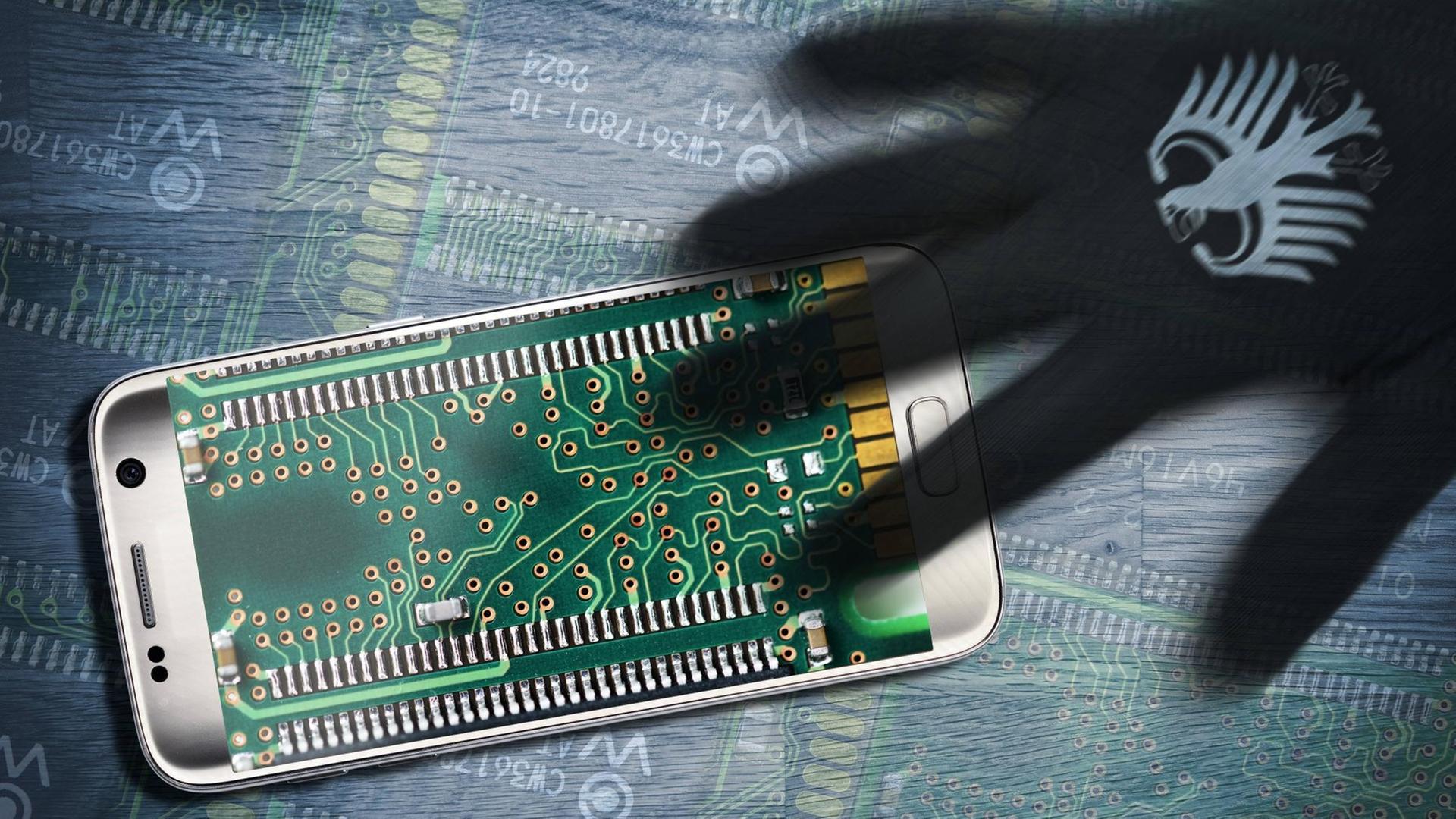
Das Gericht in Karlsruhe erklärte die Regelungen zur sogenannten Bestandsdatenauskunft für verfassungswidrig und forderte klarere Grenzen für die staatliche Datenabfrage. Die Richter argumentierten sehr formal: Zwar handele es sich bei der Bestandsdatenauskunft nicht um einen besonders tiefen Eingriff in die persönlichen Rechte, dennoch verletzten die jetzigen Regelungen im Telekommunikationsgesetz und anderen Gesetzen das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung und das Telekommunikationsgeheimnis.
Bestandsdaten sind persönliche Daten von Telefon- und Internetkunden, die bei Telefongesellschaften oder Providern gespeichert sind, beispielsweise Namen, Geburtsdatum, Adresse, Art des Vertrags, Kontoverbindung etc. Die Regelung betrifft aber auch die Datenauskunft mithilfe der IP-Adresse von Computern oder Telefonen, die einem bestimmten Anschluss zugeordnet werden können, sowie Passwörter, soweit die bei einem Telekommunikationsunternehmen gespeichert sind. Die Bestandsdaten umfassen jedoch keine Gesprächsinhalte oder Verbindungsdaten, etwa Angaben darüber wer wann mit wem telefoniert hat. Diese sind vor Zugriffen geschützt.
Die Bestandsdaten darf dagegen eine ganze Reihe von Sicherheitsbehörden unter bestimmten Umständen abfragen, unter anderem das Bundeskriminalamt, die Bundespolizei, der Verfassungsschutz oder der Zoll.
Die Bundesregierung hat im Verfahren betont, dass diese Daten sehr wichtig seien, etwa für die Terrorabwehr oder zur Abwehr und Verfolgung von schweren Straftaten. Das Verfassungsgericht erkennt diese Gründe auch grundsätzlich an und stellte klar, dass Auskünfte über Bestandsdaten grundsätzlich verfassungsrechtlich zulässig seien. Die Regelungen müssten aber die Verwendungszwecke der Daten hinreichend begrenzen. Die bisher geltenden rechtlichen Hürden für die Abfrage von Bestandsdaten sind jedoch sehr niedrig, etwa der Verdacht einer Ordnungswidrigkeit.
Eine genaue Statistik darüber wie oft die Sicherheitsbehörden die Bestandsdatenauskunft nutzen, wird nicht geführt, aber es liegen dennoch Zahlen vor. Demnach nutzen die einzelnen Behörden die Abfragemöglichkeit unterschiedlich: Nachrichtendienste fragen ein paar Hundertmal im Jahr entsprechende Daten ab, die Bundespolizei ein paar Tausendmal. Auffällig sind die Abrufzahlen des Bundeskriminalamts, die sich seit einer Neufassung der Vorgaben zur Bestandsdatenauskunft im Jahr 2013 bis 2017 verneunfacht haben, auf mehr als 17.000 Abfragen pro Jahr. Aktuell dürften sie noch einmal erheblich höher liegen. Dieser Anstieg steht vor allem im Zusammenhang mit Ermittlungen von Nutzern von kinderpornografischen Internetseiten.
Die Verfassungsrichter hatten die Bestandsdatenauskunft 2012 schon einmal beanstandet. Die damalige Vorgaben hat die Politik unzureichend umgesetzt, wie sich jetzt herausstellte. Die Karlsruher Richter beanstandeten nun erneut, dass die rechtlichen Hürden für eine Bestandsdatenabfragen viel zu niedrig sind.
Dies betrifft nicht nur die Norm im Telekommunikationsgesetz, sondern auch die entsprechende im Bundespolizeigesetz, im BKA-Gesetz und so weiter, die damit ebenfalls verfassungswidrig sind. Die Richter verlangen jetzt, dass zumindest eine konkrete Gefahr drohen oder der Anfangsverdacht einer Straftat bestehen muss, bevor solche Bestandsdaten abgefragt werden dürfen.
Bisher reichte dem Verfassungsschutz beispielsweise als Begründung, dass die enzsprechenden Daten für seine Aufgaben braucht. Dies sind jedoch sehr weit und können beispielsweise in einer bloßen Analyse bestehen.
Darüber hinaus machten die Verfassungsrichter klar, dass bei der Datenauskunft mithilfe von IP-Adressen eine "erheblich größere Persönlichkeitsrelevanz" vorliege, weil dadurch eine Rekonstruktion der individuellen Internetnutzung zu einem bestimmten Zeitpunkt möglich sei.
Passwörter dürfen zwar abgefragt werden, aber nur mit sehr hohen Hürden. Wenn es beispielsweise um ein E-Mail-Postfach geht, dann müssen die Voraussetzungen dafür bestehen, dass auch Emails herausgegeben werden müssten. Dazu muss einiges an Gefahr drohen und auch ein Richter mitentscheiden.
Patrick Breyer, Europaabgeordneter der Piratenpartei und einer der Verfassungsbeschwerdeführer, begrüßte die Entscheidung. Sie zeige, dass es gute Gründe brauche, Anonymität am Telefon oder im Internet aufzuheben, wenn sie wichtig und gewollt ist – etwa, weil es um politischen Protest, journalistische Recherche oder auch Seelsorge gehe. Wenn für solche Fälle keine ausreichend hohen Hürden gebe, bestehe die Gefahr, dass beispielsweise Whistleblower aus Angst nichts mehr sagten.
Bis Ende 2021 müssen alle beanstandeten Gesetze umgeschrieben werden. Bis dahin gelten sie weiter, allerdings mit den entsprechenden Hürden, die jetzt im Urteil des Bundesverfassungsgerichts stehen.
Das Bundesjustizministerium prüft muss jedoch prüfen, ob noch andere Gesetze geändert werden, etwa das gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität, das gerade erst erlassen wurde. Denn in diesen sind ähnliche Regelungen wie in dem jetzt beanstandeten Gesetzen enthalten.