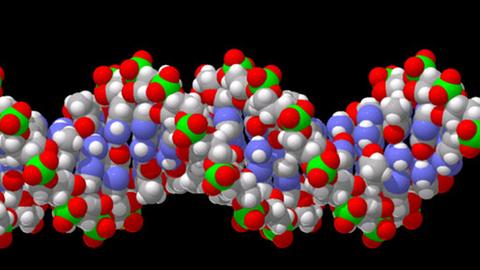Wer schlau ist, besitzt das Intelligenz-Gen, schwul wird man durch das Homosexualitäts-Gen, und auch wer übergewichtig ist, macht seine Gene verantwortlich. Krebsgene verursachen Krebs und der Fußballverein Bayern München hat das Sieger-Gen. Wer das besitzt, kann gar nicht verlieren.
Alle reden von Genen. Nur in der Wissenschaft, wo das Gerede von den Genen einst begonnen hat, weiß heute niemand mehr so genau, was ein Gen eigentlich ist. Einer, der es ganz genau weiß, ist Prof. Hans-Jörg Rheinberger, Direktor Emeritus vom Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin.
Alle reden von Genen. Nur in der Wissenschaft, wo das Gerede von den Genen einst begonnen hat, weiß heute niemand mehr so genau, was ein Gen eigentlich ist. Einer, der es ganz genau weiß, ist Prof. Hans-Jörg Rheinberger, Direktor Emeritus vom Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin.
"Ich würde sagen, dass das Gen in diesem Sinne, wie es charakteristisch war für das 20. Jahrhundert, dass es diese Rolle in der Biologie des 21. Jahrhunderts nicht mehr spielen wird."
Die Abschaffung der Gene. Von Gregor Mendel zur Systembiologie.
"Gene" wurden nicht entdeckt; sie wurden erfunden. In einigen gelehrten Köpfen entstand im Laufe des letzten Jahrhunderts eine Vorstellung, wie Vererbung abläuft und wie so ein Gen als Einheit der Vererbung aussehen könnte. Die Vorstellung wurde mit der Zeit immer konkreter. Sie half dabei, neue Erkenntnisse über die Vererbung zu gewinnen, erläutert der Wissenschaftshistoriker Hans-Jörg Rheinberger, Direktor Emeritus am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin.
"Die Frage, was ein Gen ist und was nicht, hängt immer auch mit den Manipulationen zusammen, die wir mit diesem Material durchführen können. Das ist ja die Art und Weise, wie wir darüber etwas lernen."
Gene lassen sich heute lesen wie ein Buch. Biologen haben sogar gelernt, die Einheiten der biologischen Vererbung künstlich zusammenzubauen und von einer Art auf eine andere zu übertragen. Sie manipulieren Gene oder programmieren sie wie einen Computer.
Dabei dringen sie immer tiefer vor - bis auf die Ebene einzelner Moleküle. In den Lehrbüchern besitzt das Gen seit den 1970er Jahren eine wissenschaftliche Definition. Aber nun stellt sich heraus: Alles ist komplizierter, erklärt Prof. Rheinberger:
Dabei dringen sie immer tiefer vor - bis auf die Ebene einzelner Moleküle. In den Lehrbüchern besitzt das Gen seit den 1970er Jahren eine wissenschaftliche Definition. Aber nun stellt sich heraus: Alles ist komplizierter, erklärt Prof. Rheinberger:
"Das Gen im Sinne einer solchen rigiden Definition hat sich aufgelöst. Es hat sich regelrecht verflüssigt."
Um zu verstehen, warum es dem Gen jetzt an den Kragen geht, ist es wichtig, seine Geschichte zu kennen. Seinen Aufstieg und seinen Niedergang. Es begann vor 150 Jahren.
Der "Vater der Genetik": Gregor Johann Mendel

Am 8. Februar 1865 trat ein großgewachsener, kräftig gebauter Mönch Mitte vierzig mit Nickelbrille vor die naturforschende Gesellschaft der Stadt Brünn. Einigen der anwesenden Honoratioren war Gregor Johann Mendel bereits bekannt als Lehrer für Naturwissenschaften am Gymnasium der mitten in der Stadt gelegenen Augustiner-Abtei.
"Wir wissen, dass mehr als 60 Personen zuhörten, als Mendel seine Ergebnisse vortrug und die Zeitungen in Brünn berichteten darüber."
Ondrey Dostàl leitet das Mendel-Museum in Brünn. Heute heißt die Stadt Brno und ist die zweitgrößte Stadt Tschechiens. Sie liegt auf halber Strecke zwischen Prag und Wien.
"Mendel ging als Augustiner-Mönch zum Studium nach Wien, weil er unter Prüfungsangst litt und beim Examen für den Lehrerberuf durchgefallen war. Für Mendel erfüllte sich ein Traum. Er studierte bei dem renommierten Physiker Christian Doppler, damit er in Brünn Lehrer werden durfte", so der Museumsdirektor Dostàl.
Beten und Lehren. Das war dem naturwissenschaftlich interessierten Mönch nicht genug. Er wollte selber forschen. Da er sich im Kloster ohnehin um den Garten kümmern sollte, züchtete er dort Erbsenpflanzen.
"Als Mendel mit seinen Experimenten begann, suchten viele Wissenschaftler nach den Prinzipien der Vererbung. Die meisten beschränkten sich auf die Beobachtung. Mendel jedoch hatte im Physikstudium gelernt, wie man aus Experimenten Schlüsse zieht, und wie man Experimente statistisch auswertet. Er suchte nach zählbaren Einheiten der Vererbung, die er im Innern der Pflanzen vermutete."
Der Garten und die Grundmauern eines Treibhauses sind heute in Brno hinter den Klostermauern zu besichtigen. Unter einem Baum steht ein lebensgroßes Mendel-Denkmal. Die nach dem Zweiten Weltkrieg vertriebenen Augustiner sind in das Kloster zurückgekehrt. Und in der Klosterkirche wird die Messe auf Tschechisch gefeiert.
Was der Mönch bei seinem Vortrag berichtete, steht heute in den Schulbüchern. Mendel hat herausgefunden: Wenn er weißblühende mit rotblühenden Erbsen kreuzte, waren alle Pflanzen der nächsten Generation rotblühend. Die weißen Blüten waren anscheinend verschwunden. Das besagt heute die erste Mendelsche Regel: die Uniformitätsregel. Dann kreuzte Mendel die Pflanzen erneut, und die bereits verschwundenen weißen Blüten tauchten wieder auf - bei einem Viertel der Pflanzen. So lautet die zweite Mendelsche Regel, die Spaltungsregel:
"In dieser Generation treten nebst den dominierenden Merkmalen auch die rezessiven in ihrer vollen Eigentümlichkeit wieder auf, und zwar in dem entschieden ausgesprochenen Durchschnitts-Verhältnisse 3:1."
Die Gelehrten, die von Mendels Ergebnissen erfuhren, hielten sie für eine Kuriosität der Erbsenzüchtung. Sie erkannten nicht, dass darin erstmals die materielle Natur der Erbanlagen deutlich wurde. Rückblickend ist klar: Mendel hat grundlegende Gesetze der Vererbung nachgewiesen. Mehr noch: Er hat Erbanlagen zählbar gemacht. Mendel hatte die Wirkung der Gene entdeckt, auch wenn er den Begriff noch nicht kannte. Der Wissenschaftshistoriker Hans-Jörg Rheinberger formuliert Mendels damaligen Wissensstand so:
"Da muss es etwas geben, irgendwo in den Tiefen der Zelle verborgen, das die Ausprägung dieser Merkmale steuert, aber nicht nur das. Dieses etwas muss auch von einer Generation zur nächsten Generation in mehr oder weniger unveränderter Form weiter gegeben werden."
"Genetikos": Hervorbringung
Mendel war längst gestorben, da wurden um 1900 seine Schriften von vier europäischen Wissenschaftlern aufgegriffen. Sie begründeten die Wissenschaft von der Vererbung, die Genetik. Den Mönch aus Brünn erklärten sie posthum zum Gründervater ihrer Wissenschaft. Was noch fehlte, war ein Name für die Einheiten der Vererbung. Einige Forscher sprachen einfach von Anlagen, andere von Biophoren. Dazu Professor Rheinberger:
"Hugo De Vries, ein holländischer Forscher, der an der Wiederentdeckung der Mendelschen Regeln beteiligt war als einer der wesentlichen Akteure, nannte sie Pangene. Dem dänischen Biologen Wilhelm Johannsen ist dann die etwas kürzere Version zu verdanken, dass man diese Einheiten als Gene angesprochen hat. Und der Begriff hat sich dann eben auch durchgesetzt."
Der Name der Wissenschaft "Genetik" war bereits vorher entstanden. Als Vorlage diente das altgriechische Wort "genetikos": Hervorbringung. Und 1909 leitete der dänische Botaniker Wilhelm Johannsen davon den Begriff "Gen" ab. Gene waren demnach die Einheiten, die einzelne Merkmale hervorbringen. Ein Gen bestimmt die Blütenfarbe der Erbse, ein anderes die Augenfarbe eines Menschen und so weiter: Ein Gen - ein Merkmal.
Wie so ein Gen aussah, wussten die ersten Genetiker nicht. Sie verwendeten es wie die Variable X in einer mathematischen Gleichung. Das reichte, um die Forschung voranzutreiben.
"Wenn wir davon ausgehen, dass es da etwas gibt, von dem wir nicht genau wissen, wie es materiell verfasst ist, dann können wir dennoch alle unsere Experimente damit wunderbar erklären. Und so blieb das zunächst eine vollkommen abstrakte Entität in der gesamten Epoche der klassischen Genetik bis in die vierziger Jahre des 20. Jahrhunderts hinein", so der Wissenschaftshistoriker Rheinberger.
Der Begriff "Gen" erwies sich als Zugpferd für die neue Wissenschaft. Unterdessen entwickelten Physiker und Chemiker neue Methoden, um die Vererbung zu erforschen. In den vierziger Jahren konnte dann die Suche beginnen nach dem Stoff, aus dem die Gene gemacht sind. Die meisten Biochemiker tippten auf die Proteine, die Eiweiße, als Erbsubstanz. Ihre Vielfalt machte sie zu geeigneten Kandidaten. Dann jedoch, Ende der 1940er Jahre, mehrten sich die Hinweise, dass ein fadenförmiges Molekül im Innern des Zellkerns Träger der Gene sein könnte: die Desoxy-Ribo-Nukleinsäure, kurz DNA. Dann war auf einen Schlag alles klar.
Am 28. Februar 1953 um die Mittagszeit stürmten zwei junge Männer aus dem benachbarten Labor in den Eagle, einen typisch englischen Pub in der Universitätsstadt Cambridge. Es sprudelte geradezu aus ihnen heraus. Sie hätten - so jubelten die beiden - das Geheimnis des Lebens entdeckt:
"I knew Crick. He had a loud voice."
Der damalige Doktorand und spätere Nobelpreisträger Aaron Klug erinnert sich gut an die beiden: Den Physiker Francis Crick, den Mann mit der lauten Stimme, der mit Mitte dreißig immer noch keinen Doktortitel hatte. Und den jungen Überflieger aus Amerika, der alles besser wusste: James Watson.
"Watson habe ich dann über seine Schwester kennengelernt. Mit der waren wir befreundet. Er schien mir ein merkwürdiger Typ zu sein."
Die beiden Außenseiter teilten sich ein Büro am Cavendish-Labor und dort bastelten sie an Molekülmodellen aus Holz und Metall.
"Watson war es, der Crick dazu brachte, die DNA zu erforschen. Denn Crick arbeitete eigentlich mit Proteinen. Watson war in dieser Sache äußerst zielstrebig."
James Watson war fest davon überzeugt, dass die DNA die Gene von Generation zu Generation trägt. Irgendwie musste die genetische Information darin gespeichert sein.
Statt selbst Experimente zu machen, besorgte sich James Watson Messdaten anderer Forscher. So gelangte er an Röntgenbilder der DNA aus dem Londoner Labor von Rosalind Franklin. Ein Kollege hatte die entscheidenden Aufnahmen - ohne dass Rosalind Franklin davon wusste - an Watson weiter gegeben. Der brachte sie nach Cambridge und gemeinsam mit Francis Crick versuchte er, die Bilder zu interpretieren. Die beiden tüftelten ein paar Wochen und schließlich entstand das Molekülmodell der DNA: die Doppelhelix.
"Die einzige Person, die die Daten auf Anhieb richtig interpretierte, war Francis Crick. Rosalind Franklin sagte mir einmal: Ich hätte mich treten können, dass ich die Lösung nicht erkannt habe. Aber sie konnte sich noch so treten, die Sache war gelaufen. Das war alles ein großes Drama", so Aaron Klug.
Das Jahr 1953 gilt als Wendepunkt für die Biologie

Am 28. Februar 1953 stand das fertige Modell der Doppelhelix auf dem Schreibtisch im Büro von Watson und Crick. Alles passte so gut zusammen, es musste einfach stimmen. Die beiden Stränge, die sich elegant umeinander wanden, und in der Mitte die Leitersprossen, die aus vier Basen bestanden: Adenin, Thymin, Guanin und Cytosin. Die Schlussfolgerung war klar: Die Reihenfolge dieser Basen - A, T, G und C - codierte die Information des Lebens. Das war die Sprache der Gene.
Heute gilt das Jahr 1953 als Wendepunkt für die Biologie. Die Zeit der klassischen Genetik war vorbei, die Zeit der Molekulargenetik hatte begonnen, erklärt auch der Wissenschaftshistoriker Prof. Rheinberger:
"Nach dem für die Molekularbiologie zentralen Schlüsselerlebnis, der Aufdeckung der Struktur der Doppelhelix, wurde nahegelegt, dass Gene möglicherweise so etwas sind wie molekulare Informationsspeicher. Und die Information, die da gespeichert werden sollte, ließ sich darstellen wie eine lineare Bausteinfolge."
In den sechziger Jahren stand dann endgültig fest: Drei genetische Buchstaben trugen die Information für eine Aminosäure. Und aus einigen oder auch sehr vielen Aminosäuren setzten sich die Proteine zusammen: die Enzyme, die Antikörper, die Hormone, die Muskelproteine - die wichtigsten Bausteine und Werkzeuge einer Zelle. Das Gen ist demnach ein Bauplan für ein Protein. Es besteht aus Dutzenden, Hunderten oder Tausenden genetischen Buchstaben und wird bei der Zellteilung immer weiter vererbt. Francis Crick formulierte 1959 das zentrale Dogma der Molekularbiologie:
"Die Information des Lebens stammt aus der DNA. Sie fließt stets in eine Richtung über das Botenmolekül RNA zu den Proteinfabriken der Zelle, den Ribosomen. Dort entstehen nach den Bauplänen der Gene die Proteine."
Was Mendel 1865 erstmals entdeckt hatte und was seine Nachfolger später Gene nannten, war nun keine vage Vorstellung mehr. Es gab eine Erklärung auf der Ebene der Moleküle, die die Forschung beflügelte. Jetzt hieß es nicht mehr "Ein Gen - ein Merkmal", sondern "Ein Gen - ein Protein". Das Gen löste zum zweiten Mal einen Forschungsboom aus. Daraus entwickelte sich in den 1970er Jahren die Gentechnik.
Immer mehr Gene wurden entdeckt, wie die "Brustkrebsgene" BRCA 1 und BRCA 2. Eine kleine Veränderung in diesen Genen erhöht das Risiko, an Brustkrebs zu erkranken erheblich. Ein Gen für blaue Augen haben die Forscher jedoch bis heute nicht entdeckt. Wie auch bei vielen anderen Merkmalen wirken mehrere Gene bei der Entstehung der Augenfarbe zusammen, und manchmal ändert sich die Augenfarbe im Laufe eines Lebens. Den Genforschern wurde langsam bewusst: Die Definition "Ein Gen - ein Protein" ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Mit dem größten Genetikprojekt aller Zeiten, dem "Human-Genom-Projekt" begann dann der Niedergang der Gene.
"Die Sprache, in der Gott das Leben schuf"
Am 26. Juni 2000 hatte US-Präsident Bill Clinton ins Weiße Haus geladen, und die Presse der Welt war erschienen, etwa zehn, Jahre nachdem das Human-Genom-Projekt seine Arbeit aufgenommen hatte. Das Ziel: die Entzifferung des menschlichen Erbguts Buchstabe für Buchstabe. In einer Mitteilung des Weißen Hauses hieß es:
"Wir lesen jetzt die Sprache, in der Gott das Leben schuf."
Zur Rechten von Bill Clinton stand ein kleiner, bulliger US-Forscher mit Glatze: Craig Venter, Präsident des Biotechnologie-Unternehmens Celera:
"Diese Arbeit hat eine enorme Bedeutung für unser Wissen über Krankheiten; außerdem für unser Selbstverständnis als Menschen, wer wir sind und wie wir als Art entstanden sind."
"Diese Arbeit hat eine enorme Bedeutung für unser Wissen über Krankheiten; außerdem für unser Selbstverständnis als Menschen, wer wir sind und wie wir als Art entstanden sind."
Die Sprache der Gene zu verstehen, erwies sich allerdings als schwierig. Das Ergebnis der Erbgut-Entzifferung war ein gewaltiger Datenberg, wie ihn die Biowissenschaftler bislang nicht kannten. Immer nur A, T, G und C. Ausgedruckt würden die Buchstaben des menschlichen Genoms mehr als tausend Telefonbücher füllen. Ein Stapel so hoch wie der Kölner Dom.
"Hundert Jahre würde man brauchen, um alle Buchstaben des Genoms selbst zu lesen. Um diese riesige Informationsmenge zu verarbeiten, brauchen wir neue Werkzeuge, neue Computer, neue Software. Denn die Information allein sagt gar nichts. Wichtig ist die Interpretation", so der US-Forscher Craig Venter.
Der Bioinformatiker Ewan Birney eröffnete damals eine Art wissenschaftliches Wettbüro im Internet. Er forderte seine Wissenschaftlerkollegen auf, Tipps abzugeben: Wie viel Gene sind wohl im Erbgut des Menschen verborgen? Die meisten Experten tippten eine Zahl zwischen 30.000 und 100.000. Gewonnen hat der niedrigste Tipp überhaupt: 26.000 Gene. Später wurde die Zahl weiter gesenkt: auf 22.000 Gene.
Das war ein Schock: Der Mensch besitzt kaum mehr Gene als eine Maus. Selbst winzige Fadenwürmer bringen es auf eine ähnliche Anzahl. Viele Pflanzen haben sogar deutlich mehr Gene aufzuweisen als der Mensch. Statt Antworten zu liefern, schürte das entzifferte Genom Zweifel: War der Mensch doch nicht die Krone der Schöpfung? Oder stimmt mit unserer Definition vom "Gen" etwas nicht.
Der Wissenschaftshistoriker Hans-Jörg Rheinberger bezeichnet die Jahre nach 2003, als das Genomprojekt offiziell beendet wurde, als Post-Genomik, eine Zeit der Ernüchterung:
"Generell hat mit der Genomik, der Genom-Sequenzierung, eine gewisse Ernüchterung insofern eingesetzt, als man herausgefunden hat, dass das menschliche Genom etwa nur ein Fünftel so viel Gene hat, als man vermutete, sodass sich natürlich die Frage stellte: Also mit nur zwanzig Prozent, wie erklären wir jetzt die ganze Komplexität eines Organismus?"
Die Antwort lautete: Die Zahl der Gene sagt kaum etwas aus über die Komplexität eines Organismus. Hatte man auf das falsche Zugpferd gesetzt? Der Bioinformatiker Martin Vingron, Direktor am Max-Planck-Institut für Molekulare Genetik in Berlin, sieht die Schwierigkeiten, will aber wie die große Mehrheit seiner Kollegen auf den Begriff "Gen" nicht verzichten:
"Es ist schon so, dass unser Denken nach wie vor strukturiert wird vom Genbegriff."
Die Gene allein entscheiden nichts
Die Vorstellung Gregor Mendels und des Dänen Wilhelm Johannsen, dass ein Gen im Innern der Lebewesen ein äußeres Merkmal bestimmt, haben die Genetiker längst hinter sich gelassen. Sie mag helfen, wenn man nach den Ursachen einer Blütenfarbe in Erbsen sucht. Bei den meisten vererbten Merkmalen sind es aber viele Gene, die zusammenwirken.
"Man hat sich in den letzten Jahren bemüht, die genetische Grundlage für die Größe eines Menschen zu finden. Es hat sich dabei herausgestellt, dass wohl Hunderte Gene in irgendeiner Weise involviert sind, zu bestimmen, wie groß ein Mensch einmal wird", so der Bioinformatiker Vingron.
Auch bei den meisten Krankheiten wirken zahlreiche Gene auf komplizierte Art und Weise zusammen; und dann kommen noch die Umweltfaktoren hinzu. So ist es zum Beispiel beim Brustkrebs. BRCA 1 und BRCA 2 erklären weniger als zehn Prozent der Brustkrebsfälle, meist wirken viele Gene und Umweltfaktoren zusammen.
Das Gleiche gilt für fast alle wichtigen Volkskrankheiten. Als das erste Diabetes-Gen gefunden wurde, jubelte die Fachwelt noch. Das zweite fand schon weniger Interesse. Und nachdem über 20 Diabetes-Gene bekannt waren, blieb ein Schulterzucken. Heute heißt es: Die Gene tragen bei zur Erhöhung des Risikos für die Krankheit Diabetes Typ 2 - manche mehr, die meisten weniger, erklärt Martin Vingron:
"Man hat erkannt, dass diese 1:1-Beziehung so nicht existiert, dass ein Merkmal von vielen Genen beeinflusst werden kann, dass ein Gen mit seinem Protein viele Merkmale beeinflussen kann, dass ein Gen ohnehin für verschiedene Proteine codiert, weil es viele Isoformen gibt. Also die Beziehungen sind viel komplexer und verschachtelter als man sich das am Anfang vorgestellt hat."
Nun wackelte also auch die zweite, die molekulare Definition. Die Gene allein entscheiden nichts. Chemische Anhängsel kontrollieren sie und Proteine steuern das Geschehen von außen. Viele Ebenen wirken miteinander und gegeneinander. Die Faktoren jenseits der Gene werden unter dem Begriff Epigenetik zusammengefasst. Hier stoßen die Forscher täglich auf neue Fragen. Je mehr sie entdecken, umso weniger verstehen sie.
Zeit, das "Gen" über Bord zu werfen?
Das Human-Genom-Projekt war noch nicht abgeschlossen, da startete bereits eines der Nachfolgeprojekte. Es erhielt den Namen Encode-Projekt. Darin sollte erforscht werden, welche Bereiche im Erbgut aktiv sind. Waren das - wie man zunächst annahm - ausschließlich die Gene?
Um das zu überprüfen, suchten die Forscher nach aktiven Bereichen im Erbgut des Menschen. Das sind Bereiche im Erbmolekül DNA, die abgeschrieben werden als RNA. Der vormalige genetische Buchmacher Ewan Birney vom Europäischen Bioinformatik-Institut koordinierte das Projekt und verkündete 2005 die ersten Ergebnisse:
"Das war eine Überraschung. Wir fanden viel mehr Abschriften, mehr Aktivität, als wir erwartet hatten."
Über neunzig Prozent des Erbguts erwies sich als aktiv, obwohl die Gene nur circa zwei Prozent des Genoms ausmachten. Der größte Teil der DNA bestand also nicht aus Genen, war aber dennoch kein Schrott, wie viele Forscher zuvor vermutet hatten. Aber was dann? Der Bioinformatiker Vingron erklärt es:
"Man hat Dinge gefunden, die wie Gene aussehen, die aber scheinbar nur RNA und kein Protein codieren. Und das hat den Genbegriff fundamental erschüttert.
Neben dem Erbmolekül DNA und den Proteinen gewann ein weiterer Mitspieler an Bedeutung. Ewan Birney vom Europäischen Bioinformatik-Institut:
"Das Encode-Projekt offenbarte die Bedeutung der RNA. Das Boten-Molekül RNA wird nicht nur von der genetischen Information, der DNA, abgeschrieben, damit nach diesem Bauplan Proteine entstehen. Es gibt noch viel mehr RNA, die abgeschrieben wird, ohne dass dann Proteine entstehen. Das ändert unseren Blick auf das Genom von Grund auf. Wir wissen einfach nicht, was diese große Menge RNA macht, oder ob sie überhaupt irgendetwas Wichtiges macht."
Die Teilnehmer des Encode-Projektes wurden aufgefordert, ihre Ergebnisse in Fachzeitschriften zu kommentieren. Aber sie konnten sich nicht einigen. Es gab zwei Fraktionen. Eine wollte "das Gen" behalten, und die Definition nach und nach anpassen. Die andere Gruppe forderte, "das Gen" über Bord zu werfen, um Platz zu schaffen, für neues Denken und neue Theorien.
Das Gen hat seine Kraft als Zugpferd für die Genetik verloren. Die Experten fragen sich: Was ist überhaupt ein Gen? Ist jede RNA, die im Zellkern entsteht ein Gen, auch wenn sie keine bekannte Wirkung entfaltet? Sie suchen nach neuen Bildern und vergleichen Lebewesen mit Computern und Gene mit Programmen. Das ist naheliegend. Denn immer mehr Biowissenschaftler arbeiten heute mit Computern. Die DNA bezeichnen sie als die Software des Lebens, und die Programme schreiben sie selbst.
Als Inspiration für Genetiker hat der Begriff "Gen" ausgedient. Genetische Programme sind an ihre Stelle getreten. Nicht alle Wissenschaftler sind davon begeistert.
"Wenn sie das Wort Gen streichen, können sie gar keine Vorträge mehr über Genetik halten."
Der Wissenschaftshistoriker Ernst Peter Fischer aus Heidelberg würde gerne zu den Ursprüngen des Wortes "Gen" zurückkehren: genetisch - hervorbringend. Schon vor über zweihundert Jahren, also vor Mendels Erbsenexperimenten, benutzte Johann Wolfgang von Goethe das Wort in diesem Sinne, erklärt Fischer:
"Goethe wollte verstehen, wie sich Sachen bilden, wie sie Gestalt annehmen. Ich verstehe erst eine Pflanze, ein Lebewesen, wenn ich verstehe, wie seine Form zustande kommt. Und heute heißt die Frage: Wie kommt die Form zustande, wenn Gene in ihren Zellen eine Aktivität durchführen, und dann diverse variable Formen - bei Menschen sind das Finger, Nasen, Füße, Ohren - hervorbringen. Wie passiert das? Wie geht diese Differenzierung vor sich? Das ist nach wie vor die grundlegende Frage der Biologie. Und sie ist meiner Meinung nach so geheimnisvoll wie im 18. Jahrhundert."
In seinem neuen Buch "Die Verzauberung der Welt" stellt Ernst Peter Fischer eine romantische Sicht auf die Wissenschaft vor. Wissenschaft ist dabei keine Erklärmaschine. Sie liefert große Rätsel statt einfacher Antworten.
"Wenn Sie sich vorstellen - angenommen Sie wären so ein kleines Männchen - und Sie könnten mit Ihren Augen auf ein Gen gucken. Da sehen Sie nicht so ein Gen liegen, wie es im Lehrbuch dargestellt ist, sondern das wird umwirbelt von tausenden anderen Molekülen. Es ist umtost und umwoben - so stelle ich mir das jedenfalls vor. Und die Frage ist, wie diese ungeheure Dynamik so durchgeführt werden kann, dass zum Schluss doch etwas Stabiles herauskommt, wie ihr Körper oder meiner."
Sorgt eine kreative Sprache für neue Ideen?
Ernst Peter Fischer empfiehlt: Staunen statt Besserwisserei. Wenn einfache Antworten fehlten, sei das der beste Grund, um weiter zu forschen:
"Klar ist nur, dass sie nicht hergehen können, eine Zelle aufmachen können und sagen können: Zeig mir das Gen für die blauen Augen! Das gibt es nicht. Zeig mir das Gen für die Blütenstände! Das gibt es nicht. Gibt es alles nicht. Es gibt da ein Gewusel von Molekülen, eine zelluläre Dynamik, bei der überraschender-, erstaunlicher- oder wunderbarerweise immer das entsteht, was man das Leben nennt. Das Leben ist insofern eine unentwegte neue Schöpfung. Es ist genetisch."
Gene seien keine starren Programme, sie seien kreativ. Deshalb möchte Ernst Peter Fischer das Leben lieber mit Begriffen aus der Kunst beschreiben als mit Ausdrücken aus der Computertechnik. Eine kreative Sprache könne für neue Ideen sorgen, hofft er:
"Wenn da Tigergene sind, kommt immer ein Tiger heraus. Wenn Sie Affengene nehmen, kommt immer ein Affe heraus. Wenn Sie Menschengene habe, kommen Menschen heraus. Ja, aber es ist in der Kunst genauso. Wenn van Gogh malt, kommt immer ein van Gogh heraus. Wenn Rembrandt malt, kommt immer ein Rembrandt heraus. Wenn Michelangelo malt, kommt immer ein Michelangelo heraus, kein Leonardo. Das ist zwar jetzt nur angedeutet, aber ich glaube, dass man die Sprache der Kunst, die Entstehung der Kunstwerke übertragen kann, um die Leistungsfähigkeit und die Kreativität des genetischen Materials zu verstehen. Ich glaube nicht, dass Gene programmieren. Gene schaffen. Gene bilden."
Die meisten Wissenschaftler können mit dieser romantischen Betrachtung wenig anfangen. Statt wie Mendel oder Crick in einzelnen zählbaren Einheiten denken sie heute in Systemen. Ihr Credo: Wenn überhaupt, dann gelingt es mithilfe von Computern und Bioinformatik, das Durcheinander zu durchschauen und zu erklären. An die Stelle der Molekularbiologie tritt die Systembiologie. Die Gene spielen dabei zunehmend eine Nebenrolle. Sie sind nicht tot, aber ihre große Zeit geht 150 Jahre nach Mendel zu Ende. Der Wissenschaftshistoriker Prof. Rheinberger fasst zusammen:
"Das wäre meine Voraussage: Der Begriff des Gens wird nicht mehr so im Zentrum der Erforschung des Lebendigen stehen im 21. Jahrhundert, wie das für das 20. Jahrhundert der Fall war."