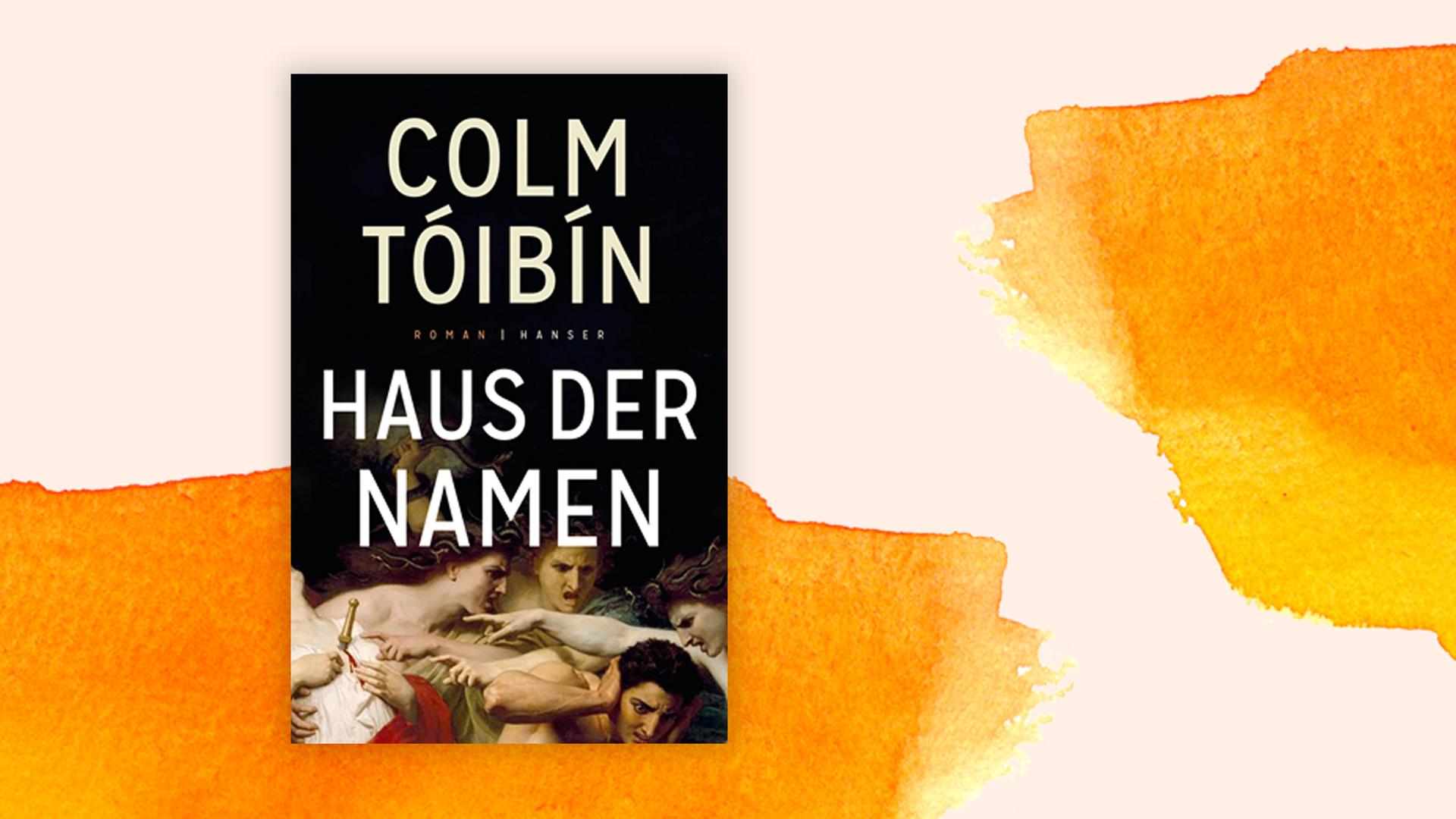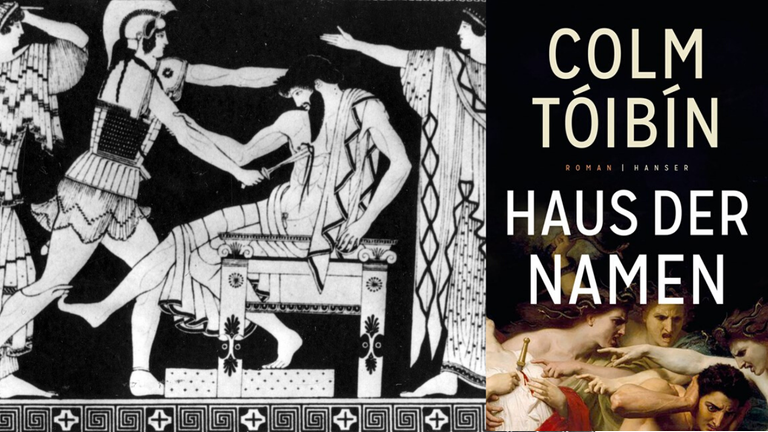
Am Vorabend des Trojanischen Krieges: Die griechische Flotte kann wegen einer Flaute nicht in See stechen. Glaubt man dem Mythos, dann hat die Göttin Artemis diese Windstille verhängt, weil Agamemnon sie mit seiner Selbstherrlichkeit verärgert hat. Nun wird ihm geweissagt, wenn er seine Tochter Iphigenia opfere, können die Griechen endlich Richtung Troja segeln. Es ist ein Tauschgeschäft: Kind gegen Wind.
Am Anfang: Die grausige Opferung der Tochter
Im ersten Kapitel des Romans lässt Colm Tóibín Agamemnons Frau Klytaimnestra die verhängnisvollen Ereignisse im Rückblick erzählen. Sie ist eine Betrogene: Agememnon hatte sie und Iphigenia unter dem Vorwand herbeigelockt, dass die Tochter den strahlenden jungen Krieger Achilleus heiraten sollte. Klytaimnestra hatte bereits freudig die Hochzeitsvorbereitungen getroffen, als sie erfuhr, dass Iphigenia mit dem Tod vermählt werden sollte. Die Mutter konnte diese Intrige ihres Ehemanns Agamemnon nur als hinterhältigen Verrat empfinden. Bei Tóibín wirkt Klytaimnestra in ihrer Erzählhaltung wie ein Mensch, der jäh aus seinem Weltvertrauen gerissen wurde. Mit dem Schock hat sie den Glauben an die Götter verloren. Von Agamemnons Rhetorik lässt sie sich nicht blenden:
"Solange er lebte, glaubten er und seine Männer, dass die Götter ihre Schicksale verfolgten und Anteil an ihnen nahmen. An jedem einzelnen von ihnen. (…) Ich weiß wie sonst niemand, dass die Götter uns fern sind – sie haben andere Belange. An menschlichen Wünschen und Possen nehmen sie ebenso Anteil wie ich an den Blättern eines Baumes."
Dass der Wind am Morgen nach dem grausamen Opfer tatsächlich dreht: Reine Glückssache. Das Opfer hat für Klytaimnestra damit nichts zu tun, und es ist in der Darstellung des Romans nur eine fürchterliche Schlächterei. Mit unheimlicher Intensität vermittelt Tóibín den Blut- und Todesgeruch rund um die Opferstätte, die mit den Innereien von Tieren übersät ist. Iphigenia fügt sich ihrer Opferrolle nicht. Sie will nicht sterben. Bis zum Schluss schreit und flucht sie und ist nur mit einem in den Mund gestopften alten Lappen zu bändigen.
Klytaimnestra wird zur rachsüchtigen Lady Macbeth
In Tóibíns Darstellung erweist sich Klytaimnestra fortan als Racheengel und gepeinigte Seele zugleich: eine Frau, die wie eine Lady Macbeth in den Gängen des Palastes umhergeistert, von Stimmen verfolgt, ungute Pläne schmiedend. Mit kaltem Hass wartet sie auf die Rückkehr ihres siegreichen Gatten Agamemnon, um ihn zu ermorden. Ihr Verbündeter ist der dämonische Aigisthos, den sie direkt aus den Verliesen des Palastes heraufholt in ihr Ehegemach. Ein gerissener, intriganter, zudem bedenklich triebstarker Mann, der bald wie ein Priapos unter den weiblichen Hausangestellten und männlichen Wächtern wildert.
Das zweite und wiederum sehr lange Kapitel des Romans ist – nun in der Er-Erzählform – dem Sohn Orestes gewidmet. Der potentiell gefährliche Stammhalter wird nach der Ermordung seines Vaters von seiner Mutter Klytaimnestra und Aigisthos aus dem Weg geschafft und verschleppt, gemeinsam mit Leandros, dem Spross einer unliebsamen Oberschichtsfamilie. Mit ihren Wächtern ziehen die halbwüchsigen Jungen durch ein unwirtliches, vom Krieg gezeichnetes Land:
"Die Leute in den Dörfern und Häusern am Weg hatten sichtlich Angst. Manchmal gab es Anzeichen dafür, dass ein Haus niedergebrannt worden war. Wenn sie irgendwo Essen verlangten, wurde es ihnen rasch gegeben, wenn sie um ein Obdach ersuchten, bekamen sie in einer Scheune oder einem Schuppen einen Platz zum Schlafen zugewiesen. Aber als sie weiterwanderten, wurden die Abstände zwischen den Dörfern größer, und viele der Häuser, an denen sie vorüberkamen, waren geplündert worden."
Orestes und Leandros können ihren Wächtern entkommen und finden Zuflucht in der äußersten Einöde, im Haus einer alten Frau am Ende einer Landzunge. Dort verbringen sie wie in einer Robinsonade mehrere Jahre, in denen sie zu Männern heranwachsen und nebenbei auch ihre Sexualität entdecken. Diese Episode wirkt wie ein homoerotisches Idyll in einer Welt der Schrecken und der Gewalt. Dieser starke, von Colm Tóibín hinzuerfundene Teil des Romans hat etwas Dunkel-Märchenhaftes.
Die familiäre Gewalt eskaliert zum Bürgerkrieg
Eines Tages kehrt Orestes in den Palast seiner Familie zurück – ein Störenfried, der damit rechnen muss, früher oder später von Aigisthos ausgeschaltet zu werden. Klytaimnestra hat ein Regime des Schweigens und Flüsterns etabliert. An das Vergangene, an die traumatischen Bluttaten soll nicht gerührt werden. Die verdüsterte, mit den Toten sprechende Elektra klagt:
"Sie hatte meinen Vater ermordet und seinen Leichnam in der Sonne verwesen lassen. Sie hatte mich und meinen Bruder in die Finsternis geschickt. Aber sie wollte, dass man das alles beiseiteschob, wie einen Teller nicht angerührtes, unappetitliches Essen."
So wird Orestes mit dem Geschehenen erst allmählich vertraut. Während sein Entschluss reift, seine eigene Mutter wegen des Vatermords zu töten, agiert sein Freund Leandros draußen im Land als Rebellenführer gegen die Gewaltherrschaft von Klytaimnestra und Aigisthos. Für seine Familie wird dies zum Verhängnis, denn Klytaimnestra lässt alle seine Angehörigen abschlachten, bis auf Ianthe, seine Schwester. In der grausigsten Szene des Romans befreit Orestes sie völlig verstört aus einem Stapel verwesender, von Maden wimmelnder Leichen.
Orestes und die – übrigens wie die Figur des Leandros von Tóibín hinzuerfundene – Ianthe kommen zusammen. Anders als im Mythos scheinen bei Tóibín am Ende der Gewaltspirale Liebe und ein neues Leben möglich zu sein. Nach eine Reihe gemeinsamer Nächte enthüllt Ianthe dem geliebten Orestes, dass sie schwanger sei. Dessen Freude weicht jedoch bald der brutalen Ernüchterung: Nicht er ist der Vater. Das Kind sei vielmehr die Frucht einer Mehrfachvergewaltigung durch die Schergen, die Ianthes Familienmitglieder dabei zum Zusehen zwangen, bevor sie sie allesamt ermordeten. Ianthe will Orestes nun aus eigenem Entschluss verlassen. Er hält sie zurück:
"Aber ich bin dein Mann. Ich will nicht, dass du gehst."
"Das Kindchen wirst du aber auch nicht wollen."
"Es ist das Kindchen, das in dir gewachsen ist. Es ist dein Kind."
"Aber es ist nicht deines."
"Es ist in dir gewachsen, während ich dich hielt. Es ist in der Nacht gewachsen, während du hier bei mir warst."
Auf anrührende Weise bekennt sich Orestes zu dem Kind der Missbrauchten, so dass der Bann des Bösen gebrochen und der Wiederholungszwang der Gewalt beendet scheint. In diesem Moment ist der Roman am weitesten von der Männlichkeit der antiken Haudrauf-Heroen entfernt. Orestes klingt hier wie der wohltemperierte, testosteronreduzierte und kooperative Mann, wie er heute vielerorts zum Leitbild geworden ist. In Tóibíns Roman wirkt das aber durchaus plausibel. Denn Orestes hat seinen Tribut an die Gewalt zu diesem Zeitpunkt längst reichlich geleistet, er hat Menschen mit Steinen erschlagen und seine eigene Mutter ermordet. Nun ist er des Tötens müde.
Mörder und Vergewaltigte werden ein Paar: Ein Happy End?!
"Aber ich kann nicht, wir können nicht, noch irgendjemanden verlieren. Es hat schon genug Tod gegeben."
Auch dieser schlichte Satz wirkt nicht aufgesetzt, wenn er am Ende eines Romans fällt, der bis dahin mit martialischer Gewaltdarstellung wahrlich nicht gegeizt hat.
Der Wucht der antiken Urtexte und dem hohen Ton vieler späterer dramatischer Bearbeitungen des Stoffes (etwa durch Gerhart Hauptmann) setzt Colm Tóibín den nüchternen Ton eines psychologischen und in der zweiten Hälfte bisweilen ein wenig zerredeten Familienromans entgegen. Den antiken Schicksalsbegriff ersetzt er allerdings nicht durch das Pathos der Freudschen Psychoanalyse, wie es Eugene O’Neill um 1930 in seiner berühmten Dramentrilogie "Trauer muss Elektra tragen" getan hat. Bei Tóibín gibt es keine unbewussten inneren Triebmächte, die das Verhängnis herbeiführen, nachdem die Metaphysik kollabiert ist.
Manche der Figuren haben den Glauben an die Götter, von denen im Roman kein einziger namentlich genannt wird, bereits ganz verloren, andere berufen sich noch auf sie, weil sich die hergebrachte Ordnung der Dinge damit stützen oder ein eigener Machtanspruch kaschieren lässt. Ansonsten ist der helle griechische Götterhimmel verdunkelt, und der Roman entwirft kontrastiv eine albtraumhafte Unterwelt der Gruben, Folterkeller und Verliese.
Die Götter sind in dieser Endzeit-Gesellschaft weit weg
Mit seiner schlicht gehaltenen Sprache und seinen ebenso unaufwändigen wie atmosphärischen Schilderungen führt Tóibín eine karge bronzezeitliche Welt vor Augen, die uns andererseits aber doch schon erstaunlich nahe ist, weil sie selbst bereits eine Spätzeit ist, eine Gesellschaft an der Abbruchkante des Mythischen. Bei einem so oft und so groß bearbeiteten Stoff kann eine neue Adaption sich leicht blamieren – Colm Tóibín aber ist mit seiner eigenwilligen Version der "Orestie" ein beeindruckender Roman gelungen.
Colm Tóibín: "Haus der Namen"
Aus dem Englischen von Giovanni und Ditte Bandini
Hanser Verlag, München. 288 Seiten, 24 Euro
Aus dem Englischen von Giovanni und Ditte Bandini
Hanser Verlag, München. 288 Seiten, 24 Euro