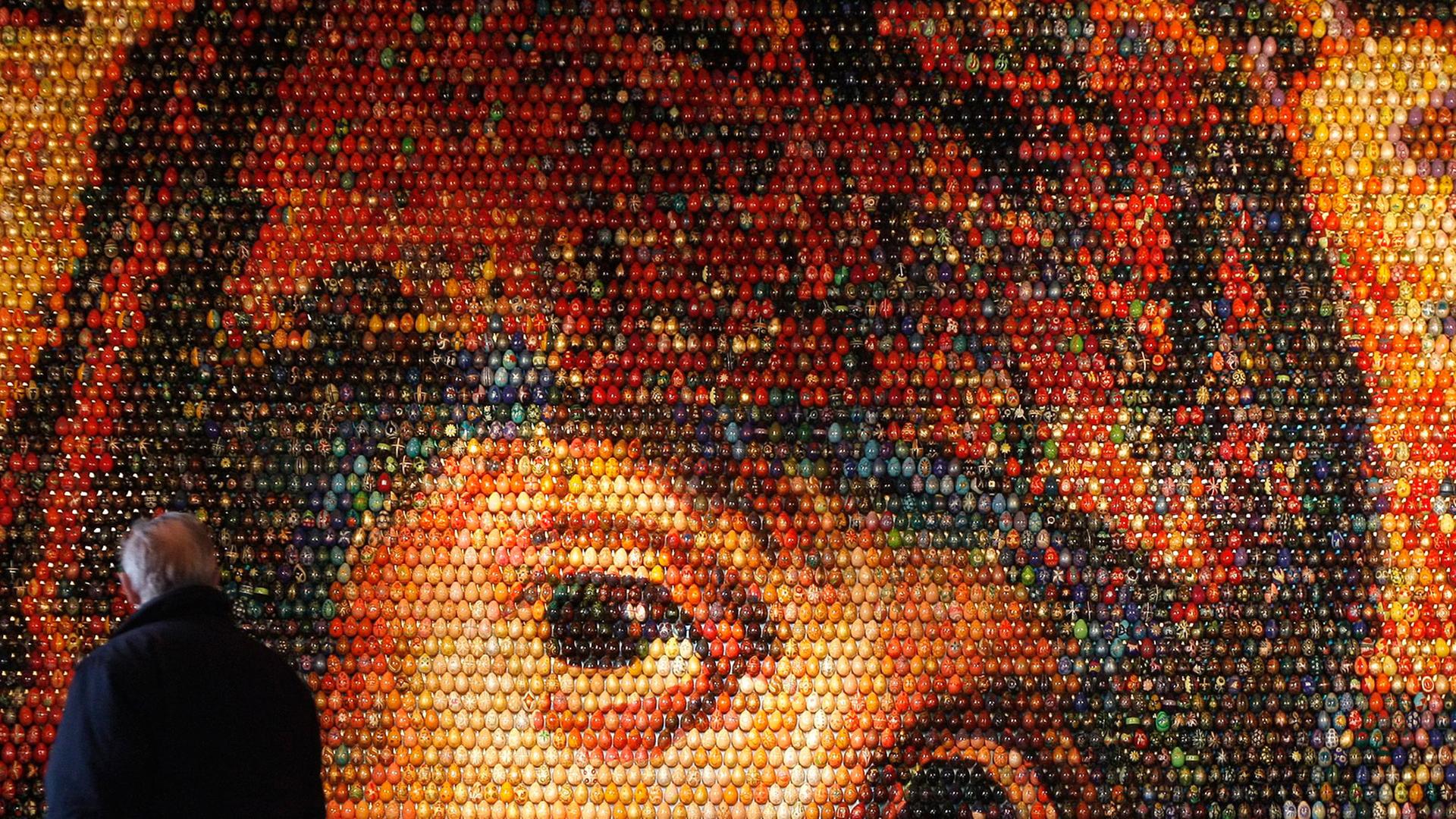Viele Romane münden in ein dramatisches Finale. Colm Tóibín macht es andersherum. Bevor der Roman überhaupt beginnt, hat das Drama bereits stattgefunden: Nora Websters Mann ist tot, und sie bleibt mit vier Kindern zurück. Auf fast vierhundert Seiten werden die Nachwirkungen der Familienkatastrophe erzählt. Langsam arbeitet sich die Mittvierzigerin aus der Dunkelheit heraus.
Ort der Handlung dieses Romans mit stark autobiografischem Hintergrund ist das provinzielle Irland der sechziger Jahre, genauer: Die Kleinstadt Enniscorthy, in der auch der 1955 geborene Colm Tóibín aufgewachsen ist. Die moralisch rigide Überwachungsgesellschaft, die eine frisch verwitwete Frau besonders fest ins Auge fasst, dazu der den Alltag prägende Katholizismus, der seine Herrschaft nicht nur auf die Kirchen, sondern auch auf die Schulen gründet – es ist eine Welt, die bisweilen weiter entfernt scheint als nur ein halbes Jahrhundert.
Als Witwe unter starker sozialer Kontrolle
Nora Webster jedenfalls wird durch den Tod ihres Mannes zum Beobachtungsfall. Wird sie gehörig trauern? Wird sie daran scheitern, die Familie mit vier Kindern weiter zu führen? Das Witwen-Schicksal vergesellschaftet Nora in einer Form, die die übliche soziale Kontrolle in Kleinstädten überschreitet.
"Aber bestimmt würde jemand, den sie kannte, sie sehen und ihr sein Mitgefühl aussprechen wollen. Die Worte waren leicht gesagt: "Es tut mir leid" oder "Es tut mir leid für Sie" oder "für dich". Sie sagten alle das Gleiche, aber für die Entgegnung gab es keine feststehende Formel. "Ich weiß" oder "Danke" klangen kalt, fast hohl. Und dann standen sie da und sahen sie an, bis sie es nicht mehr erwarten konnte, von ihnen wegzukommen. Es hatte etwas Hungriges, wie sie ihre Hand hielten oder ihr in die Augen sahen." (Zitat, S. 13)
In dieser Gesellschaft ist schon braun getöntes Haar ein Risiko. Nur deshalb kann so etwas Alltägliches wie Noras Gang zum Friseur aber auch zur prägnanten Romanszene werden:
"Draußen hielt sie den Kopf hoch und hoffte, dass sämtliche Frauen der Court Street am Herd standen und keine an der Tür. Sie betete darum, keinem, den sie kannte, über den Weg zu laufen. Sie ging im Geiste die schlimmstmöglichen Begegnungen durch, die Personen, die es am meisten missbilligen würden, dass sie, deren Mann gerade mal sechs Monate unter der Erde lag, sich die Haare in einer Farbe getönt hatte, die sie niemals besessen hatten." (Zitat, S. 70)
Wer nun aber vermutet, dass der Roman auf die alte Klage über die stickige Provinz hinauslaufe – so eindimensional erzählt Colm Tóibín zum Glück nicht. Seine eindringliche Darstellung des irischen Kleinstadtlebens ist zugleich eine erzählerische Liebeserklärung an die Welt, der er selbst entstammt und zu der er in seinen Werken immer wieder zurückkehrt. Er lässt im unscheinbaren Alltag Epiphanien aufscheinen, wie sein Landsmann und Vorbild James Joyce. Der Name Nora lässt ja nicht nur an die Heldin von Ibsens berühmtem Emanzipationsdrama denken, sondern auch an Nora Barnacle, die Ehefrau von Joyce. "Nora Webster" steht in der Tradition von dessen Erzählband "Dubliner", vor allem der berühmten Novelle "Die Toten".
Wenig tauglich für geläufige Emanzipationsbegrifflichkeit
Auch dass Nora wieder eine Arbeit findet, verdankt sich den Kleinstadtverhältnissen: Man hat sie im Blick, man erinnert sich an sie. In diesem Fall: Die Besitzer der Firma, für die sie schon als junge Frau gearbeitet hatte. Zwei Jahrzehnte ist es her, dass sie dort gekündigt hatte, als die Kinder geboren wurden. Damals hatte sie der Büroarbeit kein bisschen hinterhergetrauert. Vielmehr fand sie das Leben als Mutter und – heikles Wort – Hausfrau durchaus erfüllend, gerade weil es ihre Zeit nicht restlos ausfüllte und kontemplative Freiräume bot.
"Sie dachte an die Freiheit, die ihr die Ehe mit Maurice geschenkt hatte, die Freiheit, sobald die Kinder in der Schule waren, in dieses Zimmer zu gehen und sich ein Buch aus dem Regal zu nehmen und zu lesen; die Freiheit, jederzeit ins Wohnzimmer gehen und aus dem Fenster schauen zu können, in die Wolken am Himmel, und die Gedanken schweifen zu lassen. (...) Der Tag gehörte ihr. Nicht ein einziges Mal in den einundzwanzig Jahren, in denen sie diesen Haushalt führte, hatte sie einen Augenblick der Langeweile und der Frustration erlebt. Jetzt sollte ihr Tag ihr weggenommen werden (…) Die Aussicht wieder in diesem Büro arbeiten zu müssen, weckte in ihr die Erinnerung an eine Zeit des Eingesperrtseins (…) Ihre Jahre der Freiheit waren vorbei, so einfach war das." (Zitat, S. 66)
Ein solches Verständnis von Freiheit macht Nora Webster nun allerdings wenig tauglich für feministische Vereinnahmungen. Der Feminismus begreift sich von der Warte einer zum richtigen Bewusstsein gekommenen Gegenwart gern als Fortschrittsgeschichte: Stufe für Stufe führt demnach die Emanzipation durch die Jahrzehnte hinauf in die Beletage des selbstbestimmten weiblichen Lebens. Zu prüfen ist dann nur noch, auf welcher dieser Stufen eine weibliche Romanfigur vor einem halben Jahrhundert bereits ankommen durfte.
Nora Webster aber eignet sich kaum als Lichtgestalt der Emanzipation. Vielmehr geht der Roman hinter den feministischen Diskurs und die heute geläufige Emanzipationsbegrifflichkeit zurück und kann gerade deshalb umso einfühlsamer und unvoreingenommener die Selbstbehauptung einer Frau in der irischen Provinz der späten sechziger Jahre schildern. Das Berufsleben bringt Nora allerdings wenig Freude: Die Tratschereien und Rivalitäten im Büro sind schwer erträglich. Es gibt da eine alteingesessene Kollegin, die sie dermaßen reizt und quält, dass sie einmal kurz davor ist, mit der gezückten Schere auf den Bürodrachen loszugehen.
Suche nach Freiräumen
Das Kennzeichnende und Faszinierende an der Nora Webster-Figur ist ihre Suche nach Freiräumen, und seien sie noch so bescheiden. Einmal wagt sie es, ohne die vier Kinder Urlaub zu machen, an der spanischen Küste. Dort erlebt sie Glücksgefühle, wenn sie stundenlang alleine schwimmen und sich im wärmeren Meer treiben lassen kann. Allerdings leidet sie sehr unter ihrer Reisegefährtin, ihrer Tante Josie, mit der sie das Hotelzimmer teilen muss. Die Tante schnarcht wie ein Sägewerk, Nora kann nicht schlafen und ist nach einigen Tagen so zerschlagen, dass sie vorzeitig abreisen möchte. Einzelzimmer gibt es im Hotel nicht, aber schließlich bietet man ihr einen zellenartigen Verschlag im Keller an, mit kaum mehr als einer Matratze und einer nackten Glühbirne. Nora aber akzeptiert begeistert und schläft dort so genussvoll wie lange nicht mehr. Für sich sein – das ist es, wonach es sie verlangt.
Von Männern träumt sie nicht einmal
Melodramatik verweigert Colm Tóibín. Wer etwa darauf hofft, dass Noras Trauer durch eine neue Liebe aufgebrochen werde, wird die Handlung des Romans allzu dürr finden. Noras Lebensenergie wird vom Alltag verzehrt; von Männern träumt sie nicht einmal. Und als es dann doch zu einer einschneidenden Begegnung kommt, da handelt es sich nicht um einen charmanten Witwentröster, sondern um eine ältliche Musiklehrerin, die Nora Gesangsstunden gibt und die Liebe zur klassischen Musik in ihr weckt.
Musik als Neuanfang
"Es gab Leute in der Stadt, die fragen würden, was ihr eigentlich einfiel, Gesangsunterricht zu nehmen (…) Erst nach einem Monat, als sie vier oder fünf Unterrichtsstunden gehabt hatte, ging ihr auf, dass die Musik sie von Maurice, von ihrem Leben mit ihm fortführte. Aber es lag nicht lediglich daran, dass Maurice kein Ohr für Musik gehabt hatte und dass Musik etwas war, was sie niemals geteilt hatten. Es lag an der Intensität ihrer hier verbrachten Zeit; sie war allein mit sich an einem Ort, wohin er ihr niemals gefolgt wäre, nicht einmal im Tod." (Zitat, S. 254)
Musik als Neuanfang. Bald ist Nora Mitglied einer kleinen Grammophon-Gesellschaft, versprengte Bildungsbürger in der Provinz, die sich treffen, um neue Klassikplatten zu hören. Man könnte sich bei dieser kleinen Vinyl-Gemeinde an gewisse Loriot-Szenen erinnert fühlen, wären die musikalischen Fachsimpeleien nicht so rührend ernst beschrieben. Und irgendwann kennt auch Nora keine falsche Bescheidenheit mehr – und kauft sich selbst einen Plattenspieler. In den Momenten des Musikhörens, in denen sie ganz bei sich ist, rückt die Außenwelt von ihr weg, wie hinter eine gläserne Wand, sogar die eigene Familie und die Kinder.
"Als er die Schallplatte gefunden hatte, zeigte er Nora die Hülle. Darauf waren zwei junge Männer und eine Frau abgebildet. Die Frau war blond und deutete ein Lächeln an, ihr Gesicht verriet Kraft. Nora erkannte, dass die Frau die Cellistin war, und in dem Moment kam ihr der Gedanke, dass sie alles dafür gegeben hätte, die junge Frau auf der Plattenhülle zu sein, mit einem Cello neben sich (…) Während Dr. Radford die Schallplatte auflegte, dachte sie, dass es so leicht gewesen wäre, jemand anderes zu sein, dass die Jungs, die zu Hause auf sie warteten, und das Bett und die Lampe neben ihrem Bett, und am nächsten Morgen die Arbeit – dass all diese Dinge in gewisser Weise zufällige Umstände waren. Sie waren irgendwie weniger substanziell als die klaren Töne des Cellos, die aus den Boxen kamen." (Zitat, S. 265)
Kinder werden kaum zu eigenständigen Figuren
"Weniger substanziell" – dieser Schwund wirkt sich allerdings auch auf die Art aus, wie Noras Umgang mit den Kindern geschildert wird. Sie sind präsent, aber sie werden kaum zu wirklich eigenständigen Figuren, mit Ausnahme des Sohnes Donal, der am meisten unter dem Tod des Vaters leidet. Sein Stottern hat aber offenbar ebenso viel damit zu tun, dass Nora ihn gerade in den Monaten, als der Vater starb, im Stich gelassen hat. Damit die beiden Söhne die Qualen des Vaters nicht mitansehen mussten, hatte sie die Jungen längere Zeit bei Tante Josie auf dem Land untergebracht. So weit, so verständlich. Merkwürdig aber, dass sie sich während mehrerer Monate nicht ein einziges Mal bei ihnen meldete. Das wirkte verstörend auf die Jungen. Josie erinnert im Streitgespräch mit Nora an diese Wochen:
""Und es war still. Und sie dachten, du würdest vielleicht vorbeikommen, und du bist nicht gekommen. Manchmal brauchte nur ein Auto den Feldweg heraufzufahren oder auch nur auf der Straße zu halten, und die beiden haben sofort alles stehen und liegen lassen und die Ohren gespitzt. Und es zog sich immer mehr hin. Ich weiß nicht, was du dir gedacht hast, sie die ganze Zeit über hier zu lassen und nicht ein einziges Mal nach ihnen zu sehen."
"Maurice lag im Sterben", sagte Nora. "Conor hat fast jede Nacht ins Bett gemacht. Ich weiß nicht, was du dir dabei gedacht hast, sie die ganze Zeit hier zu lassen", wiederholte Josie."" (Zitat, S. 60)
"Maurice lag im Sterben", sagte Nora. "Conor hat fast jede Nacht ins Bett gemacht. Ich weiß nicht, was du dir dabei gedacht hast, sie die ganze Zeit hier zu lassen", wiederholte Josie."" (Zitat, S. 60)
Ur-Szenen der Verlassenheit
Hier ist ein autobiografischer Schmerzpunkt berührt. In seiner Erzählung "Eins minus eins" hat Tóibín beschrieben, wie er als Zehnjähriger mit seinem jüngeren Bruder für längere Zeit bei einer Tante wohnen musste. Sein Vater war todkrank – und seine Mutter verhielt sich wie Nora Webster. Diese Kälte sorgte dafür, dass sich der Sohn von der Mutter entfremdete und verschlossener wurde. Und er entwickelte sich zu einem scharfen Beobachter von Müttern.
"Väter und Söhne" – das ist ein Klassiker, eine viel erprobte Thematik. "Mütter und Söhne" eher nicht. Die Mutterbindung ist mit einer gewissen Peinlichkeit belastet. In den Werken Tóibíns aber sind die Mütter die Hauptgestalten, und es sind Ur-Szenen der Verlassenheit, die der Autor in der Grundkonstellation seines Erzählens immer wieder durchspielt.
"Mütter und Söhne" – so heißt auch einer seiner Erzählbände; die darin enthaltene grandiose Novelle "Ein langer Winter" spielt in den spanischen Bergen und schildert archetypisch das Verschwinden einer Mutter. Sie verlässt nach einem Familienstreit auf der Suche nach Alkohol das Haus und gerät in einen Schneesturm. Erst nach einem langen Winter der verzweifelten Suche, als es im Frühjahr zu tauen beginnt, weisen die Geier die Spur zu ihrer Leiche.
Gezügelte Dramatik
Verglichen mit der Wucht dieser Meistererzählung erscheint der Roman "Nora Webster" von gezügelter Dramatik. Und es ist ein Buch, das in seinem Verlauf hoffnungsvoller wird. Noras vier Kinder gehen ihren Weg. Der Stotterer Donal zieht sich in die Dunkelkammer zurück und kommt als Foto-Freak wieder heraus. Mit der Kamera vor Augen wagt er es, wieder auf die Welt zuzugehen. Weil ihm die Schule, an der der Vater ein geschätzter Lehrer war, verleidet ist und er der Rolle als bemitleidete Halbwaise entrinnen will, lässt er sich überreden, auf ein Internat zu wechseln, was ihn und Nora allerdings vor neue Herausforderungen stellt und andere Ängste und Frustrationen mit sich bringt.
Die älteste Tochter Fiona schafft unterdessen ihr Examen als Lehrerin, ihre Schwester Aine engagiert sich politisch im brodelnden Dublin – die irischen Unruhen, die 1972 im "Bloody Sunday" münden, haben begonnen. Die Fernsehbilder von englischen Polizisten, die irische Demonstranten niederknüppeln oder niederschießen, sind ein immer drängenderes Gesprächsthema auch unter den Menschen in der Provinz.
Bemerkenswerterweise unternimmt der Roman nur wenige Rückblenden in die glücklichen Jahre mit Maurice. Wenn überhaupt, sind es fast ausschließlich schreckliche Erinnerungen, die Nora heimsuchen, die Szenen seines qualvollen Sterbens:
"Der Tod aber kam und kam nicht. Und Maurice hatte solche Schmerzen, dass es fast gefährlich war, nach seiner ausgestreckten Hand zu greifen, weil er so fest zupackte. Er war noch nie so lebendig gewesen wie da, dachte sie, durch seine Bedürfnisse und seine Panik und Angst und die Schmerzen, die in ihm zu brennen schienen, bis er wie ein brüllendes Tier war und man ihn nicht nur auf dem Korridor, sogar noch an der Pforte des Krankenhauses hören konnte." (Zitat, S. 94)
Wut auf Autoritäten
Diese Erfahrung hat bei Nora eine heftige Wut auf den behandelnden Arzt hinterlassen. Der wollte Maurice keine starken Schmerzmittel geben, weil sie sein schwaches Herz weiter hätten schädigen können.
"Er wusste nichts über Schmerzen und Tod, und sie erinnerte sich jetzt, dass er meist in einem Ton zu ihr gesprochen hatte, als würde sie einem äußerst beschäftigten Mann die Zeit stehlen. Sie empfand einen abgrundtiefen, regen Hass auf ihn, und sie kostete das Gefühl wie ein seltsames Vergnügen aus." (Zitat, S. 95)
Dieser Arzt ist eine der Autoritätsfiguren, gegen die Nora sich allmählich zu behaupten lernt. Damit spiegelt ihr Verhalten auch den Zug der Zeit, die um 1970 allerorten Autoritäten infrage stellte, sogar im erzkatholischen Irland. Nora lehnt den kirchlichen Zugriff auf ihre Existenz ab, sie tritt, initiiert von einem resoluten Lastwagenfahrer, in die Gewerkschaft ein, ein rotes Tuch für ihren Chef, der zuverlässig mit einem Wutausbruch reagiert. Und sie protestiert gegen Lehrerwillkür. Als ihr Sohn Conor in der Schule herabgestuft wird, sucht Nora die Konfrontation mit dem Schulleiter und schreibt an alle Lehrer einen geharnischten Brief:
"Wie Ihnen vielleicht bekannt ist, wurde mein Sohn Conor Webster, der die fünfte Klasse der Grundschule besucht, ohne Angabe von Gründen von der A- in die B-Klasse versetzt. Wie Ihnen ebenfalls bekannt sein dürfte, wäre das nicht geschehen, wenn sein Vater noch am Leben wäre und an der Schule unterrichtete. Hiermit setze ich Sie darüber in Kenntnis, dass ich nicht gedenke, dieses Vorgehen zu akzeptieren. Wenn Conor nicht spätestens nächsten Freitag wieder in der A-Klasse ist, werde ich vor der Schule eine Blockade durchführen. Hochachtungsvoll, Nora Webster." (Zitat, S. 282)
Nora verspricht jeden Lehrer, der ihre Blockade zu umgehen wage, mit einem kräftigen "Witwenfluch" zu belegen, was im katholischen Milieu durchaus Eindruck macht. Eine "starke Frau" – nein, diese Floskel über die Heldinnen von Fernsehfilmen wollen wir uns hier lieber sparen, zu eigenwillig ist Noras Verhalten. Als es im nordirischen Derry zu schweren Unruhen kommt, meint sie scharf:
""Wenn ich die Mutter eines dieser erschossenen Jungen wäre, würde ich mir eine Pistole besorgen. Ich hätte eine Pistole im Haus."" (Zitat)
Massive Lücke durch den Tod des Ehemanns
Auf hintergründige Art ist "Nora Webster" dann aber doch auch ein Liebesroman. Denn die Ehe mit Maurice muss überdurchschnittlich gut gewesen sein. Das vermittelt der Roman, ohne jedoch Szenen einer gelungenen Ehe in längeren Rückblicken vorzuführen. Der Abwesende, dessen Tod als bestimmendes Ereignis über den beschriebenen drei Jahren lastet, soll auch erzählerisch abwesend bleiben und nicht als Romanfigur auf einer anderen Zeitebene gleichsam reanimiert werden. So erscheint die Lücke, die der Tod gerissen hat, noch massiver. Erst ganz am Ende hat Maurice einen kleinen Auftritt:
Plötzlich rumpelt es in einem Zimmer oben, obwohl niemand außer Nora im Haus ist; sie geht der Sache nach, und im Schlafzimmer sitzt Maurice wie zu Lebzeiten im Sessel. Was nach dem überaus bodenständigen Alltagsrealismus der vorhergehenden 350 Seiten wie ein Einbruch des Phantastischen wirken könnte, lässt sich auch rational erklären. Nora steht zu dieser Zeit unter starken Schmerzmitteln und Schlaftabletten, sie hat eine Woche lang kaum geschlafen und mag mitten am Tag ein paar Minuten aus der Realität ins Traumhafte geglitten sein. Allerdings prägt sich ihr diese surreale Begegnung tief ein; erst jetzt wird sie fähig zum Abschied.
Nora Webster - eine Figur, die man nicht vergisst
Womöglich ist es der autobiografische Hintergrund bei diesem Porträt der eigenen Mutter, der dem großen Erzähler Colm Tóibín bisweilen ein wenig die Zügel aus der Hand gleiten lässt. Der Roman leidet vor allem in der ersten Hälfte unter einigen Längen und schwächeren Szenen. Dann aber – und je mehr Nora ihren Trauerschock überwindet und zur handelnden Figur wird – setzt sich die Qualität von Tóibíns eindringlicher Erzählweise durch. Nora Webster ist ein weiteres Beispiel für seine große Kunst der Frauendarstellung; sie ist eine Figur, die man nicht vergisst.
Colm Tóibín: Nora Webster. Roman. Aus dem Englischen von Giovanni und Ditte Bandini. Carl Hanser Verlag, München 2016, 383 S., 26 Euro