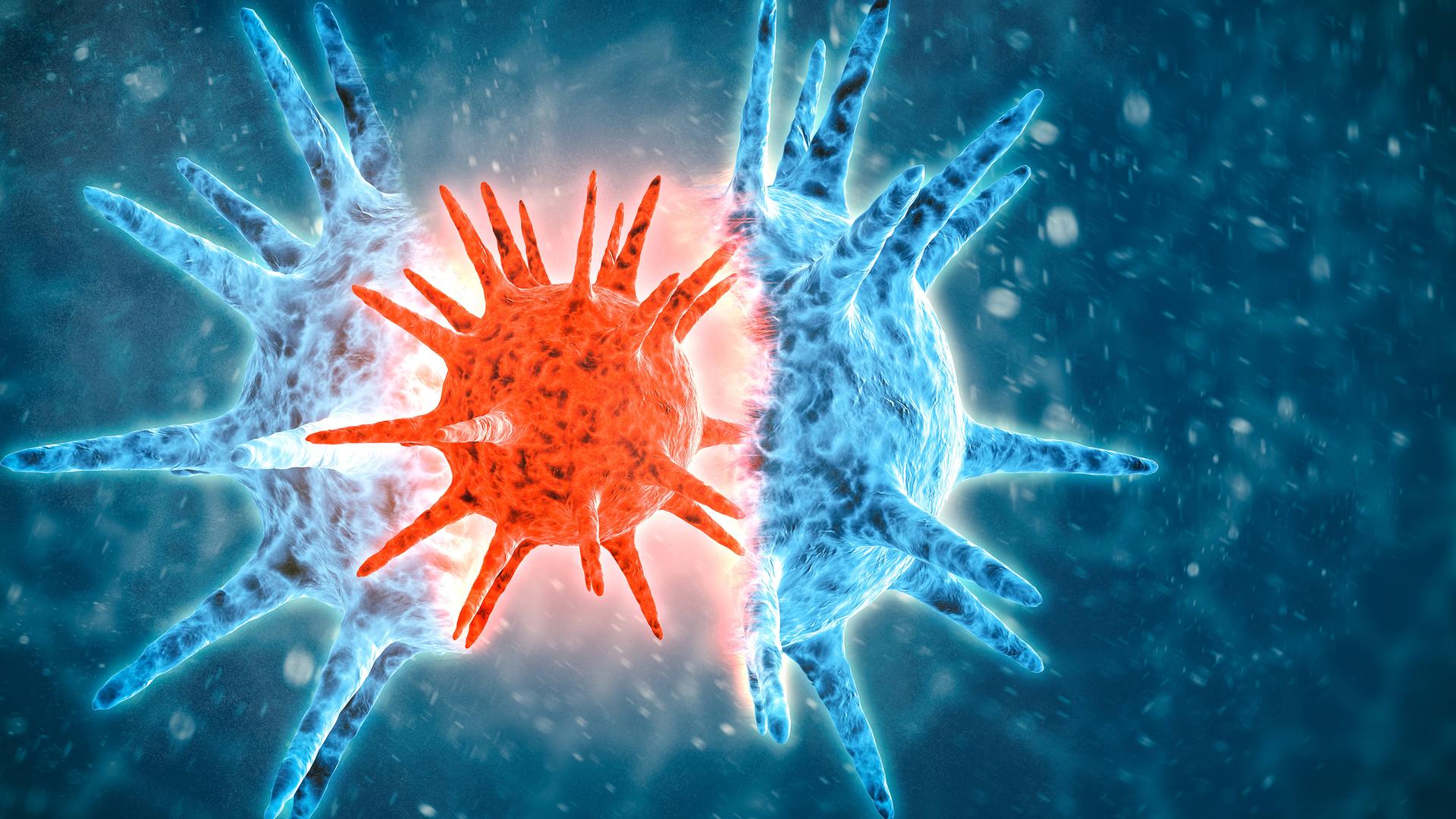"Wenn Restaurants zumachen, finde ich das unmöglich. Alles andere ist mir auch egal. Aber gerade jetzt zur Gänsezeit, alle Lokale zu."
"Das ist in Ordnung. Ich akzeptier das absolut. Wir müssen bloß jetzt gesellschaftlich eben alle am selben Strang ziehen. Und das ist offensichtlich noch immer nicht der Fall. Einige haben es immer noch nicht verstanden."
Kritik an der Effizienz der Corona-Maßnahmen
Kurz nach Bekanntgabe des zweiten Teil-Lockdowns in Deutschland ist nicht nur die Bevölkerung, sondern auch die wissenschaftliche Welt darüber geteilter Meinung. Christiane Woopen, Professorin für Ethik und Theorie der Medizin an der Uni Köln, hält die neuerlichen Einschränkungen zwar für richtig, kritisierte aber am Rande der von der Hamburger Akademie der Wissenschaften veranstalteten Tagung "Infektionen und Gesellschaft" ihre Effizienz:
"Es scheint mir im Moment unplausibel zu sein, dass wenn wir von viel mehr Zahlen ausgehen als im März, wenn wir weniger einschneidende Maßnahmen ergreifen als im März, wenn die Bedingungen für die Infektiosität schlechter sind als im März, Stichwort kalte Jahreszeiten, Innenräume etc., dass dann die Situation in kürzerer Zeit als im März bewältigt werden soll - also warum wir nach vier Wochen in einer so anderen Situation sein sollen, dass dann auch diese jetzt ergriffenen Maßnahmen wieder zurückgenommen werden können, erschließt sich mir noch nicht."
Die Vorsitzende des Europäischen Ethikrates fordert stärkere präventive Anstrengungen, um weitere Infektionswellen zu verhindern. Einerseits baut sie auf den gesteigerten Einsatz von Schnelltests und neuen Geräten, die jeder bei sich tragen könnte, um Infektionsherde zu lokalisieren.

Abwägung zwischen Freiheit und Gesundheit
Andererseits gelte es, die Wissenslücken zu schließen, wo und auf welche Weise die Übertragung des Virus stattfindet. Dann erst ließen sich die Anti-Corona-Maßnahmen zielgerichtet anwenden, was nicht zuletzt eine ethische Frage sei:
"Ethisch geht es um die Abwägung zwischen Freiheit und Gesundheit – und auch Freiheit und Leben. Natürlich auch die Abwägung dazwischen, was das wirtschaftlich für Folgen hat. Aber es geht auch um die Abwägung von Gesundheit gegen Gesundheit, denn es geht ja nicht nur um die Gesundheit der Menschen, die an COVID-19 erkranken und schwer erkranken, sondern auch um die Gesundheit derjenigen, die massive Eingriffe in ihr Leben ertragen müssen, seien es dann psychische Erkrankungen, die entstehen können, Abhängigkeiten, Verzweiflung, Vereinsamung oder auch existentielle Bedrohung in beruflicher Hinsicht."
"Gastronomie und Hotellerie - weil ich selbst Touristiker bin - haben ja wahnsinnig viel gemacht, viel Geld investiert, und dass dann doch jetzt wieder vier Wochen alles im Lockdown ist. Meine Kreuzfahrten im Dezember sind jetzt noch abgesagt worden, Flußkreuzfahrten. Für die Psyche ist es ganz schön schlimm, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Die ganzen Kollateralschäden, die dadurch entstehen, ich glaube, die sind noch nicht absehbar."
Folgen der sozialen Distanz
Mit den Folgen des sogenannten Social Distancing - also Abstand halten, größere Gruppen meiden, Schule, Uni oder Arbeitsplatz den Rücken kehren - beschäftigt sich Prof. Tania Lincoln. Dabei kann sich die Leiterin des Arbeitsbereichs Klinische Psychologie und Psychotherapie an der Uni Hamburg auf ältere Studien stützen. Bereits während der Sars- und der Ebola-Pandemie wurde das psychische Wohlbefinden von Menschen, die unter Quarantäne standen, untersucht.
"Die allermeisten Studien finden schon deutliche psychische Folgen, also Schlaf- und Konzentrationsprobleme, Erschöpfung, Depression, Alkoholmissbrauch – bis hin zu auch Suizidalität, aber auch sowas wie dass Leute ein zwanghaftes Vermeidungsverhalten entwickeln, dass sie danach gar nicht mehr so sozial aktiv sind oder dass sie so obsessives Händewaschen entwickeln."
Diese Folgen zeigten sich nach früheren Epidemien besonders bei den Jüngeren, bei Frauen und bei Menschen mit geringerem Einkommen sowie mit psychischen Vorbelastungen. Außerdem verstärkten eine lange Quarantäne, widersprüchliche Informationen und eine fehlende Tagesstruktur die psychische Belastung.
"Für mich persönlich ist es okay, ist es in Ordnung. Ich kann mich durchaus in meinen vier Wänden den ganzen Tag beschäftigen, unterhalten - ich habe da keine Langeweile."
Social Distancing verstärkt Einsamkeit
In Lincolns Abteilung läuft seit März eine Studie zur Reduktion sozialer Kontakte während der Corona-Pandemie. An der Online-Befragung nahmen zunächst mehr als 400, meist jüngere Menschen teil, viele davon Studenten. Wie wirkte sich das Social Distancing bei ihnen beruflich und finanziell, wie innerhalb der Familien aus? Es habe sich gezeigt, dass "diejenigen, die schon zu Beginn einsam waren, dass es für die einen stärkeren Effekt hatte, also dass es denen schlechter ging durch die weitere Reduktion der sozialen Kontakte. Aber gleichzeitig diejenigen, die zu Beginn das Gegenteil von einsam waren, die sehr viel Kontakt hatten, sehr eingebunden waren, dass es denen tatsächlich durch diese Reduktion ein bisschen besser ging."
"Es ist nicht schlecht, mal wieder ein bisschen in sich zu horchen und sich so ein bisschen zurückzuziehen. Davon halte ich viel, generell, aber das muss nicht durch eine Politik bestimmt werden."
Tania Lincoln zeigt sich wenig überrascht, dass die Folgen der Maßnahmen diesmal weniger dramatisch als bei früheren Epidemien sind. Krisen würden normalerweise nur Einzelne oder bestimmte Gruppen treffen. Jetzt treffe es alle, und geteiltes Leid sei leichter zu bewältigen. Außerdem sei der zweite Lockdown vergleichsweise mild.
"Die meisten Menschen sind schon recht resilient, können solche Krisen gut bewältigen, und solange man doch noch einige Freunde oder Familienangehörige treffen kann und auch über andere Medien kommunizieren kann und dadurch ja auch Kontakte aufrechterhalten werden, denke ich, dass es nicht ja so dramatisch ist. Was anderes ist, wenn Leute ihre Lebensgrundlage verlieren, ihren Job verlieren, finanziell sehr belastet werden, da hat man natürlich schon da Folgen. Und ich glaube, das sind Folgen, die werden wir jetzt erst noch sehen."
Erfahrungen aus früheren Pandemien
Heinrich Heine am 19. April 1832 in der "Augsburger Allgemeine Zeitung" über die Cholera-Epidemie: "Man soll, haben ihnen die Ärzte gesagt, keine Furcht haben und jeden Ärger vermeiden; nun aber fürchten sie, dass sie sich mal unversehens ärgern möchten, und ärgern sich wieder, dass sie deshalb Furcht hatten. Mit zitternden Augen fragen sie jede Stunde nach der Zahl der Toten. Dass man diese Zahl nie genau wusste, oder vielmehr, dass man von der Unrichtigkeit der ausgegebenen Zahl überzeugt war, füllte die Gemüter mit vagem Schrecken und steigerte die Angst ins Unermeßliche. In der Tat, die Journale haben seitdem eingestanden, dass in einem Tage, nämlich den zehnten April, an die 2.000 Menschen gestorben sind."
Gesellschaften greifen zur Bewältigung einer Pandemie auf frühere Erfahrungen zurück. Das sei schon in Zeiten der Cholera so gewesen, sagt der Medizinhistoriker Prof. Philipp Osten:
"Als die Cholera in den 1830er-Jahren neu auftrat, hat man die versucht zu beobachten, wie man Pest-Epidemie beobachtet hat. Indem man nämlich geguckt hat, wie verbreitet sich diese Krankheit. Was aber damals schon neu war, ist, dass man sehr genau Statistik geführt hat und aufgezeichnet hat, wo sind Patientinnen und Patienten gestorben? Wie lang hat das gedauert vom Auftreten der ersten Infektionssymptome? Die Statistik war ja für Europa neu. Das ist der große Fortschritt, den wir in den 1830er-Jahren sehen. Und bei der Cholera hat sich das wirklich sehr gut bewährt."

Während der Cholera-Pandemie änderte sich die Medienwelt entscheidend
Dies ging mit einem starken Medienwandel einher, betont der Direktor des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf. Vor 1800 hätte weniger als die Hälfte der Bevölkerung lesen können, und die Informationen liefen während des Gottesdienstes über die Kanzel.
Als 1830 die Cholera erstmals durch Europa zog, hätten bereits viele Menschen lesen können.
"Es sind viele, viele Zeitschriften und Zeitungen entstanden, und gleichzeitig entsteht ein Boom der Verlage. In der Berliner Staatsbibliothek oder auch in der Würzburger Universitätsbibliothek oder auch in Hamburg finden sich hunderte unterschiedlicher, innerhalb kürzester Zeit erschienener Cholera-Schriften. Das sind Ratgeber-Schriften, aber auch Schriften, die darüber spekulieren, woher die Cholera kommt. Das war ein riesengroßes Geschäft. Und tatsächlich haben staatliche Stellen diese Schriften angekauft natürlich aus der Angst, irgendetwas zu verpassen."
Die Frage, wie eine Pandemie der Öffentlichkeit vermittelt wird, interessiert auch den Medizinethiker und -historiker Prof. Heinz-Peter Schmiedebach. Denn einerseits sei nur ein Bruchteil der Bevölkerung von der Krankheit selbst betroffen. Andererseits sei die mediale Landschaft heute so zersplittert, dass es schwierig sei, den Großteil der Bevölkerung überhaupt zu erreichen.
"Was halten Sie denn von dem neuen Lockdown?" - "Ehrlich gesagt, wusste ich gar nicht, dass es den gleich geben wird. Ab wann soll der stattfinden?"
Heinz-Peter Schmiedebach : "Die Gefahr, dass eine Pandemie, ein Infektionsgeschehen, dessen biologische, medizinische und ökonomische Auswirkungen nur einen relativ kleineren Teil der Bevölkerung betreffen, während der Rest das Ganze nur im Zusammenhang mit Verordnungen, Diskussionen, Talkshows, medialen Berichten erfährt, die Gefahr, dass sich gewissermaßen eine Metaebene im Bereich des Kommunikativen darstellt, in dem die Seuche eigentlich viel mehr präsent ist als im biologisch-medizinischen Bereich, diese Gefahr besteht."
Pandemien gehen mit Ausgrenzung einzelner Gruppen einher
Das geht so weit, dass von einer Pandemie betroffene Gesellschaften diese funktionalisieren, um sich bestimmter Werte zu vergewissern und zugleich das, was anders und fremd ist, auszugrenzen. Schmiedebach spricht von einer sozialanthropologischen Konstante, die sich seit Jahrhunderten beobachten lasse.
In den 1980er-Jahren wurden in der Hochzeit von Aids Homosexuelle stigmatisiert. Heute gelte die Klubkultur als Sünden- und Seuchenbabel.
"In der gegenwärtigen Pandemie war das Fremde erst einmal in China. Und innerhalb weniger Monate war das dann auf einmal zwischen Ostprignitz und Berlin, und man durfte da nicht mehr hin. Da gibt es kolossale Dynamiken, wenn man diese Ortszuschreibungen im Zusammenhang mit dem Wir und dem Anderen, also der Andere immer als fremd und gefährlich aufgefasst, betrachtet."
Wettbewerb politischer Systeme im Kampf gegen Pandemien
Der Umgang mit Seuchen spielt unweigerlich eine Rolle im Wettbewerb unterschiedlicher politischer Systeme. Länder konkurrieren dabei etwa um die wirksamsten Maßnahmen gegen eine Ansteckung.
"Und es gibt unzählige Beispiele, Sümpfetrockenlegung, Malariabekämpfung. Wenn wir schauen, wie schnell es gelungen ist, in Wuhan innerhalb von zehn Tagen ein Krankenhaus mit 1.000 Betten hochzuziehen, dann ist das ein Ausdruck dafür, dass ein autokratisches, nicht-demokratisches System über Entscheidungen und Durchsetzungen ganz, ganz schnell ein hocheffektives Mittel finden kann, um die Seuche zu bekämpfen."
Auch ganz konkret schlägt sich die Corona-Pandemie nieder – etwa darin, wie über die Entwicklung von Städten nachgedacht wird. Auf die seit einiger Zeit diskutierte Forderung, das Leben in der Stadt gesünder zu gestalten, wirke die aktuelle Krise wie ein Katalysator und verstärke diesen Trend, stellt Prof. Jürgen Oßenbrügge, Wirtschaftsgeograf an der Uni Hamburg, fest:
"Wenn wir zu Hause bleiben sollen und zu Hause bleiben müssen, dann wird vor allen Dingen der Aspekt der Wohnung und des Wohnumfeldes besonders wichtig und kriegt eine besondere Beachtung. Dies ist eigentlich schon im Kontext der gesunden Stadt mit Raumklima, Zugang zu Garten, Zugang zu einem Balkon schon immer thematisiert worden. Aber wir haben plötzlich bemerkt, wie wichtig eigentlich diese Dinge werden können."

Corona-Krise wirkt sich bereits auf Diskurs um Stadtentwicklung aus
Auch die Bedeutung eines Zugangs zur blauen und grünen Infrastruktur; Grünanlagen und Parks, Flüsse und Seen innerhalb kurzer Zeit erreichen zu können, sei in der Zeit des Lockdowns deutlich geworden.
Die Pandemie habe jedoch wie ein Brennglas vor Augen geführt, dass dieses längst nicht auf alle städtischen Wohngebiete zutreffe. Oßenbrügge spricht von Pandemiegettos, deren Bewohner gleich auf dreifache Weise benachteiligt seien:
"Benachteiligung durch sozioökonomische Ungleichheiten, besondere Lärmbelastung, manchmal gekoppelt auch mit Luftbelastung und den Zwang zu Hause zu bleiben. Wenn man sich dieses mal in einer Großwohnsiedlung vorstellt, dann weiß man schon, dass da eine ziemliche Problemverschärfung vorhanden ist. Damit sind eigentlich auch solche Auseinandersetzungen, wie sie teilweise aus Berlin oder aus Göttingen berichtet worden sind, die sind leicht nachvollziehbar: Dass Menschen dort in ihren Blocks eingesperrt worden sind, dass das nicht gutgehen kann, das ist eigentlich klar."
Rückschlag für den öffentlichen Nahverkehr
Die Corona-Pandemie führt in der Stadtentwicklung aber auch zu neuen Bewertungen. In den beliebten und teuren Innenstädten droht sich der Leerstand infolge von Homeoffice, ungenutzter Büroräume und zunehmenden Einkäufen im Internet zu verschärfen. Folge könnte eine erneute Suburbanisierung sein, mutmaßt Jürgen Oßenbrügge.
Die Mobilität hat das neue Virus bereits verändert - und zu einer paradoxen Situation geführt. Standen vor Corona außer dem öffentlichen Nahverkehr auch die "Walkability" und "Bikeability", also die Erreichbarkeit zu Fuß und per Fahrrad, hoch im Kurs, scheint zunächst wieder das Auto als Schutzraum vor Infektionen den Bussen und U-Bahnen überlegen.
"Insofern haben wir tatsächlich so eine Art von Auseinanderentwicklung. Und inwieweit der öffentliche Verkehr eigentlich seine frühere Rolle und seine zukünftige Rolle als ein Hauptverkehrsträger einnehmen kann, das ist derzeit sicherlich noch offen. Da hat der Verlauf der Pandemie eigentlich viele zum Nachdenken gebracht."