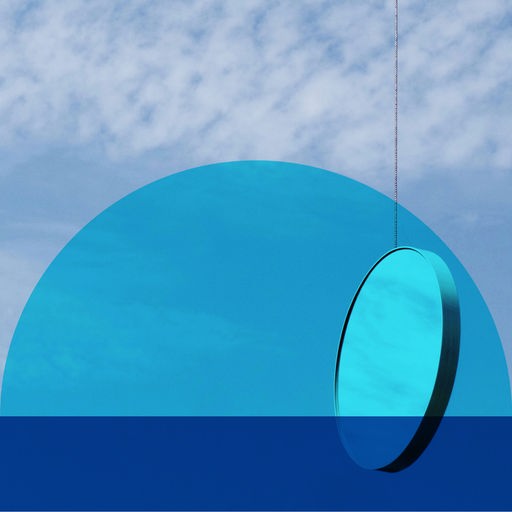Wer die Bedeutung kultureller Unterschiede unterschätzt und davon träumt, Traditionen abzuwerfen, um eine neue unbelastete Menschheitsfamilie zu gründen, leitet unwillentlich Wasser auf die Mühlen von Nationalisten, Identitären, Kulturchauvinisten und Ethnopluralisten. Die Geschichte der westlichen Moderne hat gezeigt, dass gut gemeintes Einheitsstreben zuverlässig ein aggressives Begehren nach Abgrenzung und kultureller Identität weckt. Für ein Miteinander in Vielfalt ist stattdessen kluges Differenzmanagement im Sinne des Philosophen John Rawls förderlich. Weder kulturelle Einheit noch Multikulti, sondern überlappender Konsens ist das Ziel. Dafür müssen kulturelle Eigenheiten und Traditionen nicht aufgegeben werden. Auch eine Leitkultur ist überflüssig. Unerlässlich ist hingegen eine gemeinsame Gerechtigkeitsvorstellung, die für Fairness in der Vielfalt sorgt.
Jörg Scheller ist Dozent für Kunstgeschichte und Kulturtheorie an der Zürcher Hochschule der Künste und Journalist. Nebenbei betreibt er einen Heavy-Metal-Lieferservice mit dem Metal-Duo Malmzeit.
Dieser Essay beschließt die Feature-Reihe "Expeditionen", die im Januar immer freitags ausgestrahlt wurde und Reisen unter anderem zu den Nenzen in die russische Arktis oder zu den Tenharim in den südwestlichen Regenwald unternommen hat.
Wird die Bedeutung kultureller Unterschiede nicht hoffnungslos überschätzt? Tatsächlich könnte es mitunter so scheinen, als sei all unser kleinteiliges Kulturtamtam verzichtbar und stünde einem wirklichen, einem universellen Fortschritt im Wege.
Heute prägt zwar jeder Mensch mindestens ein neues Mikro-Subgenre elektronischer Musik, hütet jedes Dorf das Geheimnis einer einmaligen Blauschimmelkäsesorte, muss sich jedes Land allein schon aus touristischen Sachzwängen rühmen, einen unvergleichlichen Renaissance-Gelehrten hervorgebracht zu haben. Aber eigentlich wollen die Menschen überall auf der Welt doch vor allem - essen, trinken, schlafen, sich paaren und auf dem Smartphone daddeln. Manchmal tragen sie die Haare dazu lang, manchmal kurz, manchmal fallen sie auf kommunistische Schlangenölverkäufer, manchmal auf kapitalistische herein. Die einen nennen ihre schwer verdaulichen Teigwaren Pieroggen, die anderen Maultaschen, manche glauben an ein Leben nach dem Tod, andere sogar an eines vor dem Tod.
Der Westen braucht das Archaische als kitschiges Zerrbild
All das, könnte man meinen, ist nichts weiter als Nippes auf dem Sideboard der Existenz, nichts als Spätschäden des Turmbaus zu Babel. Ich selbst schrieb 2016 nach einem Vortrag in Peking ernüchtert in mein Notizbuch: "Ankunft. Bäume. Straßen. Häuser. Menschen. Wasser. Geld. Luft. Abreise."
In einem Radio-Essay mit dem Titel "Wenn fremde Kulturen verschwinden" gibt sich der Psychoanalytiker Sama Maani ähnlich abgeklärt wie ich in meinen Notizen. Hinter dem heute so populären Ruf nach der Wahrung spezifischer Kulturen, Traditionen, Sitten und Gebräuche wittert Maani den alten westlichen Exotismus. Sinngemäß argumentiert er wie folgt: Der Westen brauche das Archaische als kitschiges Zerrbild. Im Kolonialzeitalter war er noch bestrebt, die "Fremden" umzuerziehen. Nun aber sakralisiere er die Fremden und überhöhe sie zu Unberührbaren. "Bleibt im Dschungel!", ruft er ihnen zu. "Es ist besser für euch! Wir sind ansteckend!" Den ungefragt musealisierten Gruppen, beispielsweise indigenen Völkern, werde mit dieser paternalistischen Geste das Recht an der Teilhabe am Fortschritt abgesprochen: "Die Moderne mag vielen Angehörigen indigener Ethnien - vor allem Jüngeren - nicht bloß als eine Instanz erscheinen, die ihre Lebensgrundlagen bedroht. Sondern auch als Versprechen. Ein Versprechen, das auf ein anderes, besseres Leben verweist als jenes von der Kultur und den Traditionen der Vorfahren geprägte."
Bevor ich auf die Frage zu sprechen komme, was das denn eigentlich ist: ein "besseres Leben", drängt sich eine andere Frage auf: Woher stammt unsere Wertschätzung mutmaßlich authentischer, ursprünglicher, archaischer Kulturen? Die Vergangenheit war nicht knapp an Gründen, verächtlich auf diese herabzublicken. Doch während die westliche Moderne größtenteils mit der Ausbeutung oder Umerziehung der sogenannten "Primitiven" beschäftigt war, setzte in der Postmoderne ein Perspektivwandel ein. Spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg konnte sich der Westen nicht mehr so mir nichts, dir nichts als die fortschrittliche und die zivilisatorische Kraft schlechthin gebärden. Entsprechend änderte sich auch die Sicht auf das "Fremde" oder "Andere", das nun nicht mehr zwingend als "primitiv" begriffen wurde. Man erkannte darin im Gegenteil ein Korrektiv zur eigenen zivilisatorischen Maßlosigkeit und Ursprungsvergessenheit.
Verzweifelte Versuche, Restbestände des Realen zu retten
In den 1970er-Jahren beschrieb der französische Kulturtheoretiker Jean Baudrillard den Widerhall der Sehnsucht nach reinen Ursprüngen in der Wissenschaft als "Anti‑Ethnologie". Anstatt wie früher die Begegnung mit dem "Fremden" zu suchen und es zu dokumentieren, es zu vermessen, es zu klassifizieren, um es dann zu transformieren, gelte es nun, indigene Völker in ihrem unbefleckten Originalzustand zu konservieren. In Zeiten umfassender technologischer Transformation und Simulation versuche man verzweifelt, Restbestände des Realen zu retten. In seinem Buch "Die Agonie des Realen" ätzte Baudrillard 1978: "Der so in sein Ghetto, in den Glassarg des Dornröschenwaldes zurückkehrende Indianer, gibt seinerseits das Simulationsmodell für alle möglichen Indianer ab, die es vor der Ethnologie gegeben hat." Für Baudrillard ist die Bewahrung archaischer Kulturen also ein zynischer Akt jener Zivilisationen, denen der eigene Fortschritt unheimlich geworden ist. Sie wollen zwar weiterhin von seinen Segnungen profitieren, sich aber eine Hintertür offen halten. Vor der restlosen Vernichtung der Vergangenheit schaudert noch der härteste Progressist.
Baudrillards Beispiel könnte aktueller nicht sein. Erst kürzlich wurde der amerikanische Missionar John Chau von den isoliert lebenden Ureinwohnern auf einer Insel im Indischen Ozean getötet. Er hatte die Sentinelesen zu Christus bekehren wollen und war dafür illegal auf die Insel gelangt. Die Sentinelesen wünschen jedoch keinen Kontakt mit der Außenwelt. Also musste Chau sterben. Bemerkenswerterweise spielte die Tötung des illegalen Einwanderers, mithin ein schweres Verbrechen nach westlichem Recht, im öffentlichen Diskurs kaum eine Rolle. Ob die Inselbewohner wirklich ein Recht darauf haben, in Isolation zu leben und ihre Grenzen mit tödlicher Gewalt zu verteidigen, wurde kaum je hinterfragt. Ja, es schien nachgerade selbstverständlich, dass diese geheimnisvollen, archaischen Wesen zur Waffe greifen, um einer Bibelstunde zu entgehen und sich jener Krankheitskeime zu erwehren, die auch an den Händen der Erleuchteten kleben. Für diese Kultur, so der Subtext der öffentlichen Reaktionen, gelten nun mal andere Maßstäbe als für moderne westliche Kulturen - und das ist auch gut so.
Wie aber bringt man das in Einklang mit den Idealen der universellen Menschenrechte, des Kulturaustauschs und des Gewaltverzichts? In Zeiten, da das Prinzip der Grenze und des Grenzschutzes umstritten ist, ja zu erbitterten Auseinandersetzungen zwischen kosmopolitischen Linksprogressiven und nationalistischen Rechtskonservativen führt, ist das Verständnis für den Sentinelesischen Grenzschutz doch bemerkenswert - und eine Steilvorlage für Stimmen vom rechten Rand. Die rechtspopulistische australische Politikerin Pauline Hanson etwa erklärte als Reaktion auf den Vorfall das australische Volk gleichsam zu Sentinelesen, die alles Recht der Welt auf eine "zero-gross immigration policy" hätten.
Ein Fortschritt kann auch ein Rückschritt sein
Wer aus den Thesen Maanis und Baudrillards sowie den Auslassungen Hansons nun jedoch schließt, jegliche Formen des Kulturkonservatismus, jegliche Grenzziehungen und jegliche Versuche der Wahrung archaischer Lebensweisen seien abzulehnen, begeht einen Fehler. Sicherlich kann es nicht darum gehen, Individuen und Gruppen in einen "Glassarg des Dornröschenwaldes" zu stecken, wie Baudrillard das nannte. Doch ebenso abwegig ist es, statt dessen die Universalität des kulturellen Fortschritts zum globalen Glassarg und die Weltbevölkerung zum Schneewittchen zu erklären. "Fortschritt" ist ein wertneutraler Begriff, der von unterschiedlichen Gruppen unterschiedlich interpretiert wird. Und damit sind wir bei der Frage, was das denn eigentlich ist - jenes "bessere Leben", von dem in Maanis Essay die Rede ist.
Ein Rechtskonservativer, mit dem ich hin und wieder Auseinandersetzungen auf Twitter führe, schrieb mir am 29. Dezember 2018: "Ein Rückschritt kann auch ein Fortschritt sein." Ich erwiderte, ohne seine politische Haltung zu teilen: "Das ist formal richtig." Umgekehrt trifft die Aussage ebenfalls zu: Ein Fortschritt kann auch ein Rückschritt sein. So war die fortschrittsberauschte französische Revolution ein Rückschritt für die französischen Frauen, mussten sie sich doch gemäß Napoleons Code Civil einem Vormund unterstellen. Die Wählerinnen und Wähler von Donald J. Trump erhoffen sich sogar von der explizit regressiven Politik des US-Präsidenten ein besseres Leben für sich und ihre Familien. Und während die Atombombe ein Resultat wissenschaftlichen Fortschritts ist, darf mit Fug und Recht bezweifelt werden, ob sie auch einen ethischen und moralischen Fortschritt darstellt.
In den 1950er-Jahren schrieb der Kulturkritiker Günther Anders vor dem Hintergrund der Atombombenabwürfe auf japanische Städte: "Der Fortschrittsbegriff hat uns apokalypse-blind gemacht." Denn wer die Zukunft nicht anders als "fortschrittlicher" im Sinne von "besser" imaginieren kann, der übersieht mit hoher Wahrscheinlichkeit Gefahren, der lässt sich vom Glanz der Hoffnung blenden. Nicht zuletzt begibt er sich in eine heikle Nähe zu jener missionarischen Zwangsbeglückungsmentalität, die früher nicht nur unter kulturkonservativen Rechten, sondern auch unter Linken verbreitet war. So sagte der französische Sozialist und Widerstandskämpfer Léon Blum 1925:
"Wir glauben, dass die überlegenen Rassen das Recht und sogar die Pflicht haben, jene zu gewinnen, die nicht denselben Grad an Kultur erreicht haben, und sie zu den Fortschritten aufzurufen, die dank der Bemühungen der Wissenschaft und der Industrie verwirklicht worden sind."
Ein "buntes" Szenario behandelt Menschen wie Farbtupfer
Wir sind gut beraten, uns heute dieser Worte zu erinnern. Die Wahrheit des kulturellen Fortschritts liegt nicht bei den jeweils Mächtigsten, also jenen, die Mittel und Wege haben, ihre Vorstellungen auch durchzusetzen. Sie liegt auch nicht bei jenen, die glauben, dass ihre Weltsicht die fortschrittlichste, edelste und gerechteste ist. Allzu oft diente ja der Ruf nach einer universellen, fortschrittlichen Kultur als Tarnung zum Export der jeweils eigenen, keineswegs "universellen" Kultur. Insbesondere in der postkolonialen Theorie wird denn auch der problematische Charakter von Begriffen wie "universell" oder "fortschrittlich" betont. Ob bei Frantz Fanon, Homi Bhabha oder Gayatri Chakravorty Spivak - im Zentrum des postkolonialen Denkens und Handelns steht die Frage, wie Differenz in der Gleichheit und Gleichheit in der Differenz möglich sein kann, ohne dabei jene multikulturellen Szenarien heraufzubeschwören, für die naive Begriffe wie "bunt" bemüht werden.
Ein "buntes" Szenario mag ästhetisch pläsierlich sein, politisch, sozial und ethisch ist es jedoch dubios, weil es Menschen wie Farbtupfer behandelt. Das bessere Leben, ein buntes Leben? Auch bunte Bilder können misslungen sein. Im schlimmsten Fall mündet dieses Szenario in Kulturrelativismus, also in die Annahme, alle Kulturen mitsamt ihren Praktiken und Theorien seien aus ethischer und moralischer Sicht gleichwertig. Doch für die meisten Menschen ist ein Mord ein Mord, ist Gewalt Gewalt, ist Folter Folter, ist Sklaverei Sklaverei, ganz egal, welche kulturelle Begründung dafür geliefert wird. Sicherlich gibt es Ausnahmen; also Menschen, die im Dienst an einer höheren Sache Leid auf sich nehmen und dieses entsprechend rationalisieren. Man denke nur an den Kreuzestod Jesu Christi. Doch von den Wenigen sollte nicht auf die Vielen geschlossen werden. Menschen sind doch eben auch Individuen, die unabhängig von ihrer Kultur Schmerz und Lust, Freude und Leid empfinden.
Wenn es nicht die eine Wahrheit des kulturellen Fortschritts gibt, muss sie zwischen unterschiedlichen Individuen und Gruppen ausgehandelt werden. Das hat nichts mit blauäugigen Vorstellungen von "Zuhören" und "Verstehen" zu tun; es geht hier auch nicht um Ethnopluralismus oder um Relativismus, es geht um Relationalität. Wahrheit ist relational, sie entsteht durch Diskurs, Dialog, Streit, Kritik, Prüfung, Verifizierung, Falsifizierung, Rede und Gegenrede, Argument und Gegenargument, kurz: Sie entsteht in kommunikativen Zusammenhängen.
Kulturelle Ansprüche nicht als absolut setzen
Voraussetzung für das Gelingen der Verhandlungen über den kulturellen Fortschritt und das bessere Leben ist neben Gewaltverzicht, dass die beteiligten Parteien ihre Ansprüche nicht absolut setzen - auch die überlegenen nicht. Der Erfolg der Verhandlungen hängt damit von Voraussetzungen ab, die sie selbst nicht garantieren können. Paradoxerweise müssen also auch die Voraussetzungen der Verhandlungen verhandelt werden. Mit dem Philosophen John Rawls gesprochen, bedarf es für gelingende Verständigung weder sozialer noch ethnischer oder politischer Homogenität, sondern der Minimalanforderung eines "überlappenden Konsens". Das klingt natürlich nicht wirklich sexy und ist leichter gesagt als getan. Gemeinsam erarbeiteter und gerecht gestalteter kultureller Fortschritt ist ein langsamer, zäher, kräftezehrender und nur allzu oft frustrierender Prozess. Das Spektakel des Revolutionären ist ihm fremd, er vermag kaum je mitzureißen, Glückshormone und Energien freizusetzen. Langsame Veränderungen triggern keinen Heroismus und ein "minimaler Konsens" klingt nach allem anderen als nach einem großen Wurf. Doch gebricht es diesem, man darf es ruhig sagen: konservativen Verständnis kulturellen Fortschritts einerseits an Mobilisierungspotenzial, so hilft es andererseits, Exzesse zu verhindern.
Wenn beispielsweise ein schwedischer Kapitän im frühen 20. Jahrhundert vor Papua-Neuguinea Schiffbruch erleidet, sich an Land rettet, entgegen der kulturellen Tradition die Erlaubnis erhält, als Fremder eine Häuptlingstochter zu ehelichen, moderne Kokosplantagen aufzubauen und internationalen Handel zu treiben, dann verändert dies die dortige Kultur sicherlich in erheblichem Maße. Ein Traditionsverlust stellt sich ein, der Nostalgikern und Exotisten die Tränen in die Augen treiben mag. Da sich die Veränderungen jedoch weder schlagartig noch gewaltsam vollziehen und überdies auf einem Konsens beruhen, der nicht einmal umfassender Natur sein muss, ist der Verlust in diesem Fall legitim. Mit einer zugegeben ausgelutschten und banalen Formulierung könnte man sagen, es handle sich um eine Win-Win-Situation. Hier haben wir es also nicht länger mit einem Entweder-Oder zu tun: Entweder die alte Kultur oder die neue Kultur. Entweder Fortschritt oder Stagnation. Entweder authentisch oder künstlich. Vielmehr geht es um ein "und", nämlich um die Bereitschaft der involvierten Parteien, hybrid zu werden, wenn die Situation es erfordert und solange, man kann es nicht oft genug betonen, keine Gewalt im Spiel ist - denn vielleicht lässt sich das Alte ja umso erfolgreicher bewahren, wenn man sich dem Neuen nicht kategorisch verschließt? Eine persönliche Anekdote mag hier aufschlussreich sein. Teile dieses Essays habe ich auf einem digitalen Pad geschrieben - und zwar handschriftlich. Zuvor hatte ich jahrelang nur getippt. Der Fortschritt der Digitalisierung hat also dazu geführt, dass ich etwas so Archaisches und Atavistisches wie meine Handschrift wieder entdeckt habe. Ausgerechnet das, was zur Zerstörung der handschriftbasierten Kultur geführt hat, eben die Digitalisierung, war in meinem Fall der Auslöser für die Renaissance der Handschrift.
Öffnung statt auf Traditionen beharren
In einem Deutschlandfunk-Feature von Tina Uebel über das sibirische Volk der Nenzen sagt Wladimir, ein Angehöriger der Nomaden, die bemerkenswerten Sätze:
"Ich glaube, die Nenzen-Kultur … wenn ein Mensch so lebt, wie es sich gehört und wo er leben soll, dann verändert sich die Kultur gar nicht so sehr. Bei uns bleibt das, was gut ist, das bleibt so … und das, was nicht gut ist, was nicht nötig ist, das lassen wir hinter uns. Seit den 2000er-Jahren hat sich unser Glaube geändert, weg von der alten Tradition. Wenn wir immer noch im alten Leben leben würden, so wie früher unsere Väter und Großväter, dann glaube ich nicht, dass jemand von uns bis zum heutigen Tag überlebt hätte."
Wladimir ist zwar ein konservativer Nenze und bedauert den Verlust von traditionellen Lebeweisen. Aber gerade deshalb verweigert er sich weder dem Fortschritt noch Kulturkontakten. Er hat sogar den christlichen Glauben angenommen, weil er ihn als wirksames Mittel gegen den weit verbreiteten Alkoholismus unter den Nenzen erachtet. Wladimirs Öffnung gegenüber dem Neuen hat also pragmatische Gründe. Der kulturfremde christliche Glaube hilft, bestimmte Aspekte der Kultur der Nenzen zu bewahren. Dahingehend ist der Zusammenhang zwischen christlichem Glauben und der Kultur der Nenzen vergleichbar mit dem Zusammenhang zwischen digitalem Pad und Handschrift: Eine Innovation sichert den Fortbestand des Überkommenen. In den Worten der Folksängerin Ani DiFranco könnte man sagen:
"Buildings and bridges
Are made to bend in the wind
To withstand the world
That's what it takes [. . .]
What doesn't bend breaks."
"Gebäude und Brücken müssen im Wind schwingen
Um der Welt zu widerstehen
Genau das braucht es
Was sich nicht biegen lässt, zerbricht."
Are made to bend in the wind
To withstand the world
That's what it takes [. . .]
What doesn't bend breaks."
"Gebäude und Brücken müssen im Wind schwingen
Um der Welt zu widerstehen
Genau das braucht es
Was sich nicht biegen lässt, zerbricht."
Während also niemand seine Vorstellungen von fortschrittlicher Kultur Anderen aufzwingen sollte, ist umgekehrt niemand gut beraten, sich Kulturkontakten zu verweigern und den aktuellen Stand seiner Kultur für sakrosankt zu erklären - alleine schon und paradoxerweise aus Eigeninteresse. Damit sind wir wieder bei der schwierigen Frage, ob die Sentinelesen im Recht sind, wenn sie den Kontakt mit ihrer Umwelt ablehnen und Eindringlinge töten. Wie dem auch sei: Die Milde gegenüber den Sentinelesen legt die Vermutung nahe, dass sich die Menschen des hochtechnisierten, rundumvernetzten Kommunikationszeitalters nach der, mit Michel Houellebecq gesprochen, "Möglichkeit einer Insel" sehnen. Ach, wäre man doch nur wie die Sentinelesen, zumindest in Teilzeit, wie einfach wäre da das Leben! Eine Insel, nur für die eigenen Peers! Klare Grenzen! Kein Twitter! Keine Frühjahrs- und Herbstmoden! Nie wieder dieser entsetzliche Druck im Fastfood-Restaurant bei der Kuration des personalisierten Burgers! Gerade in Zeiten technologischer Brummkreiselei und sozialer Experimente gelüstet es urbane HighPerformer nach edlen Wilden und reinen Ursprüngen. Das war bereits bei den zivilisationskritischen Südsee-Aussteigern, Nudisten und Esoterikern um 1900 so und das ist heute, da man uns mit Eiszeitwasser, Urdinkelbrötchen, Didgeridookursen und berührenden Reisen in unberührte Natur ködert, nicht anders.
Die Sehnsucht nach einer Auszeit vom Fortschritt ist integraler Teil des Fortschritts selbst. Schon während der Kolonialzeit setzte der postmoderne Wandel ein, den Baudrillard am Beispiel der "AntiEthnologie" veranschaulichte. Die Aufbruchs- und Fortschrittseuphorie der europäischen und amerikanischen Nationen begann sich mit Nostalgie und Ursprungssehnsucht zu mischen. Auf den Weltausstellungen des 19. Jahrhunderts präsentierte man vermeintliche oder tatsächliche Vertreter von Urvölkern inmitten der westlichen Industrie- und Kunstleistungsschauen. Einerseits dienten sie als dialektische Verstärker der eigenen Avanciertheit, andererseits als Trostpflaster auf den Wunden der Modernisierung. Da, schaut euch das eigens in Paris errichtete ägyptische Dorf an und vergleicht! - was für einen beeindruckenden Weg wir, die absolut Modernen, doch zurückgelegt haben! Aber seid unbesorgt, wir haben ein paar ältere Kinder von Adam und Eva am Leben gelassen, um den Modernisierungsschock abzufedern. Bereits Kolumbus glaubte, in der Neuen Welt die nächsten Verwandten Adams und Evas entdeckt zu haben. Später wurde ihm klar, dass er billige Arbeitskräfte vor Ort benötigte und er dimmte seine metaphysischen Projektionen entsprechend herunter. Aus den Urmenschen des Alten Testaments wurden "Primitive" oder, mit einer Formulierung des kamerunischen Politikwissenschaftlers Achille Mbembe, "menschlicher Rohstoff". The rest is history.
"Der Fortschritt ist genau wie die Mafia!"
Kurz gesagt ist die Möglichkeit zur zwanglosen Teilhabe am Fortschritt prinzipiell positiv, der Fortschritt als solcher ist es aber nicht zwingend. Um diesen Gedanken noch einmal zu verdeutlichen, kann man sich einiger einfacher Beispiele bedienen. Wer etwa argumentiert: "Auch bislang isoliert lebende Völker haben ein Recht auf Antibiotika!", begibt sich auf dünnes argumentationslogisches Eis. Denn manche Infektionskrankheiten, gegen die Antibiotika eingesetzt werden, wurden erst durch das Fortschreiten der Globalisierung verbreitet. Oder denken wir an die Umweltverschmutzung. Mit progressiven Stolz führen wir heute Worte wie "Nachhaltigkeit" und "grüne Technologien" im Munde. Tatsächlich ergeht sich der Westen schon seit knapp zwei Jahrhunderten in Sonntagspredigten, nun müsse man aber wirklich mal die Schöpfung retten - mit dem immergleichen Ergebnis: ein bisschen Effizienzsteigerung hier, ein gewaltiger Rebound-Effekt dort, im Großen und Ganzen weiterhin wachsender Ressourcenverbrauch. In Sachen Ökologie ist jeder noch so archaische Stamm fortschrittlicher, weil er nicht fortschrittlich ist. Und auch was Geschlechterrollen betrifft, ist Fortschritt ambivalent - matrilineare oder matriarchale Gesellschaften bilden eine Ausnahme an den Rändern jener großen Kulturen und Staaten, die sich als Avantgarde der Zivilisation positioniert haben. Wollte man nun gemein und ein klein wenig unsachlich werden, so könnte man polemisieren: Der Fortschritt ist genau wie die Mafia! Er verspricht Schutz vor Bedrohungen - insbesondere vor jener Bedrohung, die er selbst darstellt.
Neben der Ambivalenz des Fortschritts spricht noch etwas gegen die These, dass das Verschwinden spezifischer Kulturen eine alles in allem gute Sache ist. Gerade die westliche Moderne hat gezeigt, dass Homogenisierung unter progressiven Vorzeichen zuverlässig das Begehren nach persönlicher wie auch kultureller Identität weckt. Das Ideal der Gleichheit ist vor diesem Hintergrund mit Vorsicht zu genießen, ja es trägt gewisse autoimmunisierende Züge. Jüngst haben beispielsweise Studien aus Skandinavien gezeigt, dass mit wachsender ökonomischer, sozialer und politischer Gleichheit die Unterschiede zwischen den Geschlechtern nicht kleiner, sondern größer werden. Die empirischen Daten belegen, dass skandinavische Frauen nicht vermehrt in sogenannte "Männerberufe" wechseln, wenn sie die Gelegenheit dazu haben und sich nicht wie Männer kleiden, obgleich es ihnen frei steht, das zu tun. Ob das tatsächlich biologische Ursachen hat, wie einige Rechte nun frohlocken, darf bezweifelt werden. Wahrscheinlicher ist ein Mix aus verschiedenen Faktoren.
Homogenisierung weckt Begehren kultureller Identität
Was für Geschlechterrollen in Skandinavien gilt, gilt auch für den Zusammenhang zwischen moderner westlicher Ökonomie und kultureller Differenz. Oft wird behauptet, die globale Ausbreitung des Kapitalismus bedeute Gleichmacherei, also den Verlust kultureller Vielfalt. Ganz so einfach ist es nicht. Dazu hat der Soziologe Georg Simmel in seinem Hauptwerk "Philosophie des Geldes" (1900) Gedanken entwickelt, die immer noch aktuell sind.
Simmel zufolge zeichnet sich die westliche Moderne durch eine nie gesehene Macht des Geldes aus - eine Macht, die tatsächlich alles mit Indifferenz schlägt. Doch gerade weil sich die moderne Geldkultur keinen Deut um individuelle Vorstellungen oder kulturelle Eigenheiten schert, triggert sie die Entwicklung dessen, was Simmel als "Lebensstile" bezeichnet. Als Reaktion auf die Indifferenz der modernen Geldwirtschaft erklären sich die Menschen zu echten Deutschen, zu wahren Franzosen, zu genuinen Männern und genuinen Frauen, zu Bohemes oder zu Bürgerlichen, erfinden Trachten oder Zivilreligionen und erdichten sich eine Vergangenheit, welche die schnellen Wechsel der kapitalistischen Marktwirtschaft konterkariert. Künstler sind nun nicht mehr nur Künstler, sondern Vertreter von Ismen, etwa Kubisten, Expressionisten, Konstruktivisten, Dadaisten. Und natürlich ist jedes Dorf ohne Blauschimmelkäsespezialität dem Untergang geweiht. Kurz, man erfindet neue Kulturen, im Kleinen wie im Großen. Kulturen wurden zwar immer schon "erfunden". Aber der Prozess verlief meist unmerklich, da er sich über große Zeiträume erstreckte. In der westlichen Moderne beschleunigte er sich. Nun sahen einzelne Menschen immer häufiger in ihrem eigenen Leben Kulturen wie im Zeitraffer entstehen, sich wandeln und vergehen - diese Beschleunigung ist der Hauptgrund, warum neue Kulturen künstlich wirken und alte natürlich.
Der Soziologe Émile Durkheim, ein Zeitgenosse Simmels, stellte schon im Jahr 1893 fest, dass sich die modernen westlichen Gesellschaften durch die Gleichzeitigkeit von Autonomie und Heteronomie auszeichne: Alle Menschen werden freier und abhängiger, individueller und allgemeiner. Einerseits sind sie in ihrem Alltag durch immer mehr Regeln eingeschränkt und auf immer mehr Dinge, etwa Maschinen oder Staatsleistungen, angewiesen, andererseits stilisieren sie sich zu immer individuelleren Wesen. So betrachtet unterbindet und begünstigt die westliche Moderne die Hochkonjunktur von Lebensstilen wie kaum eine andere Epoche. Mit diesen Lebensstilen gehen neue Kulturen oder Subkulturen einher, deren Abgrenzungsbestrebungen mal aggressiver, mal weniger aggressiv ausfallen. Im Großen sind es beispielsweise Nationalismen, im Kleinen alternative Strömungen wie Punk oder Hardcore. Alle legen sie Wert auf kulturelle Praktiken, die nicht zur Gänze in anderen kulturellen Praktiken aufgehen, also einen hohen Grad von Autonomie aufweisen.
Eine Leitkultur ist überflüssig
Wer also Kulturen, die nicht zu seinem jeweiligen Fortschrittsverständnis passen, für obsolet erklärt oder behauptet, wir seien doch alle eins, der sollte sich bewusst sein, dass er gerade damit Wasser auf die Mühlen von Identitätssuchenden leiten könnte. Überall dort, wo Menschen Homogenisierung und Indifferenz wittern, streben sie umso stärker nach Differenz. Förderlich für ein gelingendes Miteinander in Vielfalt ist nicht die Angleichung von Lebensformen unter den Vorzeichen eines Fortschrittsideals oder Slogans wie "One World", sondern kluges und gerechtes Differenzmanagement im Sinne des zuvor erwähnten Philosophen John Rawls: Weder kulturelle Gleichheit noch Multikulti, sondern "überlappender Konsens" lautet das Ziel. Dafür müssen kulturelle Eigenheiten, Traditionen, Sitten, Gebräuche oder Lebensstile nicht vollumfänglich aufgegeben werden. Vielmehr bieten Austausch und Verhandlung eine Gelegenheit, sie auf einer neuen Stufe, wie bei den Nenzen, zu aktualisieren und damit am Leben zu erhalten. Auch eine Leitkultur ist überflüssig. Unerlässlich ist hingegen eine gemeinsame Gerechtigkeitsvorstellung, die für Fairness in der Vielfalt sorgt. Wem das zu kompromisslerisch ist, der ist reif für die Insel.