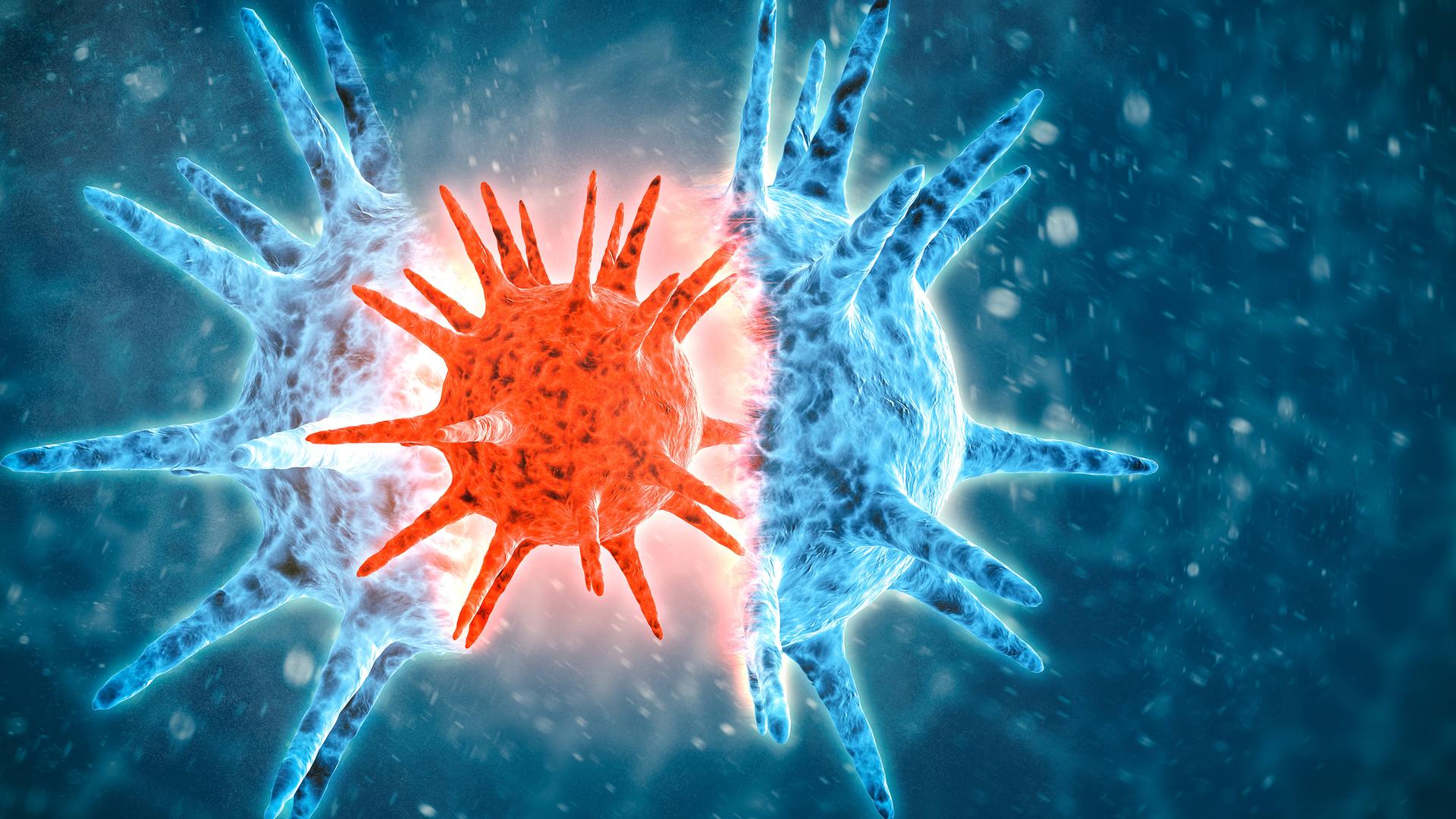Kenneth Centeno stammt aus Manila, der Hauptstadt der Philippinen. Seit einigen Jahren promoviert der Vinzentiner-Pater im Fach Religionsphilosophie an der Uni Aachen – mit einem Stipendium des katholischen Hilfswerks missio München. Fast täglich erreichen ihn deprimierende Nachrichten aus der Heimat, wo viereinhalb Millionen Menschen in Slums leben. Einige philippinische Regionen gehören zu den weltweit am dichtesten besiedelten Gebieten. Die Regierung hat seit März strenge Ausgangssperren verhängt.
"Seit dem Lockdown haben die armen Familien so viel gelitten. Wegen dieser strengen Quarantäne können Vater oder Mutter nicht rausgehen, um zu arbeiten. Immer wieder werden sie bedroht – von Gewalt oder Verhaftungen."
"Ich weiß nicht, wie man das überleben kann"
Auf den Philippinen arbeiten wie in anderen Ländern des Globalen Südens viele im sogenannten informellen Sektor: Als Straßenverkäufer, Schuhputzer oder Feldarbeiter. Diese Tagelöhner verdienen Tag für Tag gerade so viel, wie sie zum Überleben brauchen. Ohne Erspartes, ohne Versicherung oder Sozialhilfe sind sie darauf angewiesen, draußen zu arbeiten.
"In den kommenden Tagen wird diese Quarantäne verschärft. Mit Hilfe nicht nur der Polizei, sondern auch vom Militär. Das ist quasi wie ein Kriegsrecht. Ich habe große Angst davor."
Eines der drängendsten Probleme für die Tagelöhner und ihre Familien sei der Hunger, berichtet Pater Centeno: "Zum Beispiel meine Mutter hat nur zwei Kilo Reis, zwei Packungen Nudeln und zwei Dosen Sardinen bekommen – für zwei Wochen. Ich weiß nicht, wie man das überleben kann, wenn man nicht genug Essen hat. Ich glaube, wenn diese zunehmende Not von der Regierung nicht rechtzeitig erkannt wird, dann explodieren soziale Unruhen."
Die Hilfswerke erwarten mehr Hungertote
Davor warnen auch andere kirchliche Organisationen. Wanderarbeiter, Tagelöhner und Straßenkinder seien von der Corona-Krise doppelt betroffen, heißt es beim katholischen Hilfswerk Misereor: Weil sie sich in beengten Verhältnissen und mit Blick auf marode Gesundheitssysteme kaum gegen das Virus schützen könnten. Und weil ihnen Ausgangssperren den Lebensunterhalt entzögen.

Cornelia Füllkrug-Weitzel, Präsidentin der beiden evangelischen Hilfswerke Diakonie Katastrophenhilfe und Brot für die Welt, sagt:
"In Afrika kenne ich einige Stimmen, die sagen, ich würde lieber an der Pandemie sterben als an Hunger. Wir sind uns ganz sicher, dass sehr viel mehr Menschen jetzt in diesem Jahr, aber auch langfristig, an den sozialen und wirtschaftlichen Folgen, also an Hunger, sterben werden."
Die kirchlichen Werke bekämen ständig neue Hilferufe ihrer Projektpartner.
"Ich beziehe einen Newsletter von einer indischen Basis-Organisation, die haben geschrieben, dass den Menschen in dieser ländlichen Region nichts anderes übrigbleibt, als Gras zu essen. Das finde ich extrem dramatisch. Wanderarbeiterinnen und -arbeiter werden jetzt nach Hause geschickt. Dann sind die Grenzen geschlossen, sie dürfen aber nicht auf der Straße sein, sondern sollen zu Hause sein. Und dann werden sie noch dafür verfolgt, dass ihr Zuhause jenseits der Grenze liegt, wo sie nicht hindürfen. Sondern sie irgendwo anlanden, wo sie gar nichts haben an Versorgung – und auch kein Obdach."
Eine Frage des Vertrauens
In der Corona-Krise versorge laut dem Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat die Kirche vielerorts Arme mit Nahrungsmitteln, wo staatliche Stellen ausfielen. In Argentinien würden Gotteshäuser medizinisch so ausgestattet, dass sie etwa Menschen aus Altenheimen aufnehmen könnten.
In Afrika betreiben die Kirchen fast die Hälfte aller Gesundheitseinrichtungen, sagt Brot für die Welt-Präsidentin Füllkrug-Weitzel:
"Die kirchlichen Hilfswerke sind ja keineswegs nur in den großen städtischen Ballungszentren präsent, sondern überall im ganzen Land, auch in sehr abgelegenen ländlichen Regionen. Dort kennen sie die Situation der Menschen, durchleiden sie zum Teil selbst mit. Sie haben das Gehör. Das macht schon einen Unterschied, ob ein Pfarrer darüber spricht, was jetzt an Gesundheitsmaßnahmen notwendig ist, weil sie ein großes Vertrauen der Bevölkerung haben."
Vom Vertrauen dürfte stark abhängen, wie sich die Pandemie im Globalen Süden entwickelt: Gehen Kirchenvertreter, aber auch Politiker verantwortungsbewusst mit Informationen um? Die Regierungen in Brasilien und Nicaragua etwa unterschätzten das Virus, sind sich Beobachter einig. Auf den Philippinen wiederum würden viele Anhänger von Präsident Duterte der Kirche nicht trauen, sagt der Vinzentiner-Pater Kenneth Centeno.
"Zurzeit steht die Kirche als eine unpopuläre Figur in der Gesellschaft, aufgrund ihrer Gegenmeinung über die politische Haltung von Präsident Duterte. Wenn die Kirche etwas für die Menschen tut, sagen die Menschen: Ja, das ist die Kirche, das ist nur Show."
"Eine Pandemie ist nur global zu bekämpfen"
Hinzu kommt: Kirchliche Hilfsorganisationen wissen auch oft nicht, wie sie ohne funktionierende Logistik Schutzkleidung in die betreffenden Regionen bringen sollen. Oder was sie gegen staatliche Willkür ausrichten können.
"Zurzeit ist wirklich alles im Chaos. Ich verstehe, die Regierung möchte, dass alle die Gesetze und Regeln einhalten. Aber wenn die Menschen so hungrig sind, verlieren sie ihre Vernunft. Sie müssen rausgehen, um ihre Kinder zu ernähren."
Zumindest eines sehen die kirchlichen Hilfswerke positiv: Dass die Menschen hierzulande offenbar nicht nur auf sich selbst schauen. Bei missio München etwa heißt es, das Spendenaufkommen sei im Vergleich zum Vorjahr bisher gleichbleibend.
Entwicklungsexpertin Füllkrug-Weitzel sagt, dass es im Globalen Süden keine Staaten gebe, die für ihre Bevölkerung Rettungsschirme aufspannen.
"Das verstehen unsere Spendenden durchaus. Sie verstehen auch, dass eine Pandemie nur global zu bekämpfen ist und eben nicht national. Wenn wir sie im Süden nicht in den Griff bekommen, wird sie natürlich auch immer wieder zu uns rüberschwappen. Es ist ein gemeinsames Interesse, diese Pandemie so schnell wie möglich zu stoppen und die Folgen für die Menschen so stark wie möglich zu reduzieren."