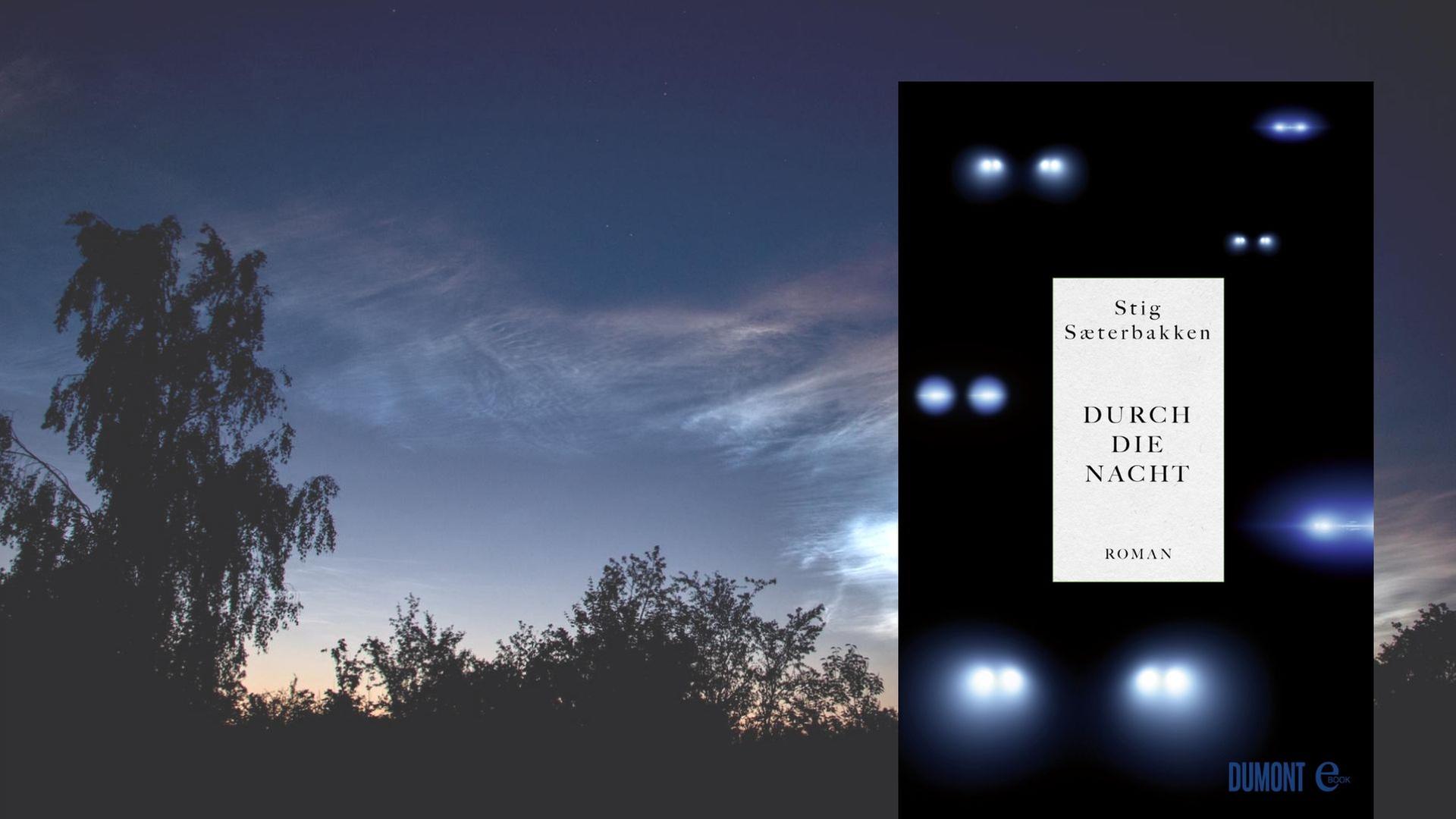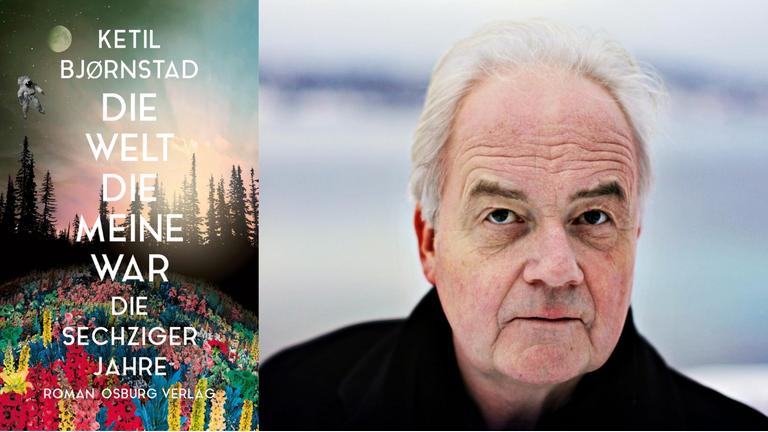Wer einen Roman in einem Umfang von mehr als 1200 Seiten veröffentlicht, steht unter Legitimationszwang. Ein Werk von derartiger Opulenz muss mehr zu erzählen haben als eine gute Geschichte; es muss eine allgemeingültige Erfahrung vermitteln, die Stimmung einer Epoche oder einer Generation erfassen und in ein schlüssiges literarisches Konzept verwandeln. Oder es muss, wie die autofiktionalen Romane von Karl Ove Knausgard, in hemmungsloser Privatheit eine neue Form des Erzählens erfinden, die offensichtlich einen Nerv der Zeit trifft.
Knausgards Landsmann Johan Harstad hat in einem Interview erzählt, er habe aus seinem Buch "Max, Mischa und die TET-Offensive" noch 600 Seiten gestrichen. Um es vorweg zu nehmen: Besser wäre es gewesen, er wäre noch etwas strenger mit sich selbst gewesen und hätte das Gleiche noch einmal getan. Mindestens.
Wir begegnen seinem Protagonisten und Ich-Erzähler Max gegen Ende der 1980er-Jahre. Max ist elf Jahre alt und wächst in der Hafenstadt Stavanger auf. Von dort aus brechen die Väter seiner Freunde zu ihren mehrwöchigen Arbeitseinsätzen auf den Ölbohrplattformen auf. Max hat eine glückliche Kindheit. Die Mutter ist eine kluge, progressive Frau; der Vater ist Pilot von Beruf. Der ewige Wechsel von Aufbruch und Nichtankommen ist eines der vielen Motive des Romans.
Erfahrungs- und Erlebnisarmut
Was Max‘ Eltern von anderen unterscheidet, ist ihre politische Haltung: Sie waren Mitglieder der kommunistischen Partei, haben gegen den Vietnamkrieg demonstriert und hegen eine tiefe Verachtung für die Verbrechen der amerikanischen Außenpolitik. Als Reaktion auf die für ihn noch Jahre später schwer durchschaubaren politischen Frontverläufe in seinem persönlichen Umfeld entwickelt Max ein geradezu manisches Interesse an Filmen, die sich mit dem Vietnamkrieg beschäftigen. Die Betrachtung von Francis Ford Coppolas 1979 entstandenem Antikriegsfilm "Apocalypse Now" wird für ihn und seine Kinderfreunde zu einem Schlüsselerlebnis:
"Apocalypse Now ist der letzte Vietnamfilm, den wir uns anschauen. Und der, über den wir am wenigsten reden, aber am meisten nachdenken. Für Stig und Andri ist Vietnam in erster Linie etwas Exotisches, Unbekanntes, das in die Welt der Unterhaltung gehört, für mich geht es darum, meine Eltern zu verstehen, wo sie herkommen, wer sie waren. In dem Maße, in dem so etwas möglich ist."
Es war nicht die einzig fragwürdige, aber vielleicht die schlechteste Idee von Johan Harstad, "Apocalypse Now" seinem Roman als Erzählfolie unterzulegen. Der Vietnamkrieg wird bei Harstad zu einer großen Metapher, mit der die Erfahrungs- und Erlebnisarmut der Generation Max zu einem existentiellen Erlebnis aufgepumpt werden soll. Auf diesem dürftigen Einfall basiert im Grunde der gesamte Roman. Das ist allerdings nicht nur ein wenig anmaßend, sondern darüber hinaus auch unplausibel und willkürlich gesucht.
Enervierende Geschwätzigkeit des Erzählers
Hinzu kommt, dass aus diesem Verfahren geradezu zwangsläufig eine implizite Schwäche resultiert: Wenn man versucht, so wie der Ich-Erzähler Max, das eigene und bislang noch nicht allzu interessante Leben in einer gigantischen, nostalgisch verzuckerten Textmaschine zu rekonstruieren – dann landet man bei popkulturell ikonisierten Bildern, die jeder kennt. Im Falle des Vietnamkriegs ist das beispielsweise Eddie Adams‘ Fotografie des Polizeichefs von Saigon, der ein mutmaßliches Mitglied einer Todesschwadron auf offener Straße hinrichtet. Jeder kennt diese Fotografie. Welchen Sinn es haben soll, sie noch einmal über Seiten hinweg auf überschaubarem Reflexionsniveau zu analysieren, erschließt sich nicht.
"Max, Mischa und die TET-Offensive" ist als multifunktionales Buch angelegt: Es ist Familiengeschichte und Zeitroman, Entwicklungs-, Künstler- und Liebesroman. Und auf jeder dieser Ebenen scheitert das Buch vor allem an der enervierenden Geschwätzigkeit seines Erzählers.
Max, mittlerweile 35 Jahre alt, arbeitet als erfolgreicher Theaterregisseur in den USA und erinnert sich, das ist die Ausgangssituation, an sein bisheriges Leben. Er ist zwölf Jahre alt, als seine Eltern beschließen, Norwegen zu verlassen und in die USA zu ziehen. Dort erhofft der Vater sich bei einer amerikanischen Fluggesellschaft bessere berufliche Möglichkeiten.
In epischer Breite nichts zu erzählen
Für Max ist der Umzug ein Alptraum. Im neuen Land kommt er nicht so ganz an. Jedenfalls so lange nicht, bis er eine enge Freundschaft mit seinem Mitschüler Mordecai schließt. Über Mordecai lernt Max wiederum während eines Ferienaufenthaltes die sieben Jahre ältere Mischa kennen, die aussieht wie die junge Schauspielerin Shelley Duvall. Mischa ist Malerin, und konnte bereits erste Erfolge auf dem Kunstmarkt feiern. An ihre erste Begegnung erinnert sich Max in seinem üblichen pathetisch aufgeladenen Deklamationsstil:
"Allein dieser Satz, zerlegt in seine grundlegenden Bestandteile: Da. War. Sie. Ein schöner Satz. Es ist zwanzig Jahre her, und ich ertappe mich immer noch dabei, wie ich an die Schlichtheit dessen denke, dass sie da war, dass sie war, dass sie plötzlich da stehen und dieses Ereignis mit nichts anderem als diesen minimalen Anstrengungen zum wichtigsten in meinem Leben machen konnte, seit meine Eltern die endgültige Entscheidung getroffen hatten, uns in der Hoffnung der vollständigen Kompatibilität der Kontinente nach Amerika zu transplantieren."
Johan Harstad, das muss man so deutlich sagen, hat sich mit seinem Stoff nicht überhoben. Es ist viel schlimmer: Er hat schlicht wenig zu erzählen, das aber in aller Breite. Darüber hinaus verschenkt er dann auch noch das Potential, das in der einen oder anderen Figur gesteckt hätte, indem er es durch den gnadenlosen Quasseltrichter seiner selbstverliebten Erzählstimme presst.
Belangloses Rauschen der Gesamtkonstruktion
Max‘ Vater hat einen Bruder, Owe, der bereits viele Jahre vor Max‘ Familie in die USA emigriert ist und sich fortan Owen nennt. Das ist eine hoch interessante Figur. Ein Musiker und Musikliebhaber, der der Spur des Sounds über den Atlantik folgt. Ein von den Zwängen der Frömmigkeit traumatisierter Mann, der die Anti-Vietnambewegung und deren vermeintlichen Nonkonformismus als Renaissance einer neuen Religion ablehnt – und sich als Freiwilliger in den Vietnamkrieg meldet. Nicht zuletzt, um die amerikanische Staatsbürgerschaft zu erhalten.
Ein Veteran, der sich später als Komponist für Gebrauchsmusik durchs Leben schlägt und durch einen glücklichen Zufall in einer herrschaftlichen Wohnung mit Mietbremse im legendären Apthorp Building in Manhattan wohnt. Dort ziehen irgendwann auch Max und Mischa ein.
Ein Autor mit Sinn für Erzählökonomie hätte aus der Owen-Figur einen eigenen Roman gemacht. Die Passagen, in denen Max Owens Biografie rekonstruiert, sind auch die mit Abstand besten des gesamten Romans, allerdings muss man sie aus dem belanglosen Rauschen der Gesamtkonstruktion herausfiltern.
Die Sinnlosigkeit des eigenen Todes
Ein Leben in Erlebnisarmut also, nostalgisch verbrämt in Erinnerungsschleifen. Dann kommt der 11. September. Endlich eine existentielle Erfahrung. Was Max einfällt, wenn er über die Flugzeuge nachdenkt, die in die Türme des World Trade Centers geprallt sind, klingt dann so:
"Die Passagiere auf der rechten Seite des Flugzeugs hatten nichts anderes gesehen als den blauen Himmel; vielleicht hatten sie sogar die Morgensonne in den Augen gehabt; auf der anderen Seite mussten sie direkt auf den Battery Park und den Verkehr auf der West Street gestarrt haben. Ich konnte nur hoffen, dass es ihnen nicht zu sinnlos erschienen ist."
Da wird man doch einigermaßen fassungslos. Nein, so möchte man sarkastisch einwenden – höchstwahrscheinlich kommt den Opfern eines Terroranschlags der eigene Tod nicht sinnlos vor, sondern sie dürften froh gewesen sein, aktiv an der Weltgeschichte mitgeschrieben zu haben. Was auch sonst?
Wie nochmal kommt ein 1300-Seiten-Roman zustande? Durch den Wechsel von Tempo und Reflexionen. Die lesen sich dann in schönster Richard-David-Precht-Tradition so:
"Und wer waren wir geworden? Erinnerten wir uns überhaupt noch an uns selbst? Und wenn ja, wie lange noch?"
Im Sommer fuhren wir nach Kanada
"Max, Mischa und die TET-Offensive" ist tatsächlich ein so dickes Buch, weil es voll ist von Redundanzen. Noch ein Beispiel: Max und Mischa fahren gemeinsam in den Urlaub. Max erinnert sich:
"Im Sommer fuhren wir nach Kanada. Es war nicht in Stein gemeißelt, es gab auch Ausnahmen von der Regel. Wie das Jahr, als wir nach Arizona fuhren."
Das ist selbstverständlich eine Information, die schon immer gefehlt hat. Was nun folgt, ist eine sich über zwei Seiten erstreckende Beschreibung all der anderen besuchten Urlaubsorte, die nicht in Kanada lagen. Wohlwollend könnte man dahinter ein künstlerisches Prinzip vermuten, doch ganz gleich, in welche Richtung man auch denkt: Es fallen einem wenige Argumente ein, um John Harstads überbordenden Mitteilungsdrang und seinen Hang zu ausufernder Banalität ästhetisch zu rechtfertigen.
Was bleibt am Ende? Mischa hat Max verlassen. Das ist verständlich; sie kam auch selten einmal zu Wort. Aus Max‘ egozentrischer Perspektive bleiben alle Figuren außer ihm selbst blass. Das ist zumindest eine Erkenntnis. Für die es sich allerdings nicht lohnt, sich durch 1248 Romanseiten zu kämpfen.
Johan Harstad: "Max, Mischa und die Tet-Offensive".
Aus dem Norwegischen von Ursel Allenstein
Rowohlt Verlag, Hamburg. 1248 Seiten, 34 Euro.
Aus dem Norwegischen von Ursel Allenstein
Rowohlt Verlag, Hamburg. 1248 Seiten, 34 Euro.