
Frank Roselieb, Direktor des Instituts für Krisenforschung an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel, hält den dezentralen Ansatz in Krisenfällen für richtig. Dieser habe sich in den letzten Jahrzehnten bewährt. Allerdings müsse eine fachliche Beratung durch zentrale Stellen sichergestellt sein. Diese Informationen könnten die Entscheider vor Ort dann auf die jeweilige Situation übertragen. Verbesserungsbedarf sieht Roselieb bei der Krisen-Kommunikation. Diese müsste in einigen Bereichen strenger sein.
Zagatta: Herr Roselieb, wie sieht das jetzt ein erfahrener Krisenmanager wie Sie? Wir haben das eben bei den Bußgeldern jetzt auch wieder gehört. Dieser Flickenteppich, den wir jetzt haben, dass die Bundesländer da unterschiedliche Regelungen haben, trägt das zur Verwirrung bei?
Roselieb: Dieser dezentrale Ansatz – wir würden da nicht von Flickenteppich sprechen -, der macht durchaus Sinn. Das haben wir über Jahrzehnte in einer Vielzahl von Krisenfällen immer wieder untersucht. Das heißt, es geht nicht darum, dass man einen zentralen Stab in Berlin hat, der mal so eben für 83 Millionen Deutsche Entscheidungen trifft, sondern wichtig ist dieser dezentrale Ansatz, dass Sie im Idealfall 400 Krisenstäbe in Deutschland haben, das heißt die Kreise, kreisfreien Städte, die entscheidenden Träger das Katastrophenmanagements sind. Das heißt, nicht die Bundeskanzlerin ist letztlich entscheidend, sondern Landräte und Oberbürgermeister.
"Rettungsorganisationen sind in Deutschland dezentral aufgebaut"
Die Gründe dafür sind eigentlich drei große. Erstens ist man dann wesentlich näher an den Menschen dran. Wenn Sie zum Beispiel Schleswig-Holstein sehen: Wir haben Inseln und Halligen. Die wurden sofort abgeriegelt. Das war auch nötig, um die Infrastruktur nicht zu überfordern. Daran hätte ein Krisenstab in Berlin wahrscheinlich gar nicht gedacht. Der Krisenstab im Landkreis Nordfriesland natürlich schon. Das zweite ist auch, dass Sie natürlich auch operativ fit sein müssen, dieses Problem zu lösen. Auch die Rettungsorganisationen sind in Deutschland dezentral aufgebaut. Nehmen Sie die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, die Wasserrettung. Das sind 2000 Ortsgruppen. Die sind sehr nah an den Menschen dran, genauso Johanniter und Malteser. Das dritte ist, dass man trotzdem diese fachliche Beratung sicherstellen kann. Das heißt, da machen nicht alle irgendwas, sondern die lassen sich fachlich beraten und übertragen das auf die Region. Man hat, überspitzt formuliert, pro Krisenszenario jeweils eine Bundeseinrichtung. Wenn Sie Cyber-Angriffe haben, haben Sie das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik in Bonn, wenn Sie das Thema Lebensmittelverunreinigung haben, das Bundesinstitut für Risikobewertung in Berlin, oder bei der Pandemie das Robert-Koch-Institut. Die beraten dann das lokale Gesundheitsamt und das funktioniert relativ gut zurzeit in Deutschland.
Zagatta: Dann hat sich der Föderalismus auch da bewährt, wenn ich Sie richtig verstehe. Dann ist das gar nicht so schlimm, dass die Bundesregierung da relativ spät in die Gänge gekommen ist, mit gemeinsamen Maßnahmen ja eigentlich erst am letzten Sonntag.
Roselieb: Ein solches Vorgehen ist durchaus normal. Man hat bei Pandemien immer zwei große Herausforderungen. Das erste ist, dass es schleichende Krisenfälle sind, die sich über einen sehr langen Zeitraum entwickeln. Das wäre bei sogenannten Ad-hoc-Krisen, dem Flugzeugabsturz oder auch dem Blackout, dem bundesweiten Stromausfall, was ganz anderes. Die wären sofort da.
Konkret beim Fall Corona war es so, dass bereits am 31. Dezember 2019 China die Weltgesundheitsorganisation über das, was dann später Corona hieß, informiert hat. Dann wurde eine "quiet period", eine stille Phase vereinbart, in der sich sowohl China als auch andere Länder, auch Deutschland vorbereiten konnten. Die deutschen Behörden wussten bereits Anfang Januar, dass da irgendwas im Raum steht, was dann heute Corona geworden ist. Stellen Sie sich vor, die hätten damals schon Ausgangsbeschränkungen verhängt oder Kontaktverbote erlassen. Dann säßen Sie jetzt seit drei Monaten zuhause, das wäre völlig unverhältnismäßig. Das zweite Problem ist, dass bei der Pandemie man auch beim eigentlichen Krisenmanagement einen sehr langen Atem braucht. Das sind immer fünf Phasen, die das durchläuft, von Aufklären am Anfang, Händewaschen bis Abschotten, wie wir es jetzt haben, Kontaktverbote am Ende. Und den Takt, den gibt nicht das Virus vor, sondern das Verhalten der Bevölkerung. Auch da greifen dann die Maßnahmen nicht sofort. Nur weil seit einer Woche die Schulen in Nordrhein-Westfalen geschlossen sind, heißt das ja nicht, dass die Zahl der Neuinfizierten sofort zurückgegangen ist. Das sieht für die Bevölkerung dann immer so aus, als hätte die Regierung die falschen Maßnahmen eingeleitet und müsste noch mehr machen. In Wirklichkeit benötigt man einfach eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen Geduld, bis die Maßnahmen greifen.
"Auch beim Katastrophenmanagement gilt der Grundsatz der Marktwirtschaft"
Zagatta: War das dann tatsächlich so ein geplantes Krisenmanagement? Man hatte ja den Eindruck, das ist eine Art Windhund-Rennen, der eine prescht vor und die anderen ziehen dann ganz schnell nach.
Roselieb: Auch beim Krisenmanagement oder besser gesagt beim Katastrophenmanagement gilt natürlich der Grundsatz der Marktwirtschaft, dass es immer verschiedene Wege gibt, wie man das Problem lösen kann, dass da ein Wettbewerb durchaus sinnvoll ist. Das sehen Sie auch, wenn Sie über Deutschland hinausblicken. Wir haben jetzt in Deutschland das Prinzip gewählt, dass wir die Menschen im Prinzip abschotten, dass wir sie zuhause quasi einsperren, etwas überspitzt formuliert. Andere Länder machen das anders. Wenn Sie nach Südkorea blicken, Taiwan oder auch Singapur, dort hat man sich überlegt, wir schränken lieber andere Grundrechte ein, nämlich zum Beispiel das informatorische Selbstbestimmungsrecht. Das heißt: Wenn Sie dort einen Drive-in besuchen, bei dem Sie einen Corona-Test machen können, müssen Sie Ihre Handynummer abgeben, und mit dieser Handynummer erhalten Sie nicht nur das Testergebnis, sondern diese Handynummer würde mit Ihrer Zustimmung – und die müssen Sie im Vorfeld geben – auch genutzt werden, um Ihr gesamtes Umfeld zu informieren. Wenn Sie positiv getestet sind, dann kriegen alle Menschen, mit denen Sie sich längerfristig in einer Funkzelle aufhalten, eine SMS. Das wäre bei uns in Deutschland so nicht möglich, kann aber vielleicht in einigen Jahren kommen, dass man sagt, okay, der Wettbewerb hat gezeigt, die Variante Singapur oder Südkorea war besser. Danach sieht es derzeit in der Tat auch aus. Dann müssen wir unser deutsches Krisenmanagement sowohl bundesweit als auch in den Regionen einfach umstellen.
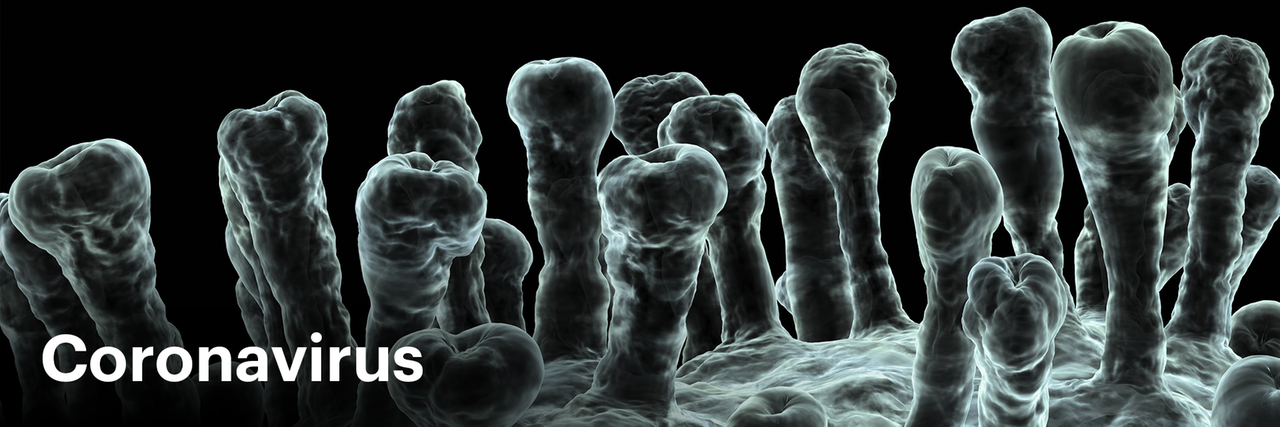
Zagatta: Wie planvoll war das jetzt im Rückblick auf die letzten Wochen? Ihr Institut berät ja Bundes- und Landesbehörden. Hatten Sie denn auf dem Schirm, dass es zu solchen Situationen kommen könnte, oder war das in diesem Ausmaß doch sehr überraschend?
Roselieb: Das Drehbuch für Corona war natürlich längst geschrieben. Es gab 2002 SARS, dann folgten EHEC, Ebola, die Schweinegrippe. Das Ganze wurde 2007 das erste Mal bundesweit länderübergreifend geübt zum Thema Pandemie. Das gab es dann noch mal 2013, da war das eine gemischte Übung. Daraus hat man sehr viel gelernt.
Wir haben jetzt im Nachgang gesehen, dass wir an der einen oder anderen Stelle nachschärfen mussten. Beispielsweise hat man die Katastrophenkommunikation im Laufe der Jahre immer freundlicher gestaltet. Das heißt, da wurde immer weniger mit Befehl und Gehorsam gearbeitet. Wenn Sie in unser Archiv gucken, 70er-, 80er-Jahre, da hat man wesentlich mehr den Befehlston drauf gehabt, wenn man Bürgern etwas in Krisenzeiten gesagt hat. Das war offenkundig auch richtig. Wenn man sich das Verhalten der Bürger jetzt anschaut, dann sagen wir als Chefs, Du kannst ins Home Office gehen; was macht der Mitarbeiter? Der geht abends ins Fitness-Studio. Sie sagen der Mutter, die Schule wird gesperrt; was macht die Mutter? Die schickt ihr Kind am folgenden Wochenende, weil das Wetter gerade schön ist, mit anderen Kindern auf den Spielplatz. Das ist das Gegenteil von dem, was man erwartet. Da werden wir sicherlich nachschärfen müssen. Das gleiche gilt auch beim Thema Hamsterkäufe.
Große Lebensmittellager in Deutschland vorhanden
Zagatta: Das wollte ich Sie gerade fragen. Was ist denn da mit diesem freundlichen Ton? Wir hören immer, es gibt keinen Grund zur Panik, es gibt keine Lieferengpässe, und trotzdem sind die Regale leer, Nudeln, Mehl schwer zu bekommen, Toilettenpapier auch noch. Wie ist das zu verhindern?
Roselieb: Ich würde, ehrlich gesagt, nicht Nudeln kaufen. Ich würde auch kein Toilettenpapier hamstern. Ich würde vielleicht langsam anfangen, Gummibärchen oder Schokoküsse zu hamstern. Es gibt seit vielen Jahrzehnten weit vor Corona in Deutschland rund 150 geheim gehaltene Orte, an denen die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung sehr große Lebensmittellager unterhält. Die sind so dimensioniert, dass man die Bevölkerung in Deutschland für rund drei Wochen komplett autonom versorgen könnte. Da finden Sie nicht die Gummibärchen. Die könnten Sie jetzt wirklich hamstern. Aber alles andere ist da tatsächlich vorhanden. Der Grund dafür, dass man das der Bevölkerung nicht gesagt hat, hängt mit dem Terrorismus zusammen. Es wäre im Moment wesentlich transparenter, was diese Bevölkerungsinformation angeht. Das geht jetzt einfach nicht mehr, weil der Feind sozusagen mithört, und da wird man vielleicht sich auch im Nachgang überlegen müssen, ob man nicht ein bisschen Transparenz zeigt, damit der Bürger nicht auf den Gedanken kommt, für die nächsten 30 Jahre Krisenmanagement Toilettenpapier zu hamstern.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.


