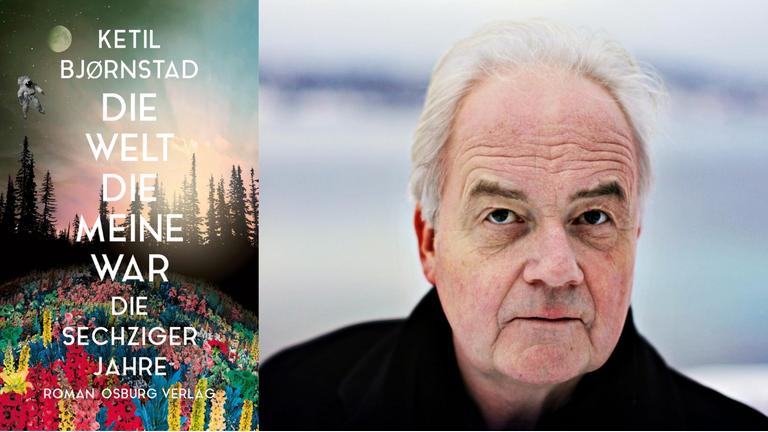Aus Filmen und Romanen kennt man den Augenblick, wenn die Stunde der Wahrheit schlägt: Alte Familiengeheimnisse werden plötzlich gelüftet, die Betroffenen mit verdrängtem Geschehen konfrontiert. Die Handlung schlägt an dieser Stelle im Sinne einer Katharsis um.
Hinter der Schweigemauer
Im Roman "Tage in der Geschichte der Stille" der norwegischen Autorin Merethe Lindstrøm dringt die Wahrheit hinter den Lebenslügen dagegen nur schleichend in das Bewusstsein der Ich-Erzählerin Eva, und, soviel sei schon hier gesagt, eine Katharsis findet nicht statt.
Eva und Simon, sie Mitte sechzig, er hoch in seinen Achtzigern, waren Lehrerin und Arzt. Nun sind beide schon lange pensioniert und leben nach dem Auszug ihrer erwachsenen Töchter ein stilles Leben in einem Vorort von Bergen:
"Ich sehe mich im Haus um, alles hat seinen Platz, ist Teil einer Ordnung. Diese Requisiten von gesellschaftlichen Ritualen, die kaum mehr in bedeutendem Maße vollzogen werden. Unsere Sachen sind nur noch eine wundersame Aufstellung von Erinnerungen. Die alte Uhr über dem Tisch, das Teeservice hinter den verschlossenen Glastüren des Schranks. Durchaus möglich, dass das Haus dafür existiert, diese Sachen zu beherbergen, mehr als uns."
Vergangenheit, bewahrt und vergessen
Hinter der starren Anordnung verbirgt sich ein Geheimnis. Simon ist Jude, der mit seinen Eltern und einem Bruder den Holocaust in einem Versteck überlebte, in einem - nicht näher bezeichneten - Land, das die Deutschen besetzt hatten. Eine Tante, die zurückgeblieben war, wurde entdeckt und mitsamt ihrem Kind deportiert.
Simon versuchte später von Norwegen aus mithilfe von Suchdiensten den Verbleib der Deportierten zu rekonstruieren und damit die Erinnerung an sie zu bewahren. Eva hingegen tat alles, damit niemand, nicht einmal die eigenen Töchter, von Simons Vergangenheit erfuhr, weil es nicht in ihr Bild einer heilen Familie passte.
Ganz allmählich und sehr geschickt entfaltet Lindstrøm Evas Motiv des Verdrängens: Simons Erinnerungen rühren an ein eigenes frühes Versagen.
Simon ist dement und spricht mit niemandem mehr, so als habe das Jahrzehnte währende Schweigen ihn zurückgeführt in das Stadium seiner Kindheit, in dem Stillsein überlebenswichtig war. Bei seiner Frau ist es dieses Verstummen, das den Prozess des Erinnerns in Gang setzt. Als erstes ruft sie eine Deckerinnerung auf: Vor Jahrzehnten drang ein junger Mann in ihr Haus ein, nahm das Geld, das sie ihm panisch anbot und nahm unbemerkt eine ihrer kleinen Töchter mit, die jedoch später unversehrt im Garten sitzt. Für die Frau bleibt der Schrecken über Jahre präsent.
"Die Episode ist in meinen Gedanken wie eingefroren, unveränderlich. Als wäre sie ein Schnitt in oder durch etwas. Ein Riss in einer dicken Leinwand, in einem ganz normalen Tag, und durch diesen Riss ist etwas aufgetaucht, was nicht auftauchen, was nicht zu sehen sein sollte."
Eine Putzfrau, blitzblank und antisemitisch
Dieses Ereignis wird auf der Ebene der Gegenwart gespiegelt durch Marija, die lettische Haushaltshilfe. Marija bringt nicht nur blitzblanke Sauberkeit sondern auch Leben in den monotonen Alltag des Paares. Bis zu dem Tag als Marija, die nichts von Simons Herkunft weiß, sich als Antisemitin entpuppt, indem sie in einem rasenmähenden, lauten Nachbarn einen "Juden" vermutet:
"Sie sagte es auf Lettisch. Und trotzdem verstand ich es. Den Tonfall. Das Wort. Bestimmt ein Jude. Was hast du gesagt, fragte ich. Und sie wiederholte es. Wiederholte ruhig in meiner Sprache, dass er wohl einer von denen sei. Und dann ging es los. Sie hörte nicht mehr auf, redete immer weiter. Hasserfüllt und einfach. Simple Klischees, ausgeleierte Worte, die Sprache verschlissener Phrasen. Über die."
"Sie sagte es auf Lettisch. Und trotzdem verstand ich es. Den Tonfall. Das Wort. Bestimmt ein Jude. Was hast du gesagt, fragte ich. Und sie wiederholte es. Wiederholte ruhig in meiner Sprache, dass er wohl einer von denen sei. Und dann ging es los. Sie hörte nicht mehr auf, redete immer weiter. Hasserfüllt und einfach. Simple Klischees, ausgeleierte Worte, die Sprache verschlissener Phrasen. Über die."
Die Schweigespirale dreht sich weiter: Marija wird in aller Stille entlassen – niemand erfährt den Grund, auch nicht die über die Entlassung empörten Töchter.
Um das Zentrum des Schweigens und Verschweigens kreisend entfaltet der Roman eine Poesie der Düsternis und der Kälte. Ihren alten Hund schickt Eva zum Sterben auf die Straße. Sie pflegt das Grab eines ihr unbekannten jungen Mannes, die eigene Wohnung ist eine Art Grab. Wenn sie ihren Mann in eine Pflegetagesstätte bringt, hat sie das Gefühl, ihn, in Umkehr des Orpheus-Mythos, in der Unterwelt abzuliefern, und während ihr Mann den Tag dort verbringt, sucht sie am liebsten den Friedhof oder die Kirche auf.
Schnittstellen von Schuld
Während Simon sich stumm in sich selbst zurückzieht, übernimmt Eva zunehmend die Erinnerung ihres Mannes. Sie stellt sich Simons kurzsichtigen, kleinen Cousin vor, wie er ohne Brille die Deportation erlebt und entdeckt in diesen Phantasien den Bodensatz ihrer eigenen verdrängten Schuldgefühle. Sie hat als junge Frau, bevor sie Simon kannte, einen Sohn zur Adoption gegeben:
"Aber nicht der Junge, der wahrscheinlich fünf- oder sechsjährige Vetter, war in meinem Kopf gewesen. Sondern mein Sohn, ein halbes Jahr alt, an dem Nachmittag in dem Büro, als ich ihn weggegeben habe. Ich weiß nicht, was ich fühle, wenn ich daran denke. Ich sehe sein Gesicht vor mir, in dem Moment bevor man ihn wegbrachte, als ich dazu ermutigt wurde, mich zu verabschieden, ihn zu umarmen, so erinnere ich mich zumindest, und er hat mich angesehen, die Einzige im Raum, die er kannte."
Politisch verweist "Tage in der Geschichte der Stille" auf eine Kontinuität des Schweigens gegenüber Antisemitismus, psychologisch auf die allmähliche Wiederkehr einer verdrängten, schmerzvollen Vergangenheit.
Poesie des Fatalismus
Stilistisch gibt er Anlass zur Kritik: Das häufige Sich-selbst-befragen, die wiederholten Zweifel des erzählenden Ichs, mögen die Brüchigkeit der Erinnerung betonen, erzeugen beim Leser jedoch Unsicherheit und hemmen den Erzählfluss. Auch explizite Erklärungen, in der Art, dass Schuld wohl mehr als alles andere einen Menschen an einen anderen binde, machen die Lektüre etwas zäh. Man gewinnt den Eindruck, als trete nicht nur das Leben der beiden Alten, sondern auch die Erzählung auf der Stelle.
Andererseits entfaltet der Text über weite Strecken eine Poesie der Trostlosigkeit und des Fatalismus, die man von anderen norwegischen Narrationen kennt. Hervorzuheben ist auch die verblüffende thematische Dichte des Romans: Lindstrøm gelingt es, die Schnittstellen des verdrängten Schmerzes in der Innenwelt eines Paares zu beschreiben und sie mit alten und neuen Formen des Antisemitismus zu verbinden.
Merethe Lindstrøm: "Tage in der Geschichte der Stille"
Aus dem Norwegischen von Elke Ranzinger
Matthes und Seitz Verlag, Berlin. 222 Seiten, 22 Euro.
Aus dem Norwegischen von Elke Ranzinger
Matthes und Seitz Verlag, Berlin. 222 Seiten, 22 Euro.