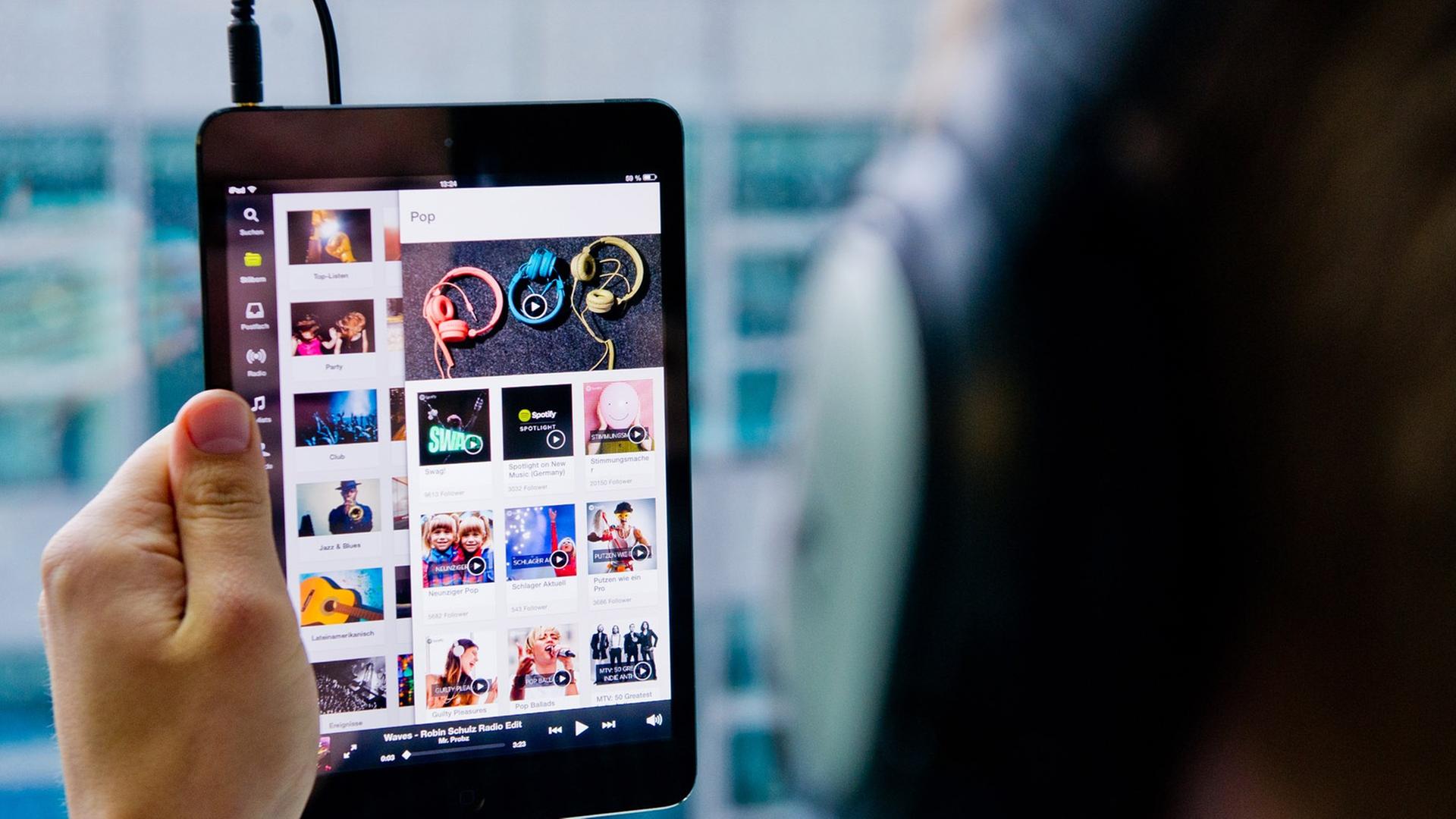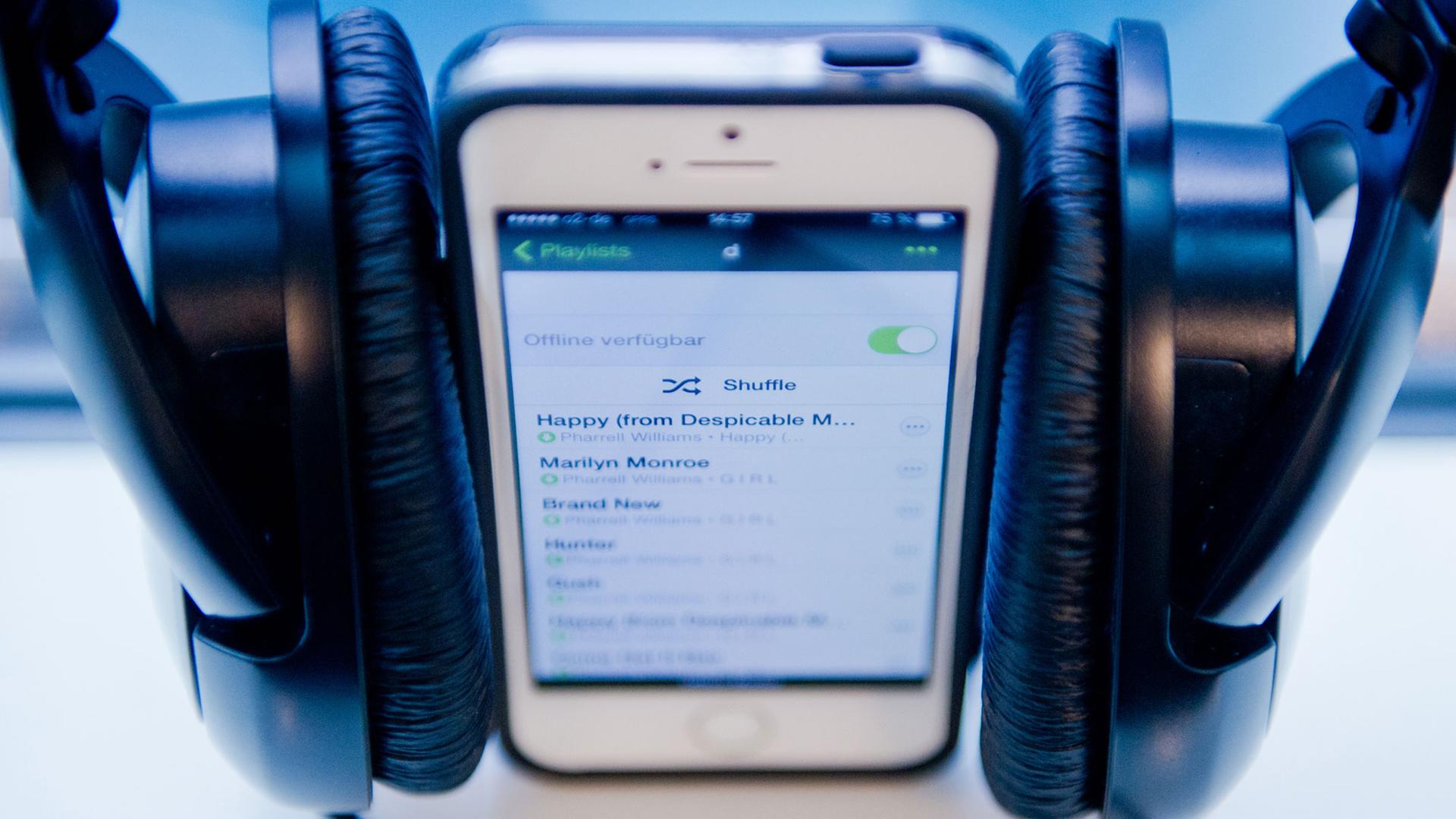"2016, sagt New York Times Musikkritiker Jon Caramanica, war ein extrem wichtiges Jahr für das Musikstreaming. Es entwickelt sich eine eigene Streaming-Ästhetik, inspiriert von Dance Music, das Tempo ist "hot but not too hot", und der kanadische Rapper Drake ist ganz vorne mit dabei, wenn es um diese Art von Musik geht.
Drake: Der meist gestreamte Künstler 2016. Sein Stück "One Dance", das erste in der Musikgeschichte, das bei Spotify über eine Milliarde Mal abgespielt wurde.
Ein dahin dümpelnder Popsong, nicht wirklich aufregend, nicht wirklich störend – typische Musik für das Streaming-Zeitalter?
"Um diese Frage zu beantworten, muss man wissen, dass der Klang von Musik immer schon mit dem Abspiel-Medium und dem Ausspielweg verbunden war."
Jason Moss, Musikproduzent aus Los Angeles. In den 1960ern etwa: Motown. Das Soul-Label. Perfekt produzierte Radio-Hits.
"Die Songs waren gerade so lang, dass man perfekt Werbung dazwischen spielen konnte. Sie hatten lange Intros ohne Gesang, als Unterlage für den Moderator, der darüber sprechen konnte. Diese Platten waren wie für das Radio gemacht."
"Hip Hop und das Medium CD sind intrinsisch verlinkt"
Dann kam die CD. Alben wurden länger und lauter, die Bässe tiefer. Kein Wunder, meint Moss, dass Hip Hop zur gleichen Zeit populär wurde wie die CD.
"If you look at the rise of Hip Hop. To me it is no surprise that that genre came to prominence and the same time as the CD. I think the two are intrinsically linked."
Schließlich digitale Downloads: Die Single ist zurück. Tracks statt Alben. Die Industrie auf Krücken – CD-Verkäufe brechen ein.
"Jetzt, wo also Streaming immer wichtiger wird, ist anzunehmen, dass sich auch die Art und Weise verändert, wie Musik gemacht wird – und wie sie dann am Ende klingt."
Labels sind heute Sklaven der Statistik
Jahrzehnte lang haben Labels Musik einmalig verkauft. Als Schallplatte, CD oder mp3. Den Labels war egal, ob eine CD hunderte Male abgespielt wurde – oder kurz nach dem Kauf unter dem Autositz verschwunden ist. Sie hatten ihr Geld. Beim Streaming ist das anders. Labels sind heute Sklaven der Statistik. Sie gieren nach Plays. Cash macht Musik, die wieder und wieder abgespielt wird. Die sich festsaugt an den Fans. Musik für den Marathon statt für kurze Sprints.
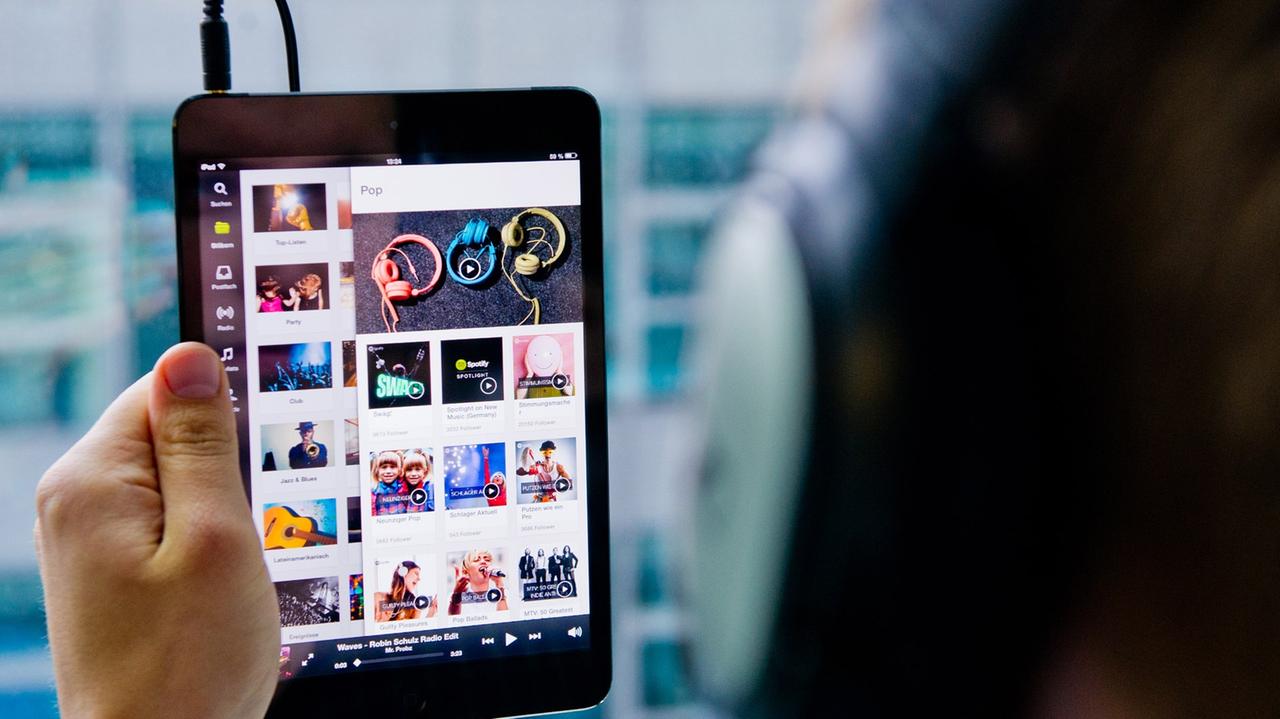
"Hits, die kurz hell leuchten, aber dann genau so schnell wieder vergessen sind, wird es weniger geben. Musik muss langfristig funktionieren. Sie muss eine tiefere Bindung mit dem Hörer eingehen als bislang."
Aktuelle Hits wie "One Dance" von Drake oder das sehr ähnlich klingende "Shape Of You" von Ed Sheeran sind dann auch nicht laut und auffällig, sondern eher schüchtern – aber auch nicht zu schüchtern. "Hot but not too hot".
"Wenn man das weiter denkt, kann man sich auch fragen: Wer sagt eigentlich, dass ein Song immer genau gleich sein muss? Er könnte sich ja auch über die Zeit verändern. So dass etwa nach hundert Plays ein zusätzlicher Vers auftaucht."
Ist die Entwicklung positiv für Hörer oder die Industrie
Musik als fluides System, das sich verändert. Teilweise gibt es das schon. Kanye West hat Stücke seines Albums "The Life Of Pablo" mehrfach im Nachhinein verändert. Brian Eno hat eine App entwickeln lassen, die "generative Musik" produziert. Ein Code steuert den Sound.
Noch ist das, was Jason Moss beschreibt, Zukunftsmusik. Aber: Labels haben heute Zugriff auf unendlich viele Daten: Sie können genau sagen, welche Musik gut funktioniert. Das wird den Klang der Musik verändern. Für Fans sei das aber eigentlich eine gute Sache. Die Musik nähere sich ihren Hörgewohnheiten an.
"I think it is going to open up a deeper connection, really creating an experience that is going to have people coming back again and again and again."
Also eine Art popmusikalische Filterblase. Für Fans eigentlich gar keine gute Nachricht. Denn Musik ist doch auch gerade dann gut, wenn sie aneckt und vom typischen Muster abweicht. Jason Moss argumentiert zwar aus Sicht eines Fans – tatsächlich scheint er aber doch eher Profit machen zu wollen.
"Als Hörer ist das doch unglaublich. Ich glaube nicht, dass es jemals eine bessere Zeit gegeben hat, ein Musikhörer zu sein. Und was gut für den Hörer ist – ist gut für die Industrie. Ende der Debatte."