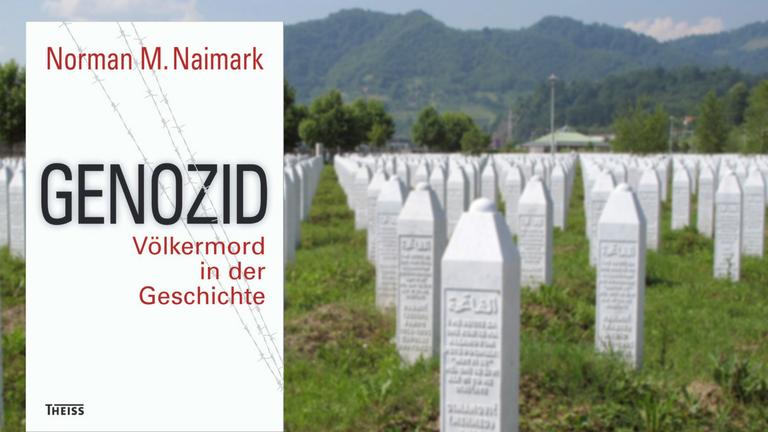Am Abend des 6. April 1994 erschüttert eine Explosion die ruandische Hauptstadt Kigali. Das Flugzeug, in dem auch Ruandas Präsident Juvénal Habyarimana sitzt, ist abgeschossen worden. Zeitzeugen erinnern sich, wie danach kurz die Zeit stillzustehen scheint. Dann beginnt das Morden.
"Die Täter sind gekommen, wo wir versteckt waren, mit meinem Mann und vielen anderen Kollegen und der Familie von meinem Mann. Jemand hat uns verraten, wo wir sind, und diese Nacht haben sie nur die Männer und die Jungen genommen, und zu den Frauen und Kindern haben sie gesagt: sie kommen später wieder."
Esther Mujawayo und ihre Töchter haben den Genozid wie durch ein Wunder überlebt, sagt sie heute. Als die Massaker nach gut 100 Tagen enden, werden Hutu-Extremisten ihren Mann, ihre Eltern, ihre Schwester und deren Familie getötet haben. Insgesamt wird die Zahl der Opfer auf 800.000 bis eine Million geschätzt, die meisten von ihnen Tutsi wie Mujawayo.
"Jeden Tag haben sie 'gearbeitet', wie sie sagten. Jeden Tag haben sie getötet. Und sie haben sichergestellt, dass sie fast jeden erwachsenen Hutu involvierten, und deswegen sind die Konsequenzen auch so furchtbar. Du hast so viele Getötete, aber es wurden auch so viele Leute zu Tätern gemacht."
Todeslisten im ganzen Land
Der Völkermord an den Tutsi war minutiös vorbereitet. Seit Wochen hatten Drahtzieher im ganzen Land Macheten und Gewehre an aufgehetzte Hutu-Extremisten verteilt. Noch bevor nach dem Flugzeugabsturz der Morgen graute, standen überall im Land Straßensperren, an denen Tutsi massakriert wurden. Die Täter kontrollierten die Ausweise. Stand Tutsi darauf, wurden die Menschen ermordet. Stand Hutu darauf, mussten die Menschen mitmachen. Andere Täter fuhren mit Autos durch das Land und arbeiteten Todeslisten ab. Im Propagandasender Radio des Mille Collines wurden sie angefeuert, nicht einen der als "Ungeziefer" verfemten Tutsi am Leben zu lassen:
"Hier eine Nachricht an alle Kakerlaken, die uns zuhören: Ruanda gehört jenen, die es verteidigen. Und ihr Gewürm seid keine Ruander. Alle haben sich jetzt erhoben, um Euch Ungeziefer zu bekämpfen: Das Militär, die Jugend, die Alten und sogar die Frauen. Keine Kakerlake wird uns entkommen."
Die Welt hätte die Tutsi schützen können. Denn die UNO war vor Ort. Mehr als 2.500 Blauhelm-Soldaten sollten einen brüchigen Frieden zwischen der Armee und Rebellen gewährleisten. Doch ihr Mandat erlaubte es nicht, Zivilisten zu schützen. Einen Tag nach Beginn des Massenmords erschossen Hutu-Extremisten außerdem zehn belgische Blauhelm-Soldaten. Für Ravinder Bhavnani, der am Genfer Graduate Institute zum Genozid in Ruanda geforscht hat, eine kalkulierte Tat.
"Für mich ist klar, dass das ruandische Regime wusste, dass die internationale Gemeinschaft auf einen Völkermord nicht reagieren würde. Die USA hatten noch an ihrer Niederlage in Somalia ein halbes Jahr zuvor zu knabbern. Und in Ruanda wusste man, dass der Westen sehr sensibel auf Tote aus den eigenen Reihen reagieren würde. Der Mord an zehn belgischen Blauhelmsoldaten unmittelbar nach Beginn des Genozids war genau darauf abgestellt."
Versagen der Weltgemeinschaft
Der Plan ging auf. Trotz des Blutbads griff die Welt nicht ein, sondern wandte sich ab. Die Belgier flogen ihre Blauhelm-Soldaten aus. Und sie waren nicht die einzigen, die gingen. Der Kommandeur des UN-Einsatzes, Roméo Dallaire, erinnert sich:
"Wir sprechen von vier Millionen Menschen, die innerhalb von wenigen Tagen in alle Richtungen flohen und an Schlagbäumen abgeschlachtet wurden. Tausende von denen, die es irgendwie ins Lager geschafft haben, sind später an Cholera gestorben. Und die internationale Gemeinschaft und fast alle Hilfsorganisationen haben ihre Sachen gepackt und sind verschwunden. Die einzigen, die am Ende geblieben sind, war meine kleine Einheit vom zum Schluss noch 450 Blauhelmsoldaten und das Rote Kreuz."
Für Esther Mujawayo brach mit dem Abzug der UN-Soldaten eine Welt zusammen. Sie hatte sich wie so viele andere Ruander auf den Schutz der Weltgemeinschaft verlassen und stand auf einmal schutzlos da.
"Was für mich persönlich so schrecklich war: Ich habe die gebeten, bitte, bitte, nehmen sie meine Kinder, eine belgische Freundin aus Uni-Zeit wartet für die Kinder, ich habe Pass, alles in Ordnung, bitte nehmen sie mindestens meine Kinder. Und sie haben nein gesagt. Und sie haben die französischen und belgischen Nachbarn mitgenommen mit Hund und Katz. Und ich habe gedacht: ich kann nicht mehr, unser Wert ist weniger als ein Hund oder eine Katze."

Der Abzug der Truppen und die Verweigerung eines robusten Mandats für Dallaires zurückbleibende Einheiten sind nicht die einzigen Versagen der Weltgemeinschaft in diesem Völkermord. Es begann viel früher, Monate bevor das Flugzeug mit Präsident Habyarimana an Bord abgeschossen wurde. Wer hinter dem Anschlag steckt, ist bis heute umstritten. Vieles spricht dafür, dass die Extremisten selber den Präsidenten abschossen, um die von ihm vereinbarte Machtteilung mit den Tutsi-Rebellen unter der Führung Paul Kagames zu verhindern. Fest steht, dass die Welt hätte wissen können, dass ein Völkermord drohte. In einem vertraulichen Telex schrieb Roméo Dallaire bereits am 11. Januar 1994 an die UNO-Zentrale in New York, was ein hochrangiger Ausbilder der späteren Mörder ihm mitteilte:
"Er ist beauftragt worden, alle Tutsi in Kigali aufzulisten. Er vermutet, das Ziel ist ihre Ermordung. Als Beispiel gab er an, seine Truppen wären in der Lage, innerhalb von zwanzig Minuten eintausend Tutsi hinzurichten."
Zweifelhaftes Verhalten der Bundesregierung
Doch der Sicherheitsrat und der damalige Chef der Friedenseinsätze im UN-Hauptquartier, Kofi Annan, zogen keine Konsequenz daraus. Die Zeichen waren überall zu sehen. Mitarbeiter von Hilfsorganisationen in Ruanda schraubten schon lange freitags die Lenkräder ihrer Lastwagen ab, weil sie erfahren hatten, dass einige Angestellte, Hutus, die Autos am Wochenende zur Verteilung von Waffen nutzten. Und auch in der damaligen Bundeshauptstadt Bonn wusste man früh Bescheid, sagt Philipp Rotmann, der stellvertretende Direktor des Global Public Policy Institute in Berlin:
"Deutschland war 1993, direkt im Jahr vor dem Völkermord, der größte entwicklungspolitische Geber Ruandas, Deutschland hat eine von nur einer Handvoll militärischer Beratergruppen in Afrika in Ruanda gehabt. Die Bundesregierung, der Bundestag, hat durchaus Informationen bekommen über die Eskalation der Gewalt und die Risiken, einige dieser Informationen sind vor Ort und auf dem Berichtsweg unterdrückt worden, auch das ein Thema, das noch bei weitem nicht im Detail aufgearbeitet worden ist. Aber man wusste viel mehr, als man sich das heute wahrscheinlich denkt."

Bis heute hält das Auswärtige Amt Akten unter Verschluss, die die Rolle Deutschlands und damals gemachte Fehler aufklären könnten. Einem - unter Federführung der grünen Abgeordneten Margarete Bause - entstandenen Antrag, die deutsche Rolle im Genozid wissenschaftlich aufzuklären, schloss sich diese Woche im Bundestag nur die Fraktion der Linken an. Das Auswärtige Amt macht seine Mithilfe, nach eigenen Angaben, davon abhängig, wer genau die Untersuchung vornehmen will. Dabei könnte eine Aufklärung der Geschehnisse von damals helfen, zukünftige Völkermorde zu verhindern, glaubt Rotmann.
"Entscheidend ist die Frage, was wir für heute lernen können, was wir für Situationen wie den Völkermord an den Jesiden vor ein paar Jahren oder die Frage, ob wir in Kamerun heute ein Völkermordrisiko sehen in einem extrem aufgeladenen Konflikt zwischen der anglophonen und der frankophonen Bevölkerungsgruppe. Für solche Fragen müssen wir lernen, an welchen Stellschrauben wir solche Situationen erkennen können und was wir dagegen tun können, bevor es zu spät ist."
In Ruanda wollte die Welt den Völkermord nicht sehen. Vielleicht, weil sie dann hätte eingreifen müssen. Vielleicht, weil das Schreckliche so unfassbar war, wie Roméo Dallaire später sagt:
"Meine eigene erste Reaktion war, den Völkermord zu leugnen. Ich habe mir gesagt, das kann einfach nicht sein. 1994 hatten die jüdische Gemeinschaft und unsere Regierungen doch seit 45 Jahren immer wieder an den Holocaust erinnert. Das Versprechen lautete: Niemals wieder. Und deshalb konnte das doch nicht sein. Ein Genozid, das war unvorstellbar."
Kein organisierter Heilungsprozess
Für die Tutsi kam der Genozid weniger überraschend. Esther Mujawayo musste zum ersten Mal fliehen, als sie ein Jahr alt war und das Haus ihrer Eltern niedergebrannt wurde. Das war 1959, das erste Pogrom gegen die Tutsi. Schon damals, noch unter belgischer Kolonialherrschaft, habe niemand die Täter zur Rechenschaft gezogen, und das sei nach der Unabhängigkeit 1962 so weiter gegangen.
"Niemand ist bestraft worden. Dann kommt '73, sogar ein Schritt höher, nicht nur die Häuser zu verbrennen, die Kühe zu nehmen, alles geplündert, sondern diesmal gehen sie einen Schritt weiter, alle Tutsi verloren ihre Jobs, mussten raus aus Schule, Uni. Ich war selber im Gymnasium, in der 10. oder 11. Klasse, ich bin rausgeschmissen worden und kam nach Hause, und es gab kein Haus mehr, das war schon verbrannt."
Der Völkermord 1994 endete erst, als die Rebellenarmee unter der Führung des heutigen Präsidenten Paul Kagame die Hutu-Extremisten besiegte. Französische Soldaten, die Zivilisten schützen sollten, ermöglichten es vielen Tätern in letzter Minute, in den benachbarten Kongo zu fliehen. Doch es blieben zehntausende, einige sagen hunderttausende Täter zurück, zu viele für die Gerichte. 80 Drahtziehern wurde bis Ende 2015 vor einem Internationalen Tribunal in Arusha der Prozess gemacht, der Rest musste sich vor einem der landesweit 11.000 Gacaca-Gerichte einem traditionellen Verfahren vor der Dorfgemeinschaft stellen. Ariane Inkesha, die für die Organisation 'Interpeace' Versöhnungsprogramme in Ruanda ausrichtet, sieht die Gacaca-Prozesse, bei denen Täter und Opfer aufeinandertrafen, mit gemischten Gefühlen:
"Es gab keinen organisierten Heilungsprozess, der den Gacaca-Verfahren gefolgt wäre. Leute wurden ohne Unterstützung alleine zurückgelassen, nachdem sie ihre Herzen öffentlich ausgeschüttet hatten."
Manche halfen sich selbst, so wie Esther Mujawayo, die mit anderen Witwen des Genozids bald in Ruanda eine Selbsthilfegruppe gründete. Auch aus Rache, wie sie sagt.
"Ich denke, wenn man alles verloren hat, man kann entweder am Boden bleiben oder etwas machen, und das hat uns gerettet, denn wir haben entschieden, wir haben gar nichts mehr zu verlieren, so lasst uns wieder zum Leben kommen. Für uns war das unsere einzige Rache. Wir haben gefunden, die beste Rache ist, den Leuten, die uns tot und kaputt haben wollten, dass die uns jetzt müssen lebendig sehen, aber lebendig lebendig."
Wem das nicht gelang, der blieb traumatisiert zurück, glaubt Ariane Inkesha:
"Dieser Völkermord fand in unmittelbarer Nähe statt. Die Mörder waren deine Nachbarn oder sogar entfernte Verwandte, weil die Ideologie ja lautete, dass da ein ganzes Volk ausgerottet werden sollte. Solche Gewalt berührt jeden."
Weiter viel Misstrauen
Heute, 25 Jahre nach dem Genozid, leiden nicht mehr nur die Überlebenden von einst unter den Folgen der massiven Gewalt. Inkesha verweist auf eine Studie aus dem vergangen Jahr, nach der gerade junge Ruander alten Mustern folgen.
"Die Forscher haben herausgefunden, dass fast jeder Fünfte zwischen 24 und 35 Jahren noch immer die gleichen Vorurteile hat, die zum Völkermord geführt haben. Das sind wirklich junge Leute, die den Genozid nicht erlebt haben oder noch ganz jung waren. Und trotzdem gehen sich die Gruppen in der Schule aus dem Weg. Jugendliche sind misstrauisch oder hassen die andere Gruppe sogar, weil das so an sie weitergegeben worden ist."
Inkeshas Erkenntnisse widersprechen der öffentlichen Lesart. Ex-Rebellenführer Paul Kagame, der seit der Beendigung des Völkermords faktisch und seit seiner Wahl zum Präsidenten vor 19 Jahren auch offiziell die Macht im Staat besitzt, spricht bei jeder Gelegenheit vom "neuen Ruanda", so auch bei einem Auftritt an der renommierten Harvard-Universität:
"Ruanda heute ist ein verwandeltes Land. Wir leben mit unserer Vergangenheit, aber sie bestimmt nicht unser Leben. Ruanda ist nicht nur in Afrika, sondern auch im globalen Vergleich ein Spitzenreiter wenn es um Wirtschaftswachstum geht, um das Investitionsklima, um Gesundheitsversorgung, Bildung, Verbrechens- und Korruptionsbekämpfung, Frauenförderung und das Vertrauen in öffentliche Einrichtungen. Und das gilt auch für persönlichen Wohlstand und Freiheit."

Der Aufstieg von Kagames Ruanda ist unbestreitbar. Doch nicht nur Wahlergebnisse von offiziell 98 Prozent und die Verhaftung zahlreicher Oppositioneller in den letzten Jahren und Jahrzehnten lassen viele von einer Autokratie sprechen. Kagame selbst weist solche Vorwürfe zurück und wirft Kritikern wie der umstrittenen Politikerin Victoire Ingabire seinerseits vor, aus dem Völkermord nicht gelernt zu haben. Bei Christiane Amanpour sagte Kagame im März 2010:
"Ingabire ist nach 17 Jahren im Ausland nach Ruanda zurückgekommen. Die Regierung hat ihr einen Pass ausgestellt und dann kam sie zurück mit der Ankündigung, gegen mich als Präsidentin zu kandidieren. Noch am Tag ihrer Ankunft erklärte sie, es habe einen Völkermord an den Tutsi gegeben, aber auch einen an den Hutu. Das war fast die gleiche Sprache, mit der der Völkermord angefacht wurde."
Wenige Wochen nach dem Interview wurde Ingabire verhaftet und schließlich zu 15 Jahren Haft verurteilt. Als sie im vergangenen September vorzeitig entlassen wurde, gab sie sich in der Deutschen Welle kämpferisch:
"Nein, ich bedaure nicht, was ich in der Vergangenheit gesagt habe. Und ich habe niemals gesagt, dass es in Ruanda einen doppelten Völkermord gegeben habe. Ich habe lediglich gesagt, dass es auch Gerechtigkeit für die Verbrechen geben muss, die an den Hutus begangen wurden. Vielleicht hätte ich das nicht an der Gedenkstätte für die Opfer des Genozids sagen sollen, das tut mir leid und dafür möchte ich mich auch heute noch einmal bei all jenen entschuldigen, die ich verletzt haben könnte. Aber was ich gesagt habe, war die Wahrheit."
Lehren aus dem Völkermord
Die Angst, dass Politiker wie Ingabire den Völkermord zu ihrem Vorteil relativieren wollen, ist groß. 25 Jahre nach dem Blutbad sind die Taten nicht vergessen, sind die Täter noch am Leben. Esther Mujawayo, die heute in Deutschland als Traumatherapeutin arbeitet, glaubt dennoch nicht daran, dass die Vergangenheit sich wiederholen wird.
"Wir haben keine Wahl, wir müssen zusammen leben. Es gibt keinen Ort für Hutu, keinen Ort für Tutsi, wir haben immer zusammen gelebt. Und das ist auch ein Vorteil, ich brauche meinen Nachbarn und er braucht mich, wir leben zusammen."
Mujawayo ist überzeugt, dass Ruanda aus dem Völkermord gelernt hat. Doch hat auch die Welt Lehren gezogen? Immerhin wurde nach Ruanda der Internationale Strafgerichtshof gegründet, der Völkermördern als Abschreckung dienen soll. Und die UNO beschloss das Konzept der Schutzverantwortung, das Staaten verpflichtet, in Fällen schwerer Massenverbrechen wie Völkermord einzugreifen. Doch in der Praxis reicht das alles nicht, sagt der Genfer Konfliktforscher Ravinder Bhavnani.
"Syrien, Jemen, Sudan, das sind nur ein paar Beispiele dafür, dass wir von Ruanda nichts gelernt haben. Gerade der syrische Bürgerkrieg ist so ein eindeutiger Fall von staatlicher Gewalt, und es steht fest, wer die Schuld dafür trägt. Aber die globale Antwort darauf ist bestenfalls eine Schande. Die Verfolgung von Kriegsverbrechen und Kriegsverbrechern könnte uns voran bringen, aber dafür müsste das System deutlich effizienter werden. Die Straflosigkeit, echt und gefühlt, muss ein Ende haben."
In Deutschland ist die Verhinderung von Völkermord und anderen schwersten Menschenrechtsverbrechen seit 2017 Staatsräson. So steht es in den Leitlinien der Bundesregierung zur Krisenprävention. Doch ob dieses Versprechen den Praxistest bestehen wird, einen neuen Völkermord wie in Ruanda zu verhindern, muss sich erst noch zeigen.