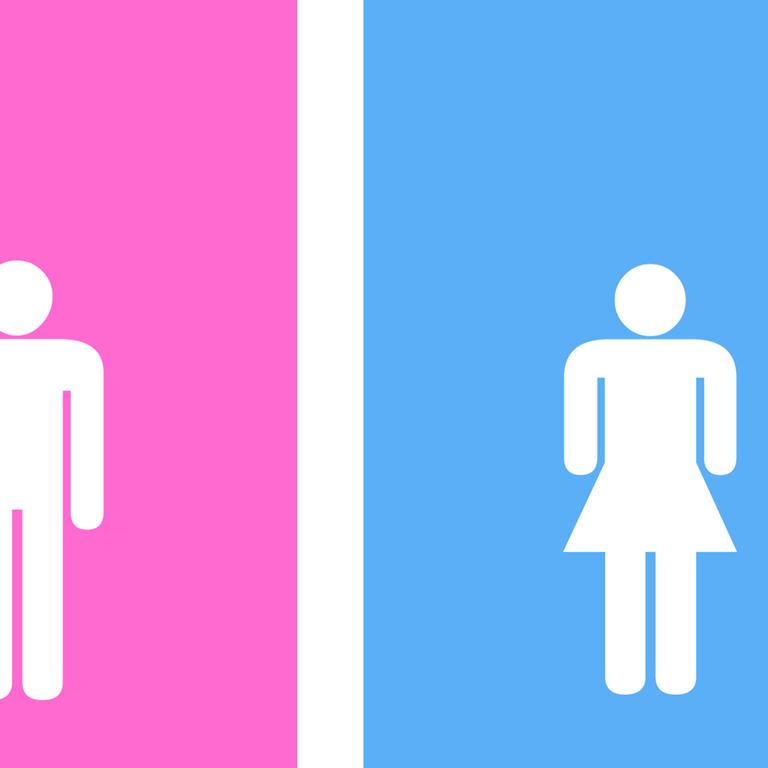Das Waschen, Putzen, Kinderhüten liege nun mal in der Natur des Weibes. Deshalb solle man die Frauen nicht überfordern und ihnen als Lebenszweck die Häuslichkeit zur Pflege überlassen – während die Staatsangelegenheiten, die Wissenschaften und die schönen Künste ganz denen gehören, die von Natur aus dafür begabt seien: den Männern. Mit diesem Argument reagierten im 18. und 19. Jahrhundert Presse, Politik und Publizistik auf die ersten tastenden, aber auch schon nachdrücklichen Versuche der Frauen, gleiche Rechte, gleiche Bildung und gleichen Status zu erlangen. Für diese frühen Feministinnen, – sagen wir mal: seit der französischen Revolution – stand alles auf dem Spiel. Sie liefen in immer größerer Anzahl Sturm gegen das Vorurteil, von Natur aus aufs Haus beschränkt zu sein. Sie mussten mit ihrem Gleichheitsverlangen durchdringen, gegen alle Widerstände. Das ist bis heute so.
Gleiche Rechte, gleiche Chancen
Was dabei zerrieben wurde und schließlich fast gänzlich auf der Strecke blieb, ist die Kategorie der Natur. In dem Maße, in dem das wissenschaftliche und das philosophische Denken die religiösen Dogmen abschüttelte, zog sich auch der Schöpfer der Natur, der liebe Gott, aus der Debatte zurück, respektive: Er wurde hinausgedrängt. Und sein Kind, die Natur, gleich mit. Das war sein Schicksal seit der Aufklärung. Der Mensch stand jetzt im Mittelpunkt und mit ihm die Kultur, sein Werk. Und wenn man über das Sosein der Geschlechter stritt, ließ man die Natur gern ganz beiseite. Die Frauen hatten dafür besonders triftige Gründe, denn im Namen der Natur waren ihnen Gleichheit und Freiheit aberkannt und dafür alle möglichen Defizite zuerkannt worden: Schwachheit, Gefühligkeit, Kleingeistigkeit. Wer klug war, begriff, dass diese Entwertung durch Machtkämpfe entstand und nicht durch die Natur. An die Stelle der natürlichen Unterschiede, denen Mann und Frau sich zu unterwerfen hätten, rückte im frauenrechtlerischen Diskurs das Postulat der Gleichheit, das die Hierarchie zwischen den Geschlechtern auflösen sollte. Gleiche Rechte, gleiche Chancen, volle Eigenständigkeit – das alles konnte für und von Frauen errungen werden, denn es hing mit Politik und Gesellschaft zusammen und nicht mit der Natur.
Reste von Mutterkult
Die Männer hielten, wenn sie, angeregt von den Frauen seit dem 18. Jahrhundert, über den Geschlechterunterschied nachdachten, an der Kategorie der Natur lange eisern fest – sie war einfach zu günstig für sie, denn aus ihr ließ sich folgern: Da kann man nichts machen. Es ist nun mal so. Zwar hatten auch die Existenz und Lebensweise der Männer mit Natur zu tun. Sie sagten, um sich zu definieren: "Das geht mir wider die Natur" oder sie bezeichneten sich als "Kraftnatur", während sich Frauen im günstigsten Fall mit der "Frohnatur" zufrieden geben mussten. Aber Männer wuchsen, so fanden sie selbst, über natürliche Gegebenheiten weit hinaus; Frauen galten als enger mit der Natur verbunden, also als den Tieren näher und dem analytischen, erfinderischen menschlichen Geist ferner als die Männer. Ähnlich dachten lange auch die Frauen, besonders die ganz frommen, und sogar die frühen Feministinnen verbanden den Kampf um Gleichstellung zeitweilig noch mit Resten von Mutterkult: Wenn die Männer etwas Besonderes hatten, ihre Stärke und ihren Geist, dann wollten sie auch etwas Besonderes haben, und das war ihre Befähigung zur Mutterschaft. Aber nach und nach, Ende des 19. Jahrhunderts, wurde auch diese Restgröße aus den Vorstellungen von Natur in den Hintergrund verwiesen, die "Gleichheit" befreite sich tendenziell von allen Sonderfällen und Ausnahmen und blieb handlungsleitend. Das war für die Emanzipation nötig, und es war eine erfolgreiche Denkstrategie.

Simone de Beauvoir hat gegen Mitte des vorigen Jahrhunderts mit dem Satz: "Man wird nicht als Frau geboren, man wird es", Thema und Strategie noch einmal nachdrücklich gesetzt. Jetzt wussten die Frauen: Sie hatten ihr Schicksal selbst in der Hand. Das Zitat wird auch oft so abgewandelt: "Wir werden nicht als Frauen geboren, wir werden dazu gemacht." Hiermit ließ sich die Verantwortung für das Frauenbild und für die Vorgaben, die Mädchen als Kinder, Jugendliche und Erwachsene zu beachten hatten, ganz auf die Gesellschaft, die Gesetzgebung, die Erziehung übertragen. Natürliche Gegebenheiten wurden weggekürzt. Wenn die Männer ihre Überlegenheit betonten, wenn sie sagten: "Das ist nun mal so", wenn sie auf Gott und seine Schöpfung verwiesen, dann mussten sie nun einsehen: Diese Ausrede hielt einfach nicht mehr stand.
Die Familienpolitik reagiert
Im 20.Jahrhundert ging die Emanzipation große Schritte in Richtung Gleichheit: Frauen konnten studieren, sie durften wählen und die Scheidung einreichen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Gleichberechtigung hier in Deutschland in die Verfassung eingeschrieben. Und die Familienpolitik reagierte: Die Freizügigkeit für Frauen wurde durchgesetzt, Frauen gingen arbeiten und verwalteten ihr Einkommen selbst, und auch in Fragen der Familienplanung und Haushaltsführung hatte jetzt nicht mehr der Gatte per Gesetz das letzte Wort. Viele weitere Schritte folgten. Es war ein Siegeszug. Und die publizistische Begleitmusik dieser Prozesse kam ziemlich gut ohne den Begriff der Natur aus. Dessen Funktion als Vorwand auf Seiten der Ewiggestrigen hatte ihn so tief desavouiert, dass man und frau ihn im Kontext von Frauenemanzipation einfach nicht mehr ertrug.
Fauxpas im feministischen Diskurs
In anderen Kontexten wie zum Beispiel der Ökologie war die Natur hochwichtig, aber im feministischen Diskurs beging einen Fauxpas, wer sich auf sie bezog. Keine Frau wollte sich mehr sagen lassen, dass sie ihren Lebenszweck verfehlte, wenn sie keine Kinder bekam. Und immer weniger Frauen mussten sich so etwas anhören. Ein Bewusstseinswandel hatte stattgefunden. Waren Frauen womöglich nicht bloß Frauen, sondern ganz wie die Männer auch Menschen, die ihre Lebensziele selbst wählen wollten? Waren sie vielleicht sogar gleich ausgestattet mit Eigenschaften, Fähigkeiten, Sehnsucht und Ehrgeiz? Eine große Nachdenklichkeit resultierte in einer neuen Politik der Gerechtigkeit: Es gab Frauenbeauftragte, Quoten und girls‘ days… Frauen machten ihr Leben jetzt selbst.
Zu Beginn unseres Jahrhunderts sah es so aus, als sei die Emanzipation vollendet und man könne erleichtert zu anderen heißen Fragen übergehen. Dann stellte sich heraus: Es stimmt nicht, der gleiche Lohn ist nicht durchgesetzt, die Gewalt gegen Frauen nicht gestoppt und der Anteil praktizierender Väter und Hausmänner verschwindend gering. So wie auch der Anteil von Frauen in Spitzenpositionen. Woran lag das? Die Quote wurde erneut Streitthema, Antidiskriminierungsgesetze wurden erlassen, Gelder im Bildungswesen an Frauenförderung geknüpft. Unruhe und Unzufriedenheit kehrten zurück mit der Einsicht: Die Gleichheit ist nicht durchgesetzt.
Es hätte der Moment sein können, in dem das Bezugsfeld "Natur" sich erneut auf die Agenda hätte stehlen wollen – aber es kam anders. Wer im feministischen Diskurs auf die Natur verwies, wer also zum Beispiel die Neigung großer Teile der jungen Frauengeneration, ihren beruflichen Ehrgeiz der Familie zu opfern, mit biologischen Faktoren erklären wollte, wurde schnell rausgeworfen. Mit Natur sei hier nichts zu erklären, eher zu verdunkeln. Der neue Superstar unter den Denkerinnen, die dem Diskurs seine Struktur verliehen, wurde nach der Französin Simone de Beauvoir die amerikanische Philosophin Judith Butler. Sie stimmte zu: "Wir werden nicht als Frauen geboren." Aber bei ihr geht der Satz anders weiter. Frei interpretiert besagt ihre Gender‑Philosophie: "Wir werden nicht als Frauen geboren. Und wir werden auch nicht dazu gemacht. Es wird uns nur weisgemacht." Denn auch das Konzept der Natur ist ein soziales Konstrukt.
Frau und Mann sozial und kulturell konstruiert
Frau und Mann sind demnach als Phänomene sozial und kulturell konstruiert, weil es diese Pole Judith Butler zufolge gar nicht gibt. Zwar tue die konservative Gesellschaft, die unverdrossen an dieser Polarität festhalte, viel dafür, ihre Kinder an den einen oder anderen Pol zu binden, aber sie könne darin letztlich nicht erfolgreich sein, weil das Geschlecht als solches viel zu stark schillere und schwanke und fluid und volatil zwischen den imaginären Polen herumgeistere, als dass es je fixiert und mit sich selbst identisch und ein für alle mal definiert werden könne. Das Geschlecht unterliege keinem binären Code, sondern es sei ein Spektrum. Es sei eine Art Vexierspiel, dessen Wandlungslust nur den entsprechenden Freiraum brauche um zu zeigen, dass es viel mehr und ganz etwas anderes sei als "männlich" oder "weiblich" – so die Theorie von Judith Butler.
Peng! Damit hatte die Vorstellung von natürlichen Bedingungen ihren letzten Tritt bekommen, der sie nachhaltig aus dem Geschlechterdiskurs hinausbeförderte. Fasziniert schauten Feministinnen und interessierte Männer auf diesen Vorgang: Hieß das etwa, man könne sein Geschlecht frei wählen? Oder doch die darin befindlichen Optionen mal so und mal so nach vorn stellen oder ausblenden? Nein, ganz so einfach sei es nicht, sagten die Butler-Adeptinnen, aber man müsse sich mit dem Gedanken anfreunden, dass es die geschlechtliche Bipolarität, dass es "das Binäre" gar nicht gebe, dass stattdessen eine große Menge gendermäßiger Möglichkeiten in den Individuen schlummere und sich die Auffassung unserer Altvorderen, die Menschheit zerfalle in die beiden Großgruppen Männer und Frauen, nicht aufrecht erhalten ließe. Auch sei der sogenannte heterosexuelle Akt mitnichten der "normale", sondern nur einer von vielen.
60 Geschlechter angeblich denkbar
Das war ganz schön harter Tobak, und viele Zeitungsleser und Bücherkäuferinnen, die sich für diese Zusammenhänge interessierten, stiegen hier denn auch aus. Die neuen Orientierungsmarken, die der Butler-Diskurs für das Verständnis der Geschlechterbeziehung bot, hatten einfach zu wenig mit ihren Alltagserfahrungen zu tun. Für sie waren 60 Geschlechter, die angeblich denkbar und wirklich waren, nicht mehr als eine Phantasmagorie und die Idee einer bedingenden Natur niemals aus ihrem Denken verschwunden. Es war sehr kühn von den avancierten Feministinnen, auf die Anschlussfähigkeit ihrer Theorien mit den Grundannahmen des gesunden Menschenverstandes zu verzichten. Aber es ist die Frage, ob es auch richtig war. Und ob die Natur als Faktor in ihren Hypothesen und Konzepten nicht doch als eine Art Subtext stets mitlief – bloß unausgesprochen.
Es fängt damit an, dass Feministinnen, die die Kategorie der Natur bei ihrem Versuch, die Geschlechterbeziehung zu verstehen, ablehnen, diese Kategorie aber bei der Erforschung einzelner sozialer Felder, die mit Geschlecht zu tun haben, implizit stets doch heranziehen. Erinnert sich noch jemand an den Begriff der Selbstverwirklichung, der in den 1970er-Jahren auch den feministischen Diskurs beeinflusste? Kurz gesagt bedeutete er: Wir sind, als Männer oder Frauen, wenn wir heranwachsen und uns an die Gesellschaft anpassen, womöglich gar nicht wir selbst, wir sollten in uns reinhorchen und wahrnehmen, was da alles unterdrückt, kupiert, entstellt und verleugnet wird. Aber was war denn dieses Selbst, das da freigelegt werden sollte, hatte es womöglich etwas mit – horribile dictu – Natur zu tun? Jedenfalls mit etwas, das wir nicht selbst gemacht hatten, sondern das uns mitgegeben worden war und dem wir sozusagen auf die Welt verhelfen sollten?
Medikamente für Frauen entwickeln
Ein anderes Beispiel: Es gibt in der Medizin eine Forschungsrichtung, über die heute viel gesprochen wird und die kritisch von der Prämisse ausgeht, dass der Modellpatient, für den Medikamente entwickelt und an dem Tests durchgeführt werden, stets männlich sei. Frauen, so erklären das die Mediziner, schleppen mit ihrer Periode und den veränderten Vitalfunktionen innerhalb des Zyklus zu viele Ungewissheiten in das Forschungsfeld ein. Bei Männern lägen die Dinge einfacher, deshalb würden sie um der Vergleichbarkeit willen bei Langzeittests vorgezogen. Man müsste also für Frauen eine spezielle Forschung auflegen. Dass dies nicht geschieht, wird zu Recht von Feministinnen angeprangert. Aber was ist denn in dieser Debatte der Bezugspunkt der Anklägerinnen? Doch wohl die Natur, die Nervenkostüm und Stoffwechsel bei den Geschlechtern unterschiedlich entworfen hat. Oder was sonst?
Der feministische Diskurs weicht an dieser Stelle gern auf den Begriff "Biologie" aus. Der meint etwas Ähnliches wie Natur, wird aber, da er zu den Wissenschaften gehört, als Menschenwerk empfunden und ist somit im feministischen Diskurs erlaubt – wenn auch meist als Abgrenzungsvokabel. In der Frauenbewegung der 1970er-Jahre war der Bezug auf "Biologie" nicht erwünscht, wenn es um den Geschlechterunterschied ging, und die Frauen, die mit biologischen Tatsachen oder gar dem Begriff der "Natur" operierten, wurden als "Biologistinnen" geschmäht. Der Mainstream räumte körperlichen Faktoren keine Geltung ein, und Natürlichkeit kannte man nicht mehr. Alles kam von der Kultur her, von der Erziehung, den Machtkämpfen, den von Menschen selbst konstruierten Geschlechterbildern. Natur? Was soll das sein? Die kanadische Psychologin und Feministin Susan Pinker hat sich getraut, natürliche Faktoren bei ihren Studien zum Geschlechterverhältnis wieder zuzulassen. Sie schreibt:
"Die wissenschaftliche Erforschung des Geschlechterunterschieds ist zweifellos eine Wundertüte voller Überraschungen. Es herrscht die Überzeugung vor, dass Männer das stärkere Geschlecht seien und dass sie durch historische und kulturelle Vorteile weiterhin bessere Startvoraussetzungen hätten. Doch bei genauerer Betrachtung wird deutlich, dass Männer anfälliger für alle möglichen biologischen und psychologischen Pannen sind und an einer Vielzahl von Lern- und Verhaltensproblemen leiden. Andererseits führt eine stärkere Neigung zu Wettbewerb und Wagemut einige Männer zu höchsten Leistungen und spektakulären Erfolgen – und andere zu traurigen Rekordzahlen bei Unfällen und Selbstmorden. Angesichts dieser Alltagsbeobachtungen stellt sich die Frage, warum die Vorstellung von geschlechtsspezifischen Unterschieden weiterhin so umstritten ist. Ein Grund ist, dass wir die Biologie 40 Jahre lang unberücksichtigt gelassen haben und dadurch in die seltsame und unangenehme Situation geraten sind, dass Frauen Angst haben, sich ihre eigenen Wünsche einzugestehen."
Für eine Work-Life-Balance mit mehr Life
Worauf sich Susan Pinker hier bezieht, sind nicht nur Alltagsbeobachtungen, sondern auch Forschungsergebnisse zu der Tatsache, dass beruflich höchst erfolgreiche Frauen bei Weggabelungen ihrer Karrieren eher eine Lösung suchen, die ihnen Zeit für ihre Kinder lässt als ganz an die Spitze vorzustoßen – signifikant öfter als Männer. Bis heute gilt es als ausgemacht, dass es die Macho-Atmosphäre in den Chefetagen sei, die Frauen abschrecke. Pinker setzt dagegen, dass die Frauen selbst eine work-life-balance mit mehr life anstrebten und eher Angst davor hätten, sich das einzugestehen. Sie spricht nicht von Natur, aber ihr Begriff der "Biologie" darf hier als Synonym gelten. Respektvoll erklärt sie, wie zutiefst unterschiedlich die Architektur der Körper von Männern und Frauen ausfalle und erst recht ihre Physiologie, die natürliche Ausstattung mit Hormonen, die unser aller Verhalten steuert und das "Selbst" formt, das wir "verwirklichen" wollen, was uns oft misslingt. Können wir nicht diesen Gedanken zulassen: dass Männer und Frauen von Natur aus unterschiedlich sind? Und kann dieser Gedanke nicht auch zu etwas Anderem führen als zu Reflexionen über Macht oder Oben und Unten? Dazu, dass wir die Gleichheit im Unterschied anerkennen? Will sagen: Kann man nicht Unterschiede benennen, ohne dabei reflexhaft zu werten? Jedenfalls: Der Stand der Forschung rechtfertigt nirgendwo ein Patriarchat.
Junge Eltern berichten von seltsamen Erlebnissen. Ja, die Spielzeugindustrie nervt entsetzlich mit ihren Leitfarben Rosa und Hellblau, die wollen wir alle nicht mehr sehen und desavouieren sie, wo immer möglich. Aber da ist noch was anderes. Die Mutter eines Zwillingspaares, Junge und Mädchen, erzählt, wie die beiden Zweijährigen mit der Flurkommode spielen, in deren Schubladen ausgemusterte blaue Taftgardinen lagern. Das Mädchen bittet die Mutter, die Schublade zu öffnen und zieht die Gardinen heraus. Sie streicht mit den Händen über den Stoff, wickelt die Bahnen um ihre Figur und kleidet auch die Mama und die Puppe in Blau ein. Der Bub interessiert sich nicht für das, was in der Schublade liegt, er interessiert sich für den Mechanismus der Lade und er versucht mit aller Kraft, die Schublade zu öffnen und zu schließen. Nun könnte man sagen: Na und? – erzählen nicht Eltern solche Geschichten täglich mindestens 1.000 Mal. Und als hätten nicht Forscher aus allen Weltteilen immer wieder dargestellt, wie eifrig sich kleine Jungs drum bemühen, ihre Spielfelder kämpferisch zu gestalten, während kleine Mädchen sich spielend in sozialen Zusammenhängen bewegen wollen und nicht richtig zufrieden sind, wenn ihr Kuscheltier Hunger hat. Sicher beginnt die Prägung von außen sehr früh. Aber gewisse Daten, den individuellen Charakter betreffend, sind von Anfang an da. Hierzu gehört auch das Geschlecht. Wir werden eben doch nicht bei unserer Geburt in das Buch dieser Welt als leeres Blatt Papier eingeheftet, sondern da steht schon was drauf. Man nenne es Körper, Geschlecht, Genpool, DNA, Erbinformation, Charakter oder Individuum – eine Inschrift ist vorhanden, und zwar nicht nur ein paar Notizen, sondern eine ziemlich umfangreiche Narration. Sollen wir die wirklich ignorieren?
Natur scheint fallweise sogar anarchisch zu sein
Die Angst davor, Natur zum Thema zu machen, rührt in letzter Instanz von der Vorstellung her, dass alles, was von der Natur komme, schon seit eh und je unveränderlich so sei. Diese falsche Grundannahme hat bereits dem alten Patriarchat dabei geholfen, Frauen als nicht-satisfaktionsfähig beiseite zu schieben. Jetzt fürchten Feministinnen, die Idee der Natur, ließe man sie in der Debatte zu, könne weiterhin derart schädliche Effekte erzeugen und das weibliche Freiheitsverlangen gleich wieder in den Orkus der Determination, der Festlegung auf die zweite Geige für alle Zeit, hinunterstürzen. Aber es kann auch ganz anders kommen. Ließe man die Natur erst wieder in die Debatte ein, könnte man sie und ihre Potenzen neu interpretieren als Beitrag zur "Selbstverwirklichung". Zumal das, was da von Anfang an auf dem Papier steht, vom Menschenwerk Kultur ergänzt, erweitert, überbaut und auch überschrieben wird.
Die Natur ist in andauernder Bewegung. Wir kennen die Begriffe Evolution und Anpassung, und wir wissen, was sie bedeuten. Seit Darwin wissen wir das sogar ziemlich gut. Sie bedeuten Wandel, Veränderung, Erneuerung, selbst unsere Gene modifizieren sich und haben ein Gedächtnis, das die Aufforderung zum Wandel enthält. Die Natur scheint zu spielen und bricht ständig ihre eigenen Regeln. Sogar die Geschlechtschromosomen eines Menschen können von der normalen Verteilung abweichen und statt XX und XY zum Beispiel XXY aufweisen, das macht der Natur gar nichts aus. Ferner dürfte die Häufigkeit der Homosexualität unter höheren Tieren jenen Konservativen den Wind aus den Segeln nehmen, die zwischen natürlichen und unnatürlichen Sexualakten unterscheiden und den Schwulen und Lesben das Leben schwer machen. Die Natur also scheint ziemlich liberal und libertär und fallweise sogar geradezu anarchisch zu sein. Es ist mithin unwahrscheinlich, dass Gefahr droht, wenn sie in den feministischen Diskurs eingelassen wird. Man kann sozusagen mit ihr reden. Ihre determinierende Kraft jedenfalls hat nicht den Anspruch, absolut zu sein.
Trotzdem hat die Natur ihre eigene Agenda. Dass wir alle einmal sterben müssen, davon rückt sie einfach nicht ab, keine Dekonstruktion treibt ihr diese Determination aus. Und dass wir alle als Geschlechtswesen geboren werden, ist auch eins der Gebote, die sie nicht zurücknimmt. Es ist richtig, dass es intersexuelle Menschen gibt mit uneindeutigem Geschlecht und solche, in denen sich eventuell nach ihrer Geburt ein Trans-Gedanke regt: Sie wollen rüber vom weiblichen zum männlichen oder vom männlichen zum weiblichen Geschlecht. Es war falsch von der Kultur und besonders von der Religion, einen solchen Schritt als Sünde zu verurteilen, denn auch er rührt von der Natur her und ist in den meisten Fällen eine Sehnsucht und keine Marotte. Es ist also richtig, dass es nicht nur zwei Geschlechter gibt, aber die Zwischenformen gibt es nur, weil es die Zweigeschlechtlichkeit gibt.
Wenn es Zwischenformen oder Wechselwünsche gibt, so beziehen die sich ja gerade auf die beiden dominanten Formen, die sie mit ihrem "Zwischen" voraussetzen, anstatt sie in Frage zu stellen. Sie beziehen sich auf den binären Code und bestätigen ihn damit. Das Wort "dominante Form" hat eine quantitative Implikation, umfasst sie doch 95 bis 99 Prozent aller Menschen, mithin eine Mehrheit, die zu groß ist, um nicht in Qualität umzuschlagen. Das bedeutet, dass die laut modernstem Feminismus abzuschaffende "Heteronormativität" eben doch die Norm bleiben wird – die Norm allerdings im Sinne von gelebter Praxis, nicht im Sinne einer Vorbildfunktion. Wir brauchen keine neue Logik, die uns lehrt, mit einer Vielfalt von Geschlechtern umzugehen, sondern können unsere alte, auf Zweigeschlechtlichkeit aufbauende Logik beibehalten. Und trotzdem oder gerade deshalb den Zwischenformen ihre Rechte zuerkennen. Wir können die lange schon begonnene Debatte, was "weiblich" und "männlich" eigentlich heißt, was daran womöglich unhintergehbar und was geöffnet, verwandelt oder völlig neu designt werden muss, weiter führen. Dafür müssen wir die Annahme der Zweigeschlechtlichkeit nicht aufgeben. Denn sie gibt uns auch nicht auf. Das gilt gleichermaßen für den Begriff der Natur.
Die Natur ist immer schon da, wenn wir ankommen
Wirklich? Ist nicht die Natur eher unsere Gegenspielerin als unsere Verbündete auf dem Weg in die Freiheit? Haben wir uns nicht so weitgehend von ihr emanzipiert, dass wir auch praktisch ohne sie auskommen? Frankensteins Experiment ging zwar schief, aber die Roboter unserer Zeit sind ein tolles Erfolgsprogramm, ebenso Forschung und Praxis im Feld der KI, der künstlichen Intelligenz. All diese Befreiungsbewegungen werden weiter gehen, und es sieht so aus, als würden sie die Natur praktisch und theoretisch in eine Nebenrolle drängen. Oder nicht?
Die Natur in einer Nebenrolle... Ist das nicht eine Projektion von uns Menschen, die wir gerne selbst Schöpfergott wären? Sollten wir diesen Ehrgeiz nicht ablegen? Unsere Erfahrung ist doch, dass die Natur immer schon da ist, wenn wir ankommen. Dass sie womöglich stärker ist als wir. Wir sollten diesen Gedanken zulassen und nachfragen, was die Natur alles mit uns macht. Dafür müssen wir sie erstmal als Faktor auf den Märkten unserer Ideen, Überzeugungen, Glaubenssätze, Logiken, Diskurse und Theorien auch auf dem Feld der Geschlechterdifferenz wieder zulassen. Wofür wir auch erklären müssen, was Natur heißen soll, wo sie im Geschlechterverhältnis wirkt. Solange wir diese letzte und größte Abhängigkeit in unserem Leben – ob nun als Männer oder Frauen – nicht anerkennen und nicht verstehen, werden unsere Diskurse und Auseinandersetzungen in einem Kampf gegen Windmühlenflügel enden. Und die politische Rechte wird sich die Kategorie kapern und werweißwas mit ihr anstellen. Den deutschen Wald hat sie ja schon für sich vereinnahmt, das deutsche Volk rhetorisch auch, – wann kommt die deutsche Frau?
Neustart des Diskurses über die Geschlechter
Die nervöse Ablehnung der Naturkategorie, die wir im feministischen Denken finden, hat vielleicht noch diesen zusätzlichen, auch sonst in der Philosophie verbreiteten Grund: Man möchte als denkender Mensch unabhängig sein, autonom, ganz und gar auf sich gestellt und nur sich selbst verpflichtet. Es ist eine Kränkung für den schöpferischen Menschen, um sich herum und in sich drin Kräfte vorzufinden, die er nicht selbst geschaffen und verstanden hat, und dass ihm im Grunde wenig anderes bleibt, als diese ihn umgebenden und in ihm wirkenden Kräfte anzuschauen, zu analysieren, zu verstehen und nachzubauen. Das aber ist alles nicht besonders originell. Das ist nicht genial. Es ist nicht gottgleich. Es ist epigonal. Solange die Menschheit sich darauf einigen konnte, dass es ein Schöpfergott war, der die Natur und den Menschen als Teil von ihr geschaffen hatte, kamen wir irgendwie mit der Natur, die uns bestimmt hat, klar. Der Glauben und die Ehrfurcht glichen das Gefühl der Unerheblichkeit eigener schöpferischer Bemühungen aus, die Menschen konnten mit der Gesamtsituation Frieden schließen. Aber seit der Glauben sich zersetzt hat und alle Menschen als Kreative hervortreten und die Frauen gleichberechtigt sein wollen, ist es schwierig geworden.
Die Frauen mussten ihr Freiheitsverlangen ja nicht nur gegen die Männer durchsetzen, sondern auch gegen die ganze bisherige Denktradition. Da lag es ihnen nahe, einen scharfen Schnitt zu tun: Der Natur keinen Fußbreit Boden mehr in ihren Diskursen zu gönnen. Auf dieser Spur zu denken haben die Feministinnen versucht, und so ist es ihnen für eine Weile geglückt, jedoch während der beiden letzten Dekaden nur für sich selbst, nur für die überschaubaren Zirkel der Teilnehmerinnen an Kursen der Gender-Studies, sozusagen "unter uns Pastorentöchtern". Sie haben sich damit von der Lebenssituation ihrer nicht-intellektuellen Zeitgenossinnen immer weiter entfernt, damit auch von der Politik und den sozialen Problemen in den Niederungen der schnöden Wirklichkeit. Übrig geblieben ist ein akademischer Streit um Worte und ihre möglichen Neuschöpfungen. Derweil wurden die Ziele der Gleichberechtigung in vielen wichtigen Punkten nicht erreicht. Also sollte man neu nachdenken, um endlich praktisch voranzukommen. Und für einen solchen erwünschten Neustart des Diskurses über die Geschlechter ist die Wiederentdeckung einer Instanz mit Namen "Natur" unabdingbar. Die kann nichts für die Fehler der Kultur, die eine Herrschaftsbeziehung in das Verhältnis der Geschlechter hineingetragen hat. Umso angstfreier können wir uns ihr nähern und sie befragen, welche Grenzen sie uns setzt und welche Horizonte sie uns öffnet.