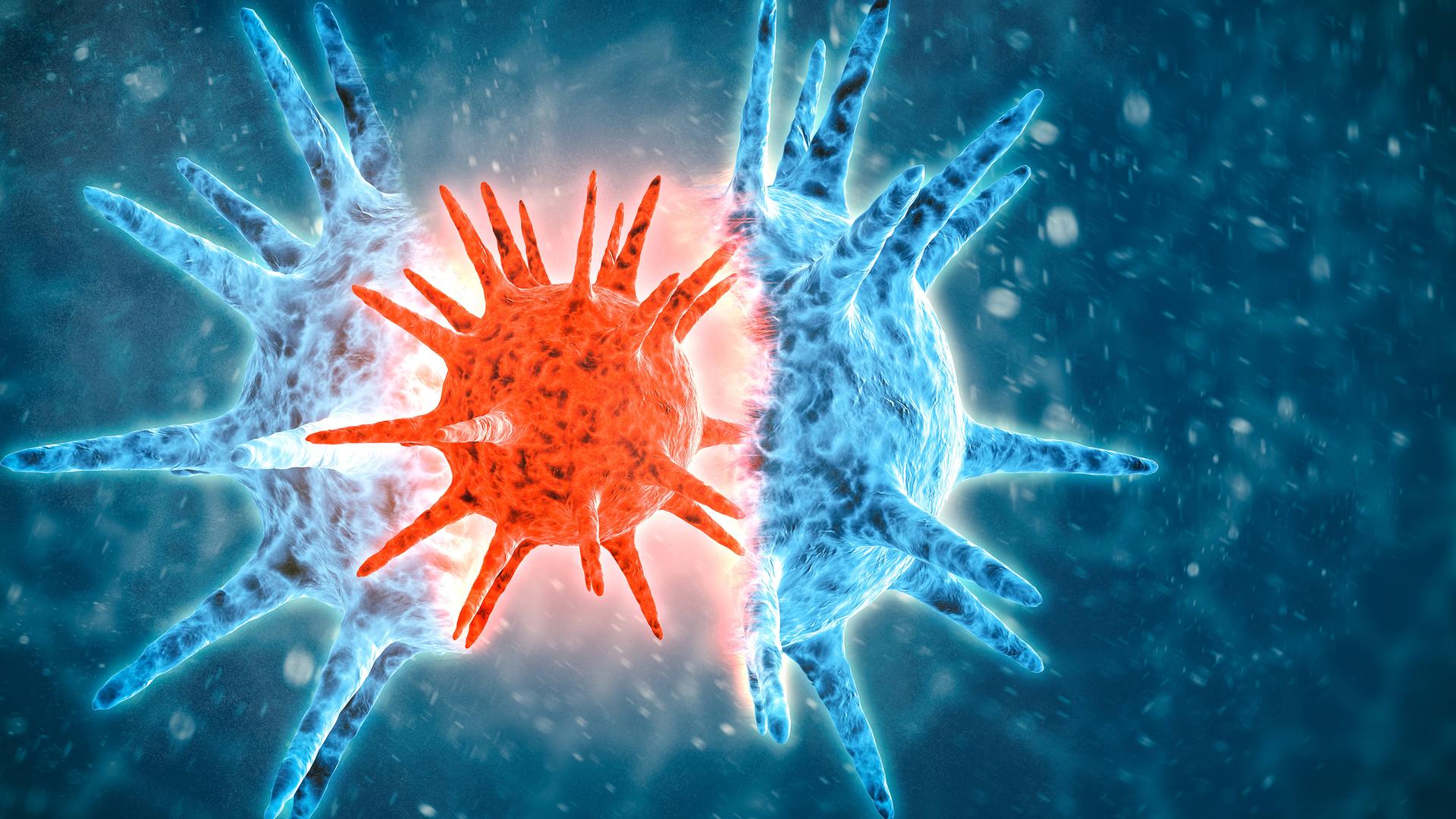"Das Gesetz erscheint den meisten Bürgern dieses Staates als eine Art Verkehrsregelung bei Naturkatastrophen, während es in Wahrheit fast alle Vollmachten für eine fast totale Mobilmachung enthält. Hinzu kommt die nicht nur peinliche, sondern die wirklich verdächtige Hast, mit der das Gesetz verabschiedet werden soll."
Der Bonner Hofgarten am 11. Mai 1968. Nach einem Sternmarsch in die damalige Bundeshauptstadt kritisiert der Schriftsteller Heinrich Böll auf der abschließenden Kundgebung der Außerparlamentarischen Opposition die geplanten Notstandsgesetze der Bundesregierung, die wegen der Einschränkung von Grundrechten massiv infrage gestellt worden waren. Dem Protestaufruf des Kuratoriums Notstand der Demokratie, einem Zusammenschluss von Vertretern aus Wirtschaft, Kultur, Gewerkschaften und Kirchen, waren geschätzt 15.000 bis 40.000 Demonstranten gefolgt.

"Lasst das Grundgesetz in Ruh`, SPD und CDU."
Der wütende Protest gegen die regierende Große Koalition kurz vor Verabschiedung der Notstandsgesetze am 30. Mai 1968 war nicht unbegründet, zumindest aus Sicht der Teilnehmer. Denn das Stichwort gesetzlicher Notstand galt im Nachkriegsdeutschland als historisch vorbelastet. Der Notverordnungsartikel 48 der Weimarer Reichsverfassung hatte den Reichspräsidenten Friedrich Ebert und Paul von Hindenburg die Möglichkeit eröffnet, die Grundrechte ganz oder teilweise außer Kraft zu setzen, was sich am Ende mit der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler als verhängnisvoll herausstellen sollte. Und nach dem inszenierten Reichstagsbrand führten die Nationalsozialisten im März 1933 mit der "Notverordnung zum Schutze von Volk und Staat" den permanenten Ausnahmezustand ein.
Schon im Parlamentarischen Rat, der 1948 über das neue Grundgesetz verhandelte, war die Ausbuchstabierung des Notstandsfalls umstritten. Mit welchen Handlungsmöglichkeiten sollte der Staat ausgestattet sein, um einen äußeren und inneren Notstand – zum Beispiel Kriege, Naturkatastrophen und Unruhen – zu bewältigen? Wie viele Mitspracherechte sollten Bundestag und Bundesländer bekommen?
Sonderrechte der Alliierten
Über solchen Fragen schwebten zudem die Sonderrechte, die sich die Alliierten im ersten und zweiten Deutschlandvertrag von 1952 und 1955 vorbehalten hatten. Mit den Verträgen wurde die Bundesrepublik zu einem weitgehend souveränen Staat. Die USA, Frankreich und Großbritannien konnten aber im Katastrophenfall zum Schutze ihrer Streitkräfte weiterhin Einfluss nehmen.
Um die eigene Sicherheit nicht länger den Alliierten zu überantworten, gab es ab 1958 mehrere Entwürfe für Notstandsgesetze, die der damalige Bundesinnenminister Gerhard Schröder (CDU) auf den Weg brachte.
"Ein dauernder Anlass für ein besonderes deutsches Notstandsrecht liegt in der Notwendigkeit, die Vorbehaltsrechte der früheren Besatzungsmächte nach Artikel 5, Absatz 2 des Deutschlandvertrags abzulösen und so die Souveränität der Bundesrepublik auch für den Fall des Notstands herzustellen."
Schröders berühmt-berüchtigter Ausspruch: "Die Stunde des Notstands ist die Stunde der Exekutive", das heißt der Regierung und nicht auch des Parlaments, ließ sämtliche Skeptiker einer Notstandsregelung aufseiten der Opposition aufhorchen, so dass eine grundgesetzändernde Zweidrittelmehrheit, die dafür notwendig war, im Bundestag lange Zeit nicht in Sicht war.
Bis Ende 1966 die erste Große Koalition auch unter der Bedingung geschlossen worden war, nach vielen Jahren der Diskussion eine Notstandsverfassung auf den Weg zu bringen. Zumal zuvor bekannt geworden war, dass bis dato geheim gehaltene sogenannte Schubladengesetze existierten, nach denen es möglich sein sollte, demokratische Spielregeln durch Ermächtigung der Alliierten außer Kraft zu setzen.
Außerparlamentarische Opposition protestierte
So stieß das gesetzgeberische Ansinnen der Großen Koalition unter Kanzler Kurt Georg Kiesinger, endlich Klarheit zu schaffen, bereits im Ansatz auf heftigen Widerstand in der gerade entstandenen studentischen Protestbewegung. Nach außen gegen den Vietnamkrieg, nach innen gegen die Notstandsgesetze. Die Außerparlamentarische Opposition (APO) formierte sich, der Konflikt eskalierte.
"Ich stehe hier direkt neben der Tribüne auf dem Hofgartenplatz, dem großen Demonstrationsfeld. Der Platz ist bis auf den letzten Quadratzentimeter mit Demonstranten angefüllt. Klarheit tut Not - heißt es auf den Transparenten. Oder: Schutz der Demokratie vor Notstandsgesetzen. Oder aber: Notstandsgesetze – der Tod der Demokratie."

Schon vor der Demonstration im Bonner Hofgarten war die Stimmung in der Bundesrepublik aufgeheizt. Nach dem gewaltsamen Tod des Studenten Benno Ohnesorg im Juni 1967 durch einen Westberliner Polizisten und dem Attentat eines rechtsextremen Einzeltäters auf Studentenführer Rudi Dutschke an Gründonnerstag 1968 entluden sich die Proteste an den Universitäten in den sogenannten Osterunruhen. Der Liberale Gerhart Baum erinnert sich an diese aufregende Zeit:
"Damals war es eine ganz aufgewühlte Stimmung. Die Bewegung der Jugend, die Protestbewegung, die 68er-Bewegung war voll im Gange. Kurz vorher gab es ein Attentat auf Rudi Dutschke. Also die Jugend war in Bewegung, auch gegen die ältere Generation. Und es ist ganz verständlich, auch aus der damaligen Sicht, dass da eine hohe Sensibilität bestand gegenüber Freiheitseinschränkungen."
Wie sie in den Notstandsgesetzen vorgesehen waren. Udo Knapp, damals 23, war als Berliner Aktivist des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes (SDS) beim Sternmarsch nach Bonn mit dabei.
"Es war insgesamt eine Stimmung, als ob man tatsächlich vor dem Untergang der Demokratie in Deutschland stünde. Das Bild, das wir da von der Bundesrepublik gezeichnet haben, das stimmte eigentlich mit der Wirklichkeit gar nicht überein."
Denn die Demonstrantinnen und Demonstranten skandierten: "Sie üben wieder fleißig für ein neues '33". Am Ende entwickelte der Sternmarsch trotz der bis dato höchsten Teilnehmerzahl einer Demonstration in der Bundesrepublik nicht die erhoffte Durchschlagskraft. Denn Ziel des von seinen Schussverletzungen noch nicht genesenen Rudi Dutschke war es, in einem Anti-Notstandspakt mit den Gewerkschaften einen Generalstreik nach französischem Vorbild herbeizuführen.
Dieser kam nicht zustande. Stattdessen trugen die Gewerkschaften am selben Tag auf einer geschlossenen Veranstaltung in der Dortmunder Westfalenhalle ihren eigenen Protest gegen die Notstandsgesetze vor.
Mit dem Kampf gegen die sogenannten NS-Gesetze, wie sie in einem polemischen Buchstabenkürzel genannt wurden, lief der Protest der Außerparlamentarischen Opposition langsam aus, die Bewegung zersplitterte.
Notstandsgesetze für den Katastrophen-Notstand
Die Notstandsgesetze sollten den äußeren und inneren Notstand sowie den Katastrophen-Notstand regeln und dabei formell die alliierten Vorbehaltsrechte ablösen. Um welche Grundgesetzänderungen wurde im Detail gestritten? Für den Verteidigungs- oder den Spannungsfall, als Vorstufe des Verteidigungsfalles, ging es um die Bildung eines Notparlaments, das heißt, eines sogenannten Gemeinsamen Ausschusses aus Mitgliedern des Bundestags und Bundesrats. Dieser musste den Befürwortern einer schärferen Notstandsregelung abgerungen werden. Dazu Gustav Heinemann (SPD) damals Bundesjustizminister in der Großen Koalition.
"Die vor acht Jahren von der damaligen Bundesregierung präsentierten Vorschläge für eine Notstandsregelung waren ja in der Tat schockierend. Ein Kernpunkt der jetzigen Vorlage ist es, die Mitwirkung des Parlamentes, zumindest in der Form des Gemeinsamen Ausschusses, als Notparlament zu erhalten und die Grundrechte dem Zugriff der Exekutive zu entziehen."
Neben der Einrichtung eines Notparlamentes wurde zudem um die Einschränkung des Post- und Fernmeldegeheimnisses eine heftige Kontroverse geführt. Stark umstritten war auch die Einschränkung der Freizügigkeit und von Arbeitskampfmaßnahmen wie zum Beispiel Streiks. Dazu Hartmut Bäumer, früherer APO-Aktivist, Richter und grüner Regierungspräsident in Hessen:
"Das ist vollkommen klar, das war ein unglaublich starker Eingriff in wesentliche Grundrechte. Auch in der Berufsfreiheit gab es Einschränkungen, weil man eben Leute zwangsverpflichten konnte zu bestimmten Tätigkeiten. Der Einsatz im Inneren, das war auch etwas, was die Studenten- und die Schülergeneration damals ganz besonders bewegt hat, so dass man sagte: Wieso braucht dieser Staat, der sich ja eigentlich demokratisch ganz positiv entwickelt hat, das?"
Die Debatte spitzte sich zu, als es um einen möglichen Einsatz der Bundeswehr im Innern ging, zur – Zitat – "Abwehr einer drohenden Gefahr für den Bestand oder die freiheitlich-demokratische Grundordnung des Bundes oder des Landes". Dies war der zentrale Punkt, weshalb die oppositionelle FDP fast geschlossen gegen die Gesetze votierte. Ihre Wortführer im Deutschen Bundestag waren Hans-Dietrich Genscher, Liselotte Funcke und Wolfram Dorn.
"Ich meine also, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Frage des Einsatzes der Bundeswehr im Innern ist von so entscheidender Bedeutung, dass wir nicht in der Lage sind, hier unsere Zustimmung geben zu können. Aber es geht eben darum, dass die Frage des Einsatzes der Bundeswehr in Katastrophenfällen zur Hilfe ohne Waffe etwas völlig anderes ist als der Einsatz der Bundeswehr mit der Waffe gegen Menschen unseres eigenen Volkes, um die es sich dann ja handeln muss."
Dagegen ergriff SPD-Fraktionschef Helmut Schmidt das Wort. Der spätere Verteidigungsminister und Bundeskanzler gehörte neben Innenminister Ernst Benda und Unionsfraktionschef Rainer Barzel zu den parlamentarischen Befürwortern der Notstandsgesetze.
"Hier wird ja eben nicht schlechthin eine Blankovollmacht gegeben, sondern es werden eine Reihe von Voraussetzungen in das Grundgesetz hineingeschrieben. Die erste, die ganze Sache kommt nur in Betracht, wenn ein Land nicht mehr in der Lage ist, mit eigenen Kräften die Situation zu meistern. Die zweite Voraussetzung, die außerdem erfüllt sein muss, dass die Polizeikräfte insgesamt nicht ausreichen. Die dritte Voraussetzung, dass auch die Kräfte des Bundesgrenzschutzes nicht ausreichen. Und die vierte Voraussetzung, dass das alles trotzdem nicht entscheidet, es sei denn es handelte sich um einen organisierten Aufstand, der außerdem mit militärischen Waffen geführt wird. Dann allerdings – in diesem äußersten Fall – allerdings, muss man auch auf die Soldaten zurückgreifen dürfen."
Verabschiedung am 30. Mai 1968 mit einer Zweidrittelmehrheit
Die Notstandsgesetze wurden am 30. Mai 1968 mit 384 Stimmen angenommen, 100 stimmberechtigte Abgeordnete votierten dagegen. Die für Grundgesetzänderungen erforderliche Zweidrittelmehrheit war damit erreicht.
Den Kritikern der Notstandsgesetze wurden zwei sogenannte Besänftigungsänderungen zugestanden. Zum einen sollte sich der innere Notstand nicht gegen Arbeitskämpfe richten, die – Zitat – "zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen von Vereinigungen geführt werden". Außerdem wurde in Artikel 20, Absatz 4 des Grundgesetzes ein individuelles Widerstandsrecht eingeräumt, gegen jeden, der es unternehmen sollte, die freiheitlich-demokratische Ordnung zu beseitigen, wenn – Zitat – "andere Abhilfe nicht möglich ist". Dies relativiert Gerhart Baum:
"Das war eine Konzession, auf die kann sich aber so leicht niemand berufen. So eine Situation wird es, wie wir wohl voraussehen können, eigentlich gar nicht geben. Ein bisschen weiße Salbe, nicht schlecht, aber in so eine Situation kommen wir vermutlich nie."
Die Notstandsgesetze sind seit ihrer Verabschiedung vor 52 Jahren niemals angewendet worden. Es gab keine Situation, die dies erfordert hätte. Aber als Bund und Länder im März dieses Jahres, bedingt durch die Coronapandemie, das öffentliche Leben weitgehend herunterfuhren, bekam die Diskussion um Notstandregelungen neuen Auftrieb.
"Wir bewegen uns in eine neue Normalität. Eine Normalität, die längere Zeit anhalten wird."
Das sagte Vizekanzler und Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) im April. Die Große Koalition unter Kanzler Kiesinger hatte 1968 Kriegsgefahren, innere Unruhen und Naturkatastrophen im Hinterkopf. An Pandemien hat indes niemand gedacht, so dass sich zu Beginn der Coronakrise die Frage stellte, ob Artikel 35 des Grundgesetzes, der die Rechts-, Amts- und Katastrophenhilfe regelt, geändert werden müsste und Epidemien zu den vorgesehenen Katastrophenfällen des inneren Notstands hinzugenommen werden müssten.

Hartmut Bäumer, der frühere APO-Aktivist und heutige Vorsitzende von Transparency International Deutschland, sieht zur Erweiterung des Notstandsfalles keine Notwendigkeit. Im Gegenteil. Ihm bereitet schon das neue, im März vom Bundestag verabschiedete Infektionsschutzgesetz Sorgen, das in 16 Abschnitten 77 Paragrafen umfasst, betreffend die Koordinierung, Überwachung, Verhütung, Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten und den Infektionsschutz bei bestimmten Einrichtungen. Darin werde fast noch weiter gegangen als in den Notstandsgesetzen. Der Grund:
"Der Gesundheitsminister und der Innenminister können in gewisser Weise per Verordnung durchregieren. Und das ist fast gefährlicher als die Notstandsgesetze."
Dieser Interpretation widerspricht der frühere Bundesinnenminister Gerhart Baum. Das neue Infektionsschutzgesetz vom März dieses Jahres sei zwar reparaturbedürftig, weil die Eingriffe nicht genügend erklärt würden, aber "an den Ermächtigungen selbst geht kein Weg vorbei, wie kommen wir sonst aus der Coronakrise heraus? Also wir müssen dieses Spannungsverhältnis zwischen den Grundrechten aushalten. Es wird ja auch vom Verfassungsgericht vorsichtig korrigiert, beispielsweise im Versammlungsrecht ist das geschehen. Aber jetzt den Eindruck zu erwecken, wir würden uns außerhalb der Sphäre des Grundgesetzes bewegen, das ist falsch."
Handlungsfähige Parlamente auch in der Coronakrise
Dennoch besteht auch der erfahrene Liberale darauf, dass die Coronakrise nicht nur die Stunde der Exekutive sei, sondern auch die handlungsfähiger Parlamente, die in möglichst kurzen Abständen über die Notwendigkeit und das Verfallsdatum von Beschränkungen entscheiden müssten.
Das Thema Verfallsdatum steht immer wieder im Zentrum der Kritik, etwa bei René Schlott. Der Historiker am Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam hat in mehreren Veröffentlichungen sein Misstrauen gegenüber den jüngsten Einschränkungen im öffentlichen Leben zum Ausdruck gebracht:
"Die Sorge, die ich von Anfang hatte, ist, dass die Grundrechte zwar ziemlich schnell eingeschränkt werden, aber dass es sehr lange dauert, bis die wieder voll in Kraft treten. Ich weiß nicht genau, ob wir wirklich zum Status quo ante Corona wieder zurückkehren werden eines Tages."
Manche befürchten sogar, die Bundesrepublik könne auf ein neues, gar autoritäres politisches System zusteuern. Das kommt Udo Knapp, dem ehemaligen Aktivisten des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes, bekannt vor.
"Das ist genau wieder dieselbe Denke, mit der wir da '68 demonstrieren gegangen sind. Keine der Maßnahmen, die die in den letzten drei Monaten beschlossen haben, hat wirkliche Freiheiten eingeschränkt. Sie hat unseren Alltag reglementiert, auf unangenehme Weise, aber geht denn die Welt unter, wenn meine Lieblingskneipe zumacht?"
Alarmistische Befunde eines sogenannten Hygiene-Staates, einer Corona-Diktatur oder eines Notstands-Regimes, in dem die Bundesregierung durchgreift, hält auch der Publizist und Jurist Albrecht von Lucke für ziemlich abwegig.
"Die Coronakrise hat wie unter einem Brennglas gezeigt, wie unsere Gewaltenteilung gerade funktioniert. Das, was als Stunde der Exekutive bezeichnet wurde, war von Anfang eine Stunde auch der Parlamente. Der Bundestag hat eben nicht zugestimmt, dass Bundesgesundheitsminister Spahn, wie er es gewünscht hätte, selbst über den Notstand epidemiologischer Art entscheidet. Er hat auch nicht zugestimmt, als Wolfgang Schäuble, der Bundestagspräsident, sich gewünscht hätte, dass wir im Falle von einer Epidemie so etwas haben wie ein Notstandsparlament wie im Kriegsfall."
Nicht in einem überbordenden Notstandsstaat sieht der Redakteur der Fachzeitschrift "Blätter für deutsche und internationale Politik" eine künftige Gefahr, sondern – ganz im Gegenteil – in einem wachsenden Autoritätsverlust des Staates, nachdem mit der Lockerung des Shutdowns wieder alle Einzelinteressen fordernd auf den Plan getreten sind.
"Es geht also eher darum, zu fragen, ist der Staat tatsächlich stark genug? Ist er mit der Autorität ausgestattet, die es ihm erlaubt, in den nächsten Monaten und Jahren über diese Krise zu kommen? Und der Bevölkerung zu erklären, dass weitreichende Maßnahmen erforderlich sind, um diese Krise zu bewältigen und in der Zukunft vielleicht noch viel größere, wie die Klimakrise, die der Bevölkerung vieles wird abverlangen müssen."