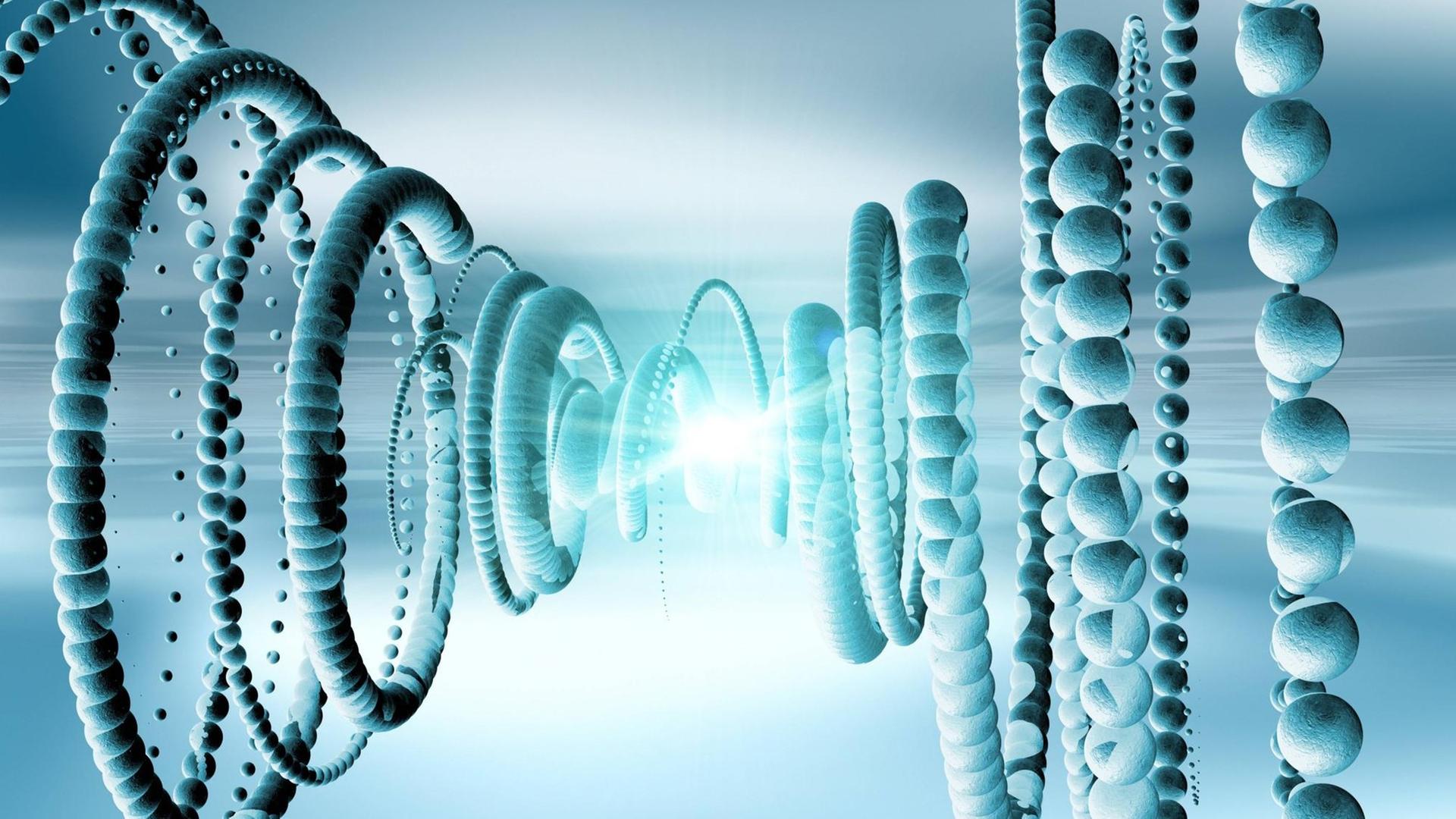Physikerneid, dieses Wort war in Berlin immer wieder zu hören.
Hanna Kokko (Institut für Evolutionsbiologie und Umweltwissenschaften, Universität Zürich): "Die Physiker, die haben ja diese wunderschönen Theorien, wo alles wirklich passt. Da macht man Experimente und da findet man, dass man mit dem dritten Dezimalpunkt. Und in der Biologie ist es ja nie so, dann ist es einfach so ein bisschen schlampiger."
Bedauert Hanna Kokko mit einem Augenzwinkern. Leben nach Zahlen funktioniert eben nur begrenzt. Die Biologie kennt keine ehernen Gesetze, dafür Regeln mit oft faszinierenden Ausnahmen.
"Also wir müssen einfach zugeben, dass wir zum Beispiel vielleicht eine Idee haben, warum es oft Männchen und Weibchen gibt, aber weil es auch Arten gibt, wie Algen wo es eigentlich Sex ohne Männchen oder Weibchen gibt, dann müssen wir auch verstehen, warum es so oft diese zwei ganz verschiedenen Typen gibt."
Evolution im Schnelldurchlauf
Und dafür nutzt Hanna Kokko an der Universität Zürich auch mathematische Modelle. Die zeigen die Evolution sozusagen im Schnelldurchlauf. Sexuelle Fortpflanzung entsteht dabei zunächst zwischen geschlechtslosen Partnern. Aber wenn sich Sex erst einmal etabliert hat, dann wird er schnell unterwandert, von Organismen, die weniger in den Nachwuchs investieren. Und das sind per Definition Männchen mit ihren kleinen Spermien. Kein sehr schmeichelhaftes Bild. Wobei Männchen durchaus wichtige Funktionen übernehmen können. Bei den festsitzenden Korallen würden ohne die vielen kleinen Spermien, die den Ozean durchstreifen, wohl kaum je männliches und weibliches Erbgut zusammenfinden. Eine interessante Ausnahme beim Thema Sex findet sich bei so unterschiedlichen Arten wie Muscheln, Gespensterschrecken und Zypressen.
"Die Spermien, die können eine Eizelle finden, und dann das weiblichen Genom einfach herausschmeißen und dann entwickeln sich die Embryos als Klon des Vaters."
Aber ein Modell von Hanna Kokko erklärt auch, warum das auf lange Sicht eine evolutionäre Sackgasse ist: woher sollen bei all den geklonten Vätern auf Dauer die Eizellen kommen?
"Deswegen findet man solche Strategien meistens bei Zwittern, also bei Organismen, wo obwohl man ein Sohn des Vaters ist, ist man auch gleichzeitig ein Weibchen, also das ist etwas ziemlich Komisches."
Die Mathematik ist unverzichtbar, wenn Biologen die großen Datenmassen etwa in der Genom- oder Hirnforschung analysieren wollen. Sie hilft aber auch, Ordnung in die Laute der Tiere zu bringen. Da ist das Spezialgebiet von Tecumseh Fitch von der Universität Wien. Eine von vielen Fragen dabei lautet: warum können Menschen sprechen, Schimpansen aber nicht? Lange wurde vermutet, dass der kurze Vokaltrakt der Menschenaffen einfach keine flexible Lautbildung zulässt. Eine genaue Analyse auch mit mathematischen Modellen zeigt aber, das ist nicht der Knackpunkt. Entscheidend sind wohl spezielle Nervenverbindungen, die eine direktere Kontrolle der Stimmmuskulatur erlauben. Und die finden sich ganz ähnlich bei evolutionär weit entfernten Arten.
Imitieren geht über Studieren
Hier kommuniziert Tecumseh Fitch mit einem sprachgewandten Vogel, eine Beo.
"Und die Antwort im Fall vom Singvogel und Papageien ist ja, sie haben eigentlich die gleiche Art von Verbindungen als wir Menschen. Jeder hat seine eigene evolutionäre Geschichte. In allen drei Fällen haben wir die gleichen Prinzipien gefunden.
Flexible Nervensteuerung als Voraussetzung für die Imitation von Lauten und damit auch für die Sprache. Und nicht nur das. Der Kulturanthropologe Robert Boyd von der Universität im amerikanischen Tempe hält das menschliche Imitationsvermögen für wichtiger als alle Intelligenz. Das zeigen ihm historische Beispiele.
Überall auf der Welt sind europäische Forscher verhungert, in Gebieten, in denen die Ureinwohner ohne Probleme überleben. Am individuellen Verstand hat es den Abenteurern sicher nicht gemangelt. Den Europäern fehlte das über Generationen angesammelte kulturelle Wissen der ortsansässigen Bevölkerung. Der Schlüssel ist hier wieder die Imitation. Im Zweifelsfall machen die Leute im Urwald und in der Großstadt das, was alle anderen machen, selbst wenn es der eigenen Erfahrung widerspricht.
Erfahrung zu ignorieren klingt unlogisch. Hier im Raum wollten es einige Leute nicht glauben. Aber in mathematischen Modellen können wir verfolgen, wie sich Überzeugungen in Populationen ausbreiten. Wenn die Umwelt sich häufig wandelt, dann setzt sich die Regel durch: kopiere das, was alle machen. Das liefert meist gute Ergebnisse. Manchmal kopiert man aber auch dumme Sachen, wie Bergsteigen oder den Wunsch, Artikel in "Nature" zu veröffentlichen.
Sinnlose Modeerscheinungen wie aktuell der Fidget Spinner, sind also die Ausnahmen der biologischen Grundregel für Menschen: Imitieren geht über Studieren!