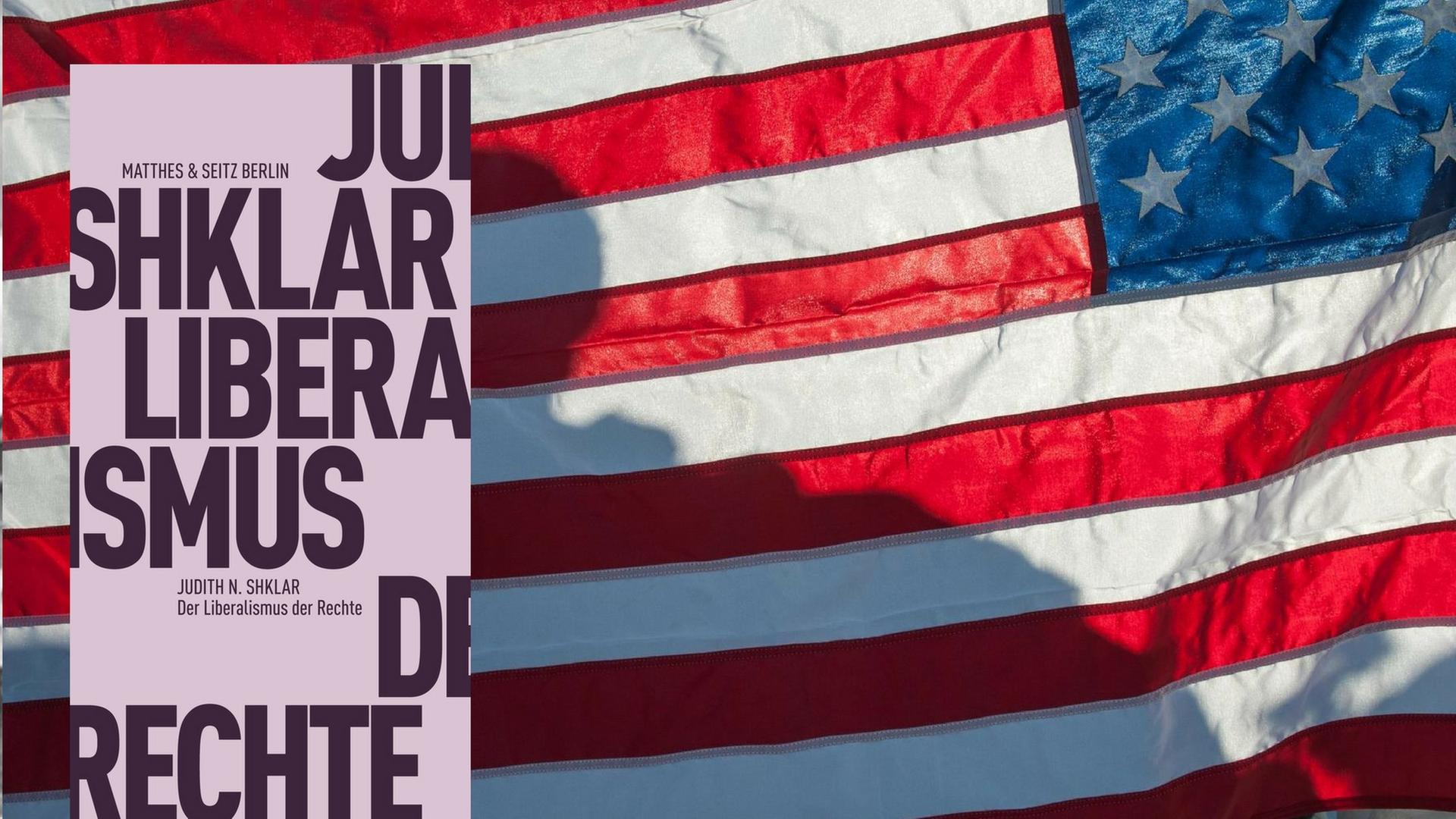"Es geht um die Freiheit eine Schusswaffe zu besitzen. Und die Freiheit, uns selbst verteidigen zu dürfen."
"Für mich als Christin bedeutet eine Waffe zu tragen, meine Sorge für Gottes Schöpfung wahrzunehmen."
"Die Waffen sind nicht das Problem, es sind die Leute die sie tragen."
"Viele Amerikaner sagen, wir müssen in der Lage sein, notfalls die Regierung zu bekämpfen"
"Ein Waffenbesitzer zu sein, ist ein wichtiger Teil ihrer Identität. Das ist kein Werkzeug oder so. Die Waffe definiert sie."
Augenblick mal: Waffe und Freiheit – das ist eine Einheit? Waffen besitzen, um notfalls die eigene Regierung bekämpfen zu können? Verantwortung des Christen gegenüber Gottes Schöpfung bedeutet, Waffen zu tragen? Eine Waffe zu besitzen, ist ein Teil der Identität?
Letzteres sagt nicht irgendwer, sondern Juliana Horowitz vom renommierten Forschungsinstitut "Pew Research Center". Sie hat in einer aufwendigen Studie das Verhältnis der Amerikaner zu ihren Waffen untersucht.
"Für Waffenbesitzer ist das Recht auf Waffen genauso wichtig wie Redefreiheit oder andere Freiheiten, die Menschen haben. Bei denen die keine Waffen besitzen, ist das anders. Die halten alles andere für zentral. Nur eine Waffe ist für sie keine bedeutende Freiheit, die jeder haben sollte."
Amerikaner und ihre Waffen
30 Prozent aller Amerikaner besitzen eine Schusswaffe, 40 Prozent leben in einem Haushalt, in dem es ein Gewehr oder eine Pistole gibt.
Etwa die Hälfte der weißen Männer besitzt eine Waffe. Bei Frauen und nicht-weißen Männern ist es ein Viertel.
(Musik Lynyrd Skynyrd)
Gott und Schusswaffen – darauf ist dieses Land aufgebaut. Das ist es, was es stark macht – singt die Südstaaten Rockband Lynyrd Skynyrd.

Woher kommt diese so tief sitzende emotionale Beziehung zu Pistolen und Gewehren? Es scheint so, als reiße man ein Stück Seele aus dem Leib, wenn man Amerikanern ihre Waffe nimmt. Warum ist das so? Pistolen im Baumarkt, in vielen Bundesstaaten praktisch keine Kontrollen. Wie kann das sein? Vor allem angesichts immer neuer Amokläufe mit Pistolen und Gewehren.
Waffenbesitz hat es nach der Unabhängigkeit des Landes in die Liste der Grundrechte in den USA geschafft, als zweiter Verfassungszusatz. Gleichberechtigt neben den Freiheitsrechten, die zum Bespiel freie Meinung, Religionsfreiheit oder Pressefreiheit garantieren. Längst nicht mehr alle halten das für zeitgemäß. Die Spaltung in der Frage ist aber vor allem eine zwischen Stadt und Land, so Stephen Halbrooke, Jurist und Waffenhistoriker.
"Viele Menschen in den USA haben noch das Siedlergefühl in sich. Also sich nur auf sich selbst verlassen, Unabhängigkeit, Freiheit. Und dann haben wir auf der anderen Seite diejenigen die glauben, dass Fleisch aus dem Supermarkt kommt. Die wären im Notfall hilflos. Und diese Grundhaltungen werden von Generation zu Generation weiter gegeben. Innerhalb der Familien, unter Freunden, in den Schulen."
Um aber die Emotionalität zu erklären, mit der darüber diskutiert wird, gilt es drei Urerfahrungen der amerikanischen Entwicklung genauer anschauen. Urerfahrungen, die sich praktisch in die DNA des "Amerikanerseins" eingebrannt hat:
Die Besiedlung des amerikanischen Westens. Menschen auf sich allein gestellt. Waffen als Lebensversicherung.
Der Kampf um die Unabhängigkeit. Britische Kolonialherren, die das Waffenmonopol für sich beanspruchen.
Und: Die tief religiösen frühen Einwanderer, wegen ihres Glaubens zu Hause in Europa unterdrückt und verfolgt. Christen, die sich gegen neue staatliche Tyrannei verteidigen können wollen.
Urerfahrung der Siedlungsgeschichte
(Fimausschnitt "High Noon")
"High Noon". Der Original Titel des Westerns, zu dem diese Szene gehört. "12 Uhr Mittags". Der Western, die wohl amerikanischste Form des Kampfes von Gut gegen Böse. Der ritualisierte Showdown, das streng geregelte Duell mit Pistolen und Gewehren.
"Wenn Du das draußen im Grenzland warst, dort im Westen, brauchtest du das Gewehr, um dich verteidigen zu können."
Der Western aber knüpft an dieser Urerfahrung der amerikanischen Siedlungsgeschichte an. Das Land, den Ureinwohnern genommen, musste verteidigt werden, gegen angreifende Indianer und Räuberbanden gleichermaßen. Wichtigstes Nahrungsmittel waren selbst geschossene Tiere. Wer keine Waffe hatte, hungerte und war wehrlos.
Das ist mehr als 100 Jahre her. Das Gefühl, sich selbst helfen können zu müssen, ist geblieben.
"Diese Werte wurden vererbt. Wir hatten in unserer Familie immer ein Gewehr. Wer würde das aufgeben? Und warum?"
"Ich habe mich nie mit meiner Waffe verteidigen müssen. Aber ich sehe, dass Menschen das Recht dazu haben. Viele leben in gefährlichen Gegenden. Und ich sehe, dass es notwendig ist, dort eine Waffe zu haben."
Millard Stanley handelt mit Waffen. Seine Kunden, vor allem aus ländlichen Gebieten.
Wer auf dem Land wohnt, weiß, dass er sich im Ernstfall nicht auf den Staat verlassen kann. Polizei, Feuerwehr – alles viel zu weit weg.
"Menschen wollen sich in ihrem Haus sicher fühlen. Man sagt hier: Wenn Sekunden zählen, ist die Polizei Minuten entfernt."
Oder, wie es in einem populären Country Song von Josh Thomson heißt: "Unser Haus wird vom lieben Gott und einem Gewehr beschützt. Wenn Du hier nicht willkommen bist, dann lernst Du sie beide kennen."
Hier zeigt sich zudem eine der ganz großen unterschiedlichen Entwicklungen zwischen Stadt und Land, sagt Stephen Halbrooke. Auch wenn es stark darauf ankommt, in welchem Teil der USA man lebt. Im Süden haben auch viele Städter eine Waffe, im Norden weniger.
Amerikaner und ihre Waffen. Die Fakten:
Auf dem Land hat etwa die Hälfte aller Erwachsenen, egal welcher Herkunft oder Hautfarbe, ein Gewehr oder eine Pistole. In der Stadt sind es weniger als ein Viertel.
Zwei Drittel der Waffenbesitzer sagen, sie wollen sich selbst verteidigen. Bei Frauen ist es meist das einzige Motiv, eine Pistole zu kaufen. Männer wollen damit auch jagen und als Sport schießen.
Drei Viertel der Waffenbesitzer sagen: Sie ist wichtig für meine Freiheit.
Der Kampf um die Unabhängigkeit
Die andere, geradezu traumatische Grunderfahrung liegt weiter zurück, im Unabhängigkeitskrieg. Eines versuchten britische Soldaten im Auftrag des Königs in London immer: die amerikanischen Siedler zu entwaffnen. Ihnen das Recht und die Möglichkeit zu nehmen, sich selbst zu verteidigen. Nur weil die Amerikaner Waffen hatten, konnten sie die Unabhängigkeit gewinnen.
"Sie haben die Waffen in die Hand genommen und die Freiheit gewonnen. Da haben sie gesagt: "Wäre gut, das in der Verfassung zu garantieren."
Der spätere Präsident James Madison hatte einmal geschrieben, dass die Amerikaner Menschen mit Waffen vertrauen, die europäischen Monarchien aber nicht. Und so spiegelt sich im Waffenbesitz auch die damals alles entscheidende Frage: Demokratie oder Monarchie. Die Frage ist geblieben, auch wenn es nicht mehr um Monarchie geht, so der Historiker Bob Tupper:
"Das führt zum zentralen Thema: Wie mächtig soll eine zentrale Regierung sein? Das ist das Herzstück des Konflikts um Waffen. Kann mir die Regierung in Washington meine Waffe wegnehmen? Symbolisch nähme sie damit weit mehr als die Waffe. Meine Unabhängigkeit und die Möglichkeit, Widerstand zu leisten."
Das hat sich tief in das Narrativ amerikanischer Geschichtsschreibung eingegraben, so lernen es schon die Kinder in der Schule. Es braucht ein Gleichgewicht zwischen Regierung und Bürgern. Wer kein Recht auf Waffen hat, kann niemals ebenbürtig sein.
Dies spiegelt die insgesamt regierungskritische Grundhaltung vieler Amerikaner. Und die Gesetzgebung.
Ein Beispiel: Die amerikanische Bundesregierung darf private Waffen weder konfiszieren noch registrieren. So sagt es ein Gesetz aus dem Jahr 1941. Und das hat mit Deutschland zu tun, so der Jurist und Waffenhistoriker Stephen Halbrooke:
"Bevor die USA in den 2. Weltkrieg eingriffen, verabschiedete der Kongress ein Verbot, Waffen zu konfiszieren oder zu registrieren. Die Begründung war, dass dies in Nazi-Deutschland passiert sei, im kommunistischen Russland, in all den diktatorischen Ländern."
Ab 1933 nämlich waren die Juden in Deutschland systematisch entwaffnet worden. Und über die antijüdischen Pogrome 1938 war in den amerikanischen Zeitungen intensiv berichtet worden. Verbreitete Meinung: Mit Waffen hätten sich die Juden gegen die Tyrannei der Nazis wehren können. Amerikanern sollte das niemals passieren.

Amerikaner und ihre Waffen. Die Fakten:
40 Prozent der männlichen Besitzer einer Pistole haben sie geladen griffbereit. Bei Frauen sind dies 30 Prozent.
Wenn die Eltern Waffen haben, schießen Jungen durchschnittlich mit 12 Jahren zum ersten Mal selbst. Mädchen mit 17.
Waffenmesse in einem kleinen Ort in Virginia, nicht weit von den Blue Ridge Mountains, dort wo es sehr ländlich wird. In der örtlichen Mehrzweckhalle reiht sich Stand an Stand.
Dough Stockman, einer der Händler, verkauft alles von der Pistole bis zum Maschinengewehr. Er besitzt selbst eine ganze Reihe von Waffen, steckt auch meist eine geladene Pistole ein, wenn er aus dem Haus geht. Waffen bedeuten für ihn Freiheit, diese und sich selbst verteidigen zu können. Er hofft sie nie zu brauchen, aber wenn, dann hat er sie dabei.
"Es geht um die Freiheit, eine Schusswaffe zu besitzen. Und die Freiheit, sich selbst verteidigen zu dürfen."
Kundin Jane sitzt im Rollstuhl, nimmt Pistolen und kleine Gewehre in die Hand. Sie hat neue Schultergelenke bekommen, da sind ihre alten Gewehre zu groß und zu schwer geworden.
Und auch bei ihr fällt das Wort: Freiheit. Waffen hätten mit der ganz eigenen amerikanischen Vorstellung von Freiheit zu tun.
Mit Waffen gegen religiöse Unterdrückung
Viele der ersten Siedler kamen aus religiösen Gründen. Meist waren es radikale Protestanten, die wegen ihres Glaubens in Europa verfolgt und bestraft wurden. Sie sahen in den neuen amerikanischen Kolonien ihre Chance. Hier konnten sie ihren Glauben frei leben, ihre "leuchtenden Städte auf dem Berg" errichten. Wenn sie allerdings "Glaubensfreiheit" sagten, dann war das selten liberal. Gemeint war die Freiheit vor staatlicher Einmischung in religiöse Dinge. Dass die Kirche sich in den Staat einmischt, war dagegen gewollt.
"Sie hatten eine Ideologie der Freiheit. Und die Vorstellung, diese Freiheit mit Gewalt verteidigen zu dürfen. Und dann gab es für die Siedler einen ganz praktischen Aspekt: sie mussten einfach überleben."
Die Nachfahren der religiösen Einwanderer hatten den größten Einfluss auf das, was einmal die Vereinigten Staaten und ihre Kultur werden sollte. Die meisten anderen Siedler waren gekommen, um Geld zu verdienen und vielleicht auch wieder zu gehen. Sie wollten bleiben. Eine Gesellschaft nach ihrem Bild schaffen. Sie waren es, die Schulen und Universitäten bauten, deren Lehrpläne entwickelten und Lehrer aussuchten. Sie prägten am Ende auch die Verfassung. Einschließlich des Rechts auf Waffenbesitz. Waffen, die man notfalls gegen die eigene Regierung einsetzen kann, wenn sie einem die Freiheit nehmen will.
"Wenn man das Profil von Waffenbesitzern anschaut, sehen wir, dass weiße Evangelikale häufiger eine Waffe haben als andere.
Karen Swallow Prior, Professorin an der protestantischen Liberty University sieht darin keinen Widerspruch. Ganz im Gegenteil, für sie sind Waffen ein Werkzeug, um Gottes Auftrag zu erfüllen.
"Für mich als Christin bedeutet eine Waffe zu tragen, meine Sorge für Gottes Schöpfung wahrzunehmen."
Diese Haltung ist innerhalb der christlichen Konfessionen hochumstritten. Die meisten berufen sich auf das christliche Gebot des Friedens und interpretieren es als Frieden ohne Waffen. Nicht so die Evangelikalen, zu denen sich etwa ein Viertel der Amerikaner bekennt. Der Pfarrer und Buchautor Troy Newman beispielsweise sieht in einer Podiumsdiskussion keinen Widerspruch bei sich. Er kämpft gleichzeitig gegen Abtreibung und für Waffenbesitz.
"Die Rechte kommen direkt von Gott. Und das erste Recht, das uns gegeben ist, ist das Recht auf Leben. Wenn man in der Weltgeschichte herumschaut, Stalin, China - haben Millionen getötet. Wir müssen alle Gewalt beenden. Aber die beste Art das zu tun ist, dass gerade bewaffnete Leute dieses Gebäude hier bewachen."
Immer ist dies das individuelle Recht auf Waffen. Nicht das Recht des Staates, mit Waffengewalt zu schützen. Das genau eben nicht.

Amerikaner und ihre Waffen. Die Fakten:
Doppelt so viele Republikaner wie Demokraten besitzen eine Schusswaffe
Zwei Drittel aller Waffenbesitzer würden erlauben, dass Lehrer im Unterricht bewaffnet sind
Vier von zehn Amerikanern sagen, dass sie jemanden kennen, der erschossen wurde.
Jeder fünfte wurde schon mal mit einer Waffe bedroht
Barack Obama liest die Namen von Opfern eines Amoklaufs in einer schwarzen Kirche. Immer wenn so etwas passiert, wird der Ruf laut, Waffen zu regulieren.
Die Diskussion darüber ist dann hochemotional. Weil es um mehr als Gesetze geht. Es geht um Freiheit, Individualität und oftmals schwer erkämpfte Rechte.
Waffen sind Teil des kollektiven Narrativs darüber, wer man ist. Was es heißt, Amerikaner zu sein. Das Land hat eine gesellschaftliche Entwicklungsgeschichte im Zeitraffer hinter sich, kurz genug und intensiv genug, um prägende Grunderfahrungen bis in die Gegenwart wirken zu lassen.
Die Besiedlung des Westens, bei der jeder auf sich selbst und seinen Nachbarn angewiesen war. Der Kampf um die Unabhängigkeit, gleichzeitig um Bürgerrechte, Freiheit und demokratische Mitbestimmung. Die Erfindung einer neuen, einzigartigen Gesellschaft.
Und die Flucht vor religiöser Verfolgung und Unterdrückung, das selbst gegebene Versprechen, die einmal gewonnene Freiheit nie wieder herzugeben.
Als im Frühjahr 2018 siebzehn Menschen in einer Highschool in Florida erschossen werden, geht nicht nur ein weiterer Aufschrei durchs Land, sondern Hunderttausende Jugendliche gehen auf die Straße. Sie sagen: Schluss mit euren alten Geschichten. Sorgt dafür, dass Waffen von der Straße kommen, Waffenbesitz reglementiert wird. Wir wollen sicher leben.
"Wir sind Zeugen für den Beginn einer Revolution. Das ist nur der Anfang. Niemand sollte glauben, das war’s schon. Vor allem nicht die Politiker, die von der Waffenlobby unterstützt werden."
Der damals 17-jährige David Hogg, der zum eloquenten Aushängeschild der Schülerproteste wird. Das Thema Waffen wird von einem Tag auf den anderen zum Generationenkonflikt, der gleichzeitig das Auseinanderdriften von urbanem und ländlichem Leben weiter beschleunigt. Denn natürlich finden die Schülerproteste in den großen Städten statt, nicht in den kleinen Gemeinden des mittleren Westens. Ein weiteres Mal entsteht dort eine Bedrohung des eigenen Lebensstils.
Und Waffen, so hatte es ja Juliana Horowitz in ihrer Studie herausgefunden, sind für ihre Besitzer ein wichtiger Teil der Identität. Und dann löst die angekündigte Revolution zwangsläufig Angst aus. Angst, diese eigene Identität zu verlieren.