
Siegen - Universität. Vorlesung an der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. 20 Studenten nehmen an einem großen runden Tisch Platz. Alle sind für den Masterstudiengang "Plurale Ökonomik" eingeschrieben. Eine Rarität in der deutschen Hochschullandschaft für Studierende der Volkswirtschaftslehre. Die Einführungsvorlesung hält Helge Peukert. Auf einem Schaubild ist ein Baum mit verschiedenen Ästen dargestellt, auf denen die verschiedenen Denkschulen der Ökonomie eingezeichnet sind.
"Den Mainstream haben die da, die Neoklassik nach wie vor. Und dann teilt es sich halt auf: Links von uns aus gesehen, da gab es die historische Schule, Marxismus, Post-Keynesianer und so weiter, und rechts davon Ordoliberalismus, Österreichische Schule und auch sehr, sehr viel andere Verzweigungen."
"Im Prinzip nur eine Denkrichtung"
Der Student Martin Buchner ist über die Vielfalt der Denkansätze begeistert. Was er im gewöhnlichen VWL-Bachelorstudium gelernt hat, fand er ziemlich eindimensional.
"Also im Bachelor war es ja im Prinzip nur eine Denkrichtung, die wirklich repräsentiert wurde. Und jetzt haben wir gerade eben gesehen, haben wir allein schon acht Denkschulen uns angeschaut im groben Überblick. Das ist schon auf jeden Fall ein fundamentaler Unterschied, ja."
Siegen ist die erste staatliche Universität hierzulande, an der es einen Studiengang für plurale Ökonomik gibt. Andere Universitäten, wie Bayreuth, haben ihr Lehrangebot um zusätzliche Veranstaltungen ergänzt. In der Moselgemeinde Bernkastel-Kues ist sogar eine neue kleine private Hochschule entstanden, um Studenten eine alternative ökonomische Ausbildung zu ermöglichen. Ist an diesen Beispielen schon ein Trend in der Ausbildung erkennbar? Welche Spuren hat die Finanzkrise, die vor zehn Jahren die reale Wirtschaft erschütterte, in der Wirtschaftswissenschaft hinterlassen? Haben sich die Inhalte für die 24.000 Studierenden der Volkswirtschaftslehre verändert? Und die all der anderen Studierenden mit wirtschaftswissenschaftlichen Kursen?
Das sind wichtige Fragen, denn welche Wirtschaftstheorie gelehrt wird, beeinflusst das Denken der Ökonomen und deren Forschung. Ihre Ratschläge wiederum prägen die öffentliche Debatte und Entscheidungen der Politik und damit das Leben der Bürger. Das hat konkrete Auswirkungen, zum Beispiel beim Mindestlohn, einer Gesundheitsreform, dem Ausbau des schnellen Internet oder der Privatisierung von Autobahnen.

Bei der Geburt der Wirtschaftswissenschaften im 18. Jahrhundert sprach man von der Nationalökonomie. Begründer ist der Schotte Adam Smith. Auf die sogenannten Klassiker folgten diverse Denkschulen. Durchgesetzt hat sich im Laufe des 20. Jahrhunderts weitgehend die Neoklassik, weswegen man sie auch als Mainstream bezeichnet. Diese Denkschule beherrscht die Wirtschaftswissenschaft - mit einer Unterbrechung durch den Keynesianismus - bis heute.
Die Ökonomie - die sich gerne als die Königsklasse der Sozialwissenschaften versteht - gewann in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts enorm an Einfluss und Selbstbewusstsein. Prominente Ökonomen waren zwischenzeitlich sogar der Auffassung, größere Wirtschaftskrisen seien künftig ausgeschlossen, weil die Erkenntnisse der Ökonomie sie verhindern könnten. So erklärte der Nobelpreisträger Robert Lucas 2003:
"Das zentrale Problem der Vermeidung von Depressionen ist gelöst."
Die Queen macht die Ökonomen sprachlos
Eine krasse Fehleinschätzung. 2007 platzte in den USA die Immobilienblase, was erst Banken erschütterte und dann ganze Volkswirtschaften. Weil sie die Gefahr nicht rechtzeitig erkannt hatten, geriet auch die Zunft der Ökonomen in die Sinnkrise. Beispielhaft dafür war der Besuch von Queen Elisabeth in der London School of Economics. Dort fragte sie die versammelte Ökonomen-Elite, warum eigentlich keiner von ihnen die Krise kommen gesehen habe. Niemand vermochte ihr darauf eine überzeugende Antwort zu geben.
Dass sich die Marktteilnehmer plötzlich in großer Zahl misstrauen könnten, wie die Banken dies während der Finanzkrise taten, hatten ihre Modelle nicht vorgesehen. Roland Strausz, Ökonom an der Humboldt-Universität in Berlin:
"Ja, das ist ein großer Schock gewesen und das ist noch immer ein großer Schock, aber es zeigt auch ein bisschen, es zeigt überhaupt die Grenzen von Wirtschaftswissenschaften auf, heterodox oder nicht heterodox."
Er verweist auf die begrenzte Aussagekraft ökonomischer Modelle:
"Wir haben nicht einfach eine Formel, wo wir sagen können, ah ja, ab dem Punkt ist es ganz klar, da bricht die Brücke zusammen, ja, mit einem Zehntonner darf man nicht über die Brücke fahren. So was gibt es in den Wirtschaftswissenschaften nicht, es sind immer Tendenzen: Na ja, man kann sagen, wenn der Wettbewerb weiter abnimmt, das ist eigentlich nicht gut. Aber ab wann dann wirklich eine Krise existiert, ist unklar."
Plädoyer gegen "autistische Wirtschaftswissenschaft"
Gegen die heutige Art der Lehre in der Wirtschaftswissenschaft regte sich schon vor der Finanzkrise erster Widerstand. An der Pariser Sorbonne-Universität protestierten Studierende im Jahr 2000 mit einem offenen Brief gegen eine ihrer Ansicht nach "autistische Wirtschaftswissenschaft". Mathematik und formale Modelle dürften kein Selbstzweck sein. Nach der Veröffentlichung des Briefes in der Zeitung Le Monde gab es eine Debatte. Bekannte Ökonomen lehnten wenig später in einer Gegenpetition im gleichen Blatt die Idee einer post-autistischen Ökonomie ab. Trotzdem bildeten sich in einigen Ländern wie den USA, Spanien und Australien Gruppen von Wissenschaftlern, die sich mit der Idee der Pariser Studenten beschäftigten.

In Deutschland gründeten Studierende bei der Sommerakademie des Netzwerkes Attac 2003 eine kleine Gruppe, aus der sich später der Verein Netzwerk Plurale Ökonomik entwickelte. Der Verein ist international mit gleichgesinnten Initiativen vernetzt. Geändert hat sich an der Lehre ihrer Meinung nach kaum etwas. Mehr als 70 Studentengruppen aus 30 Ländern forderten 2014 weitere Denkschulen, neben der auf der Neoklassik basierenden Lehre, in die Wirtschaftswissenschaft einzubeziehen.
"Wir beobachten eine besorgniserregende Einseitigkeit der Lehre, die sich in den vergangenen Jahrzehnten dramatisch verschärft hat. Diese fehlende intellektuelle Vielfalt beschränkt nicht nur Lehre und Forschung, sie behindert uns im Umgang mit den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts - von Finanzmarktstabilität über Ernährungssicherheit bis hin zum Klimawandel. Wir benötigen einen realistischen Blick auf die Welt, kritische Debatten und einen Pluralismus der Theorien und Methoden."
Wunsch nach "Vielfalt der theoretischen Perspektiven"
Sie ziehen Parallelen zu anderen Fächern:
"Niemand würde einen Abschluss in Psychologie ernst nehmen, der sich nur mit Freudianismus beschäftigt. Oder ein politikwissenschaftliches Studium, in dem nur der Leninismus auftaucht. Umfassende volkswirtschaftliche Bildung vermittelt die Vielfalt der theoretischen Perspektiven."
Die Idee der pluralen Ökonomik erhielt Zulauf.
"Irgendwann habe ich mich gefragt, warum gibt es das eigentlich nicht hier in Kiel, und dann bin ich zum Präsidium gegangen, habe mir da meinen Antrag geholt zur Gründung einer Hochschulgruppe, und habe das dann einfach mal gemacht."
Heiko Kolz hatte 2012 mit dem Wirtschaftsstudium an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel angefangen, also fünf Jahre nach Ausbruch der Finanzkrise. Kolz, der aus einer Arbeiterfamilie stammt, hatte da schon eine Lehre als Dachdecker hinter sich und einige Berufserfahrung als Vorarbeiter.
"Und habe mich da gefragt, warum manche Leute mit ganz anderen Sachen viel, viel mehr Geld verdienen, wo ja im Nachhinein dann immer gesagt wurde, die schieben einfach nur Geld hin und her und verdienen sich damit eine goldene Nase und wetten hierauf und wetten darauf. Und selber macht man sich so 14 Stunden am Tag auf dem Bau quasi den Rücken kaputt und hat im Monat so viel, dass man gerade so seine Rechnungen bezahlen kann."
Angebot und Nachfrage und Nutzenmaximierung
Kolz machte sein Abitur nach und studierte Wirtschaft. Bekam er im Bachelor-Studium seine ökonomischen Fragen beantwortet?
"Nee, das nicht so richtig, also, na klar, man kriegt schon viele Einblicke, was die ganzen Grundlagen angeht, wie bilden sich Preise, Angebote und Nachfrage, aber es fällt halt auch sehr viel vom Tisch. Gerade im Bachelor ist das natürlich wirklich so, dass man gar nicht richtig eingeführt wird in das Thema, sondern dass es halt eigentlich direkt losgeht: Angebot und Nachfrage und Nutzenmaximierung, und danach folgen dann ja auch relativ schnell die ganzen Berechnungen, die man dazu anstellen kann."
Roland Strausz ist der Nachwuchsbeauftragte des Vereins für Sozialpolitik. Mit 3.800 Mitgliedern ist es der größte und einflussreichste Zusammenschluss von Ökonomen im deutschsprachigen Raum. Strausz kennt die Kritik an der jetzigen Ausbildung von Ökonomen, verteidigt sie aber. Er wirbt für eine schrittweise Ausbildung, bei der die Studenten wie gehabt erst einmal vor allem das Gleichgewichtsmodell des Marktes erlernen sollten. Der Wissenschaftler vergleicht den stufenweisen Aufbau der Lehre mit dem Fahrunterricht:
"Bachelor ist der Anfang, dann wird man ein bisschen mit dem Auto herumgefahren. Master lernt man selbst fahren, selbst ökonomische Argumente aufzubauen und zu entwickeln. Und in der Forschung, ja, in der Promotion lernt man letztendlich den Motor vom Auto auseinander zu bauen und zusammen zu bauen, so dass man wirklich ganz neue ökonomische Theorien zusammenbauen kann."
"Man muss das Standardmodell einmal gelernt haben"
Genauso sieht es Johannes Becker, der an der Universität Münster Volkswirtschaft lehrt:
"Man muss aber sagen, dass alle diese moderne Literatur immer wieder auf dieses Standardmodell referiert, und es ist einfach wichtig, um nachher die Forschungsliteratur lesen zu können, dieses Standardmodell mit all seinen Konsequenzen auch einmal gelernt zu haben. Da stecken wir ein bisschen in einem Dilemma, dass wir den Studierenden das Rüstzeug geben müssen, um nachher wirklich am Ende selbst Forschung betreiben zu können, sie aber auch gleichzeitig bei Laune halten zu müssen und ihnen nicht den Eindruck zu geben, dass es überall diese super interessanten ökonomischen Fragen gibt und wir uns jetzt in einem Zweigüterdiagramm bewegen und Kurven verschieben."
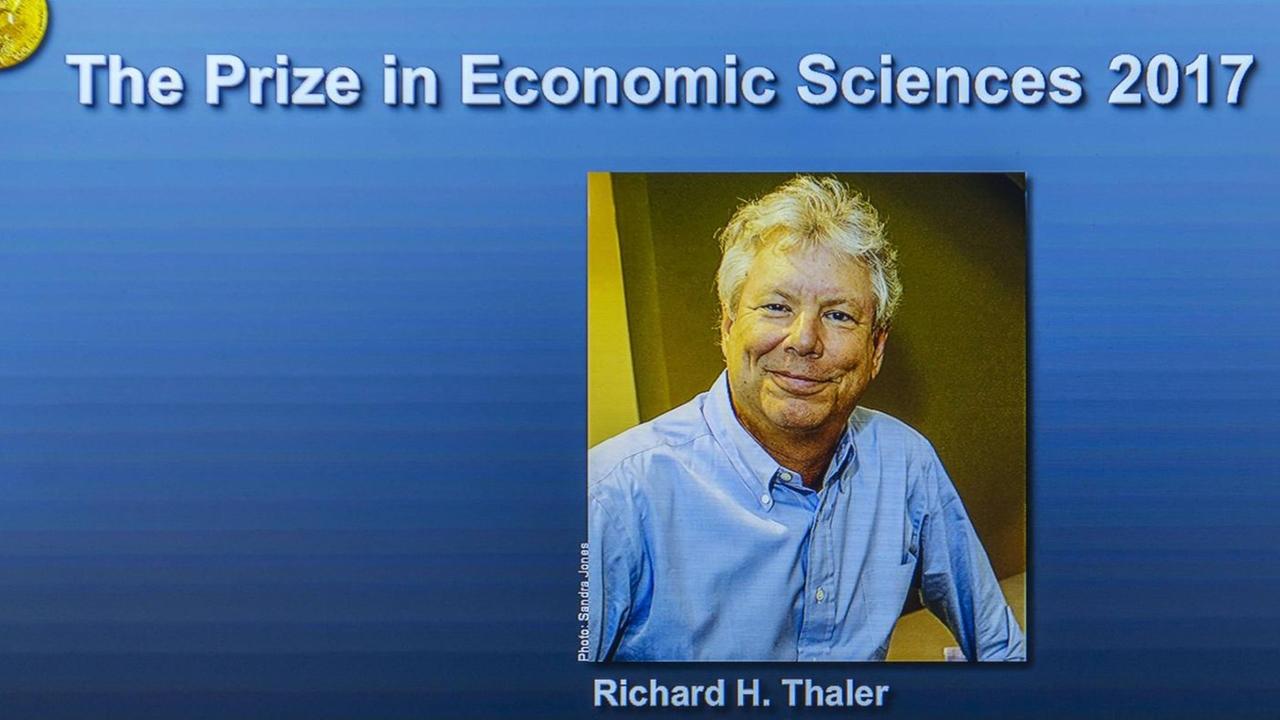
Aber der Ökonom hat auf die Kritik an seiner Lehre reagiert:
"Ich kann ja zunächst nur für mich oder die Leute sprechen, die ich jetzt kenne, da hat es schon Anpassungen an diese Kritik gegeben. Wir führen jetzt auch früher verhaltensökonomische Ansätze ein."
Verhaltensökonomen haben Erkenntnisse der Psychologie in die Ökonomie einbezogen. Dabei zeigt sich, das Menschen in manchen Situationen irrational oder kooperativ handeln, statt rational und eigennutzorientiert, wie es der Mainstream in seinen Modellen zugrunde legt. Dieses Jahr erhielt der Verhaltensökonom Richard Thaler den Wirtschaftsnobelpreis.
Monokultur von Forschung und Lehre
Als Kernfach der Volkswirtschaftslehre gilt die Mikroökonomie, sie untersucht die ökonomischen Entscheidungen einzelner Akteure wie Unternehmer oder Beschäftigter. Die Makroökonomie dagegen untersucht gesamtwirtschaftliche Vorgänge. Auf beide entfallen rund ein Fünftel der Kurse an den Universitäten. Der Großteil der anderen Kurse beschäftigt sich mit Betriebswirtschaftslehre, Jura, Mathematik und Statistik. Das ergab eine Studie des Netzwerks plurale Ökonomik. Weniger als zwei von hundert angebotenen Kursen beschäftigten sich in Deutschland mit Wirtschaftsgeschichte, Ethik oder der Theoriegeschichte der Volkswirtschaftslehre, VWL.
Das Fach habe sich in mancher Beziehung schon vor der Finanzkrise verändert, sagt Johannes Becker:
"Die VWL ist viel internationaler geworden, die wird jetzt dominiert von Arbeiten amerikanischer Ökonomen und teilweise britischer Ökonomen."
Becker hat an der Universität Köln studiert, wo es 2009 sogar zu einer öffentlichen Debatte bei der Neubesetzung von Lehrstühlen in der VWL kam. Die Universität hatte sich nach dem Zweiten Weltkrieg einen Ruf durch ihr ordnungspolitisches Profil erarbeitet. Hier lehrte Alfred Müller-Armack, Berater von Ludwig Erhard und Vater der "Sozialen Marktwirtschaft". Dort waren 2003 gleich sechs Lehrstühle vakant. Die Gelegenheit nutzte die Universität, um in den Wirtschaftswissenschaften eine neue Forschungsgruppe für Makroökonomen aufzubauen. Damit wurde die Wirtschafspolitik mit ihrer ordoliberalen Denkrichtung praktisch aufgegeben. Emeritierte Professoren protestierten dagegen vergeblich.
"Monokultur besteht fast weltweit"
Helge Peukert bedauert es: "Der Einfluss der angelsächsischen Diskurs-Kultur, also Modellökonomie und so, dem wird ja fleißig nachgeeifert, und die letzten Relikte der deutschen Tradition also Ordoliberalismus und so weiter, ich denke da an die Universität Köln und aber auch ein paar andere, die gibt es nicht mehr. Da gab es ja auch Diskussionen darüber. Und so ist dann diese Monokultur zu erklären, und die besteht ja fast weltweit. Und das ist sehr bedauerlich."

In Deutschland strich die Volkswirtschaftslehre große Teile aus dem Lehrkanon, beispielsweise die hier zu Lande entstandene historische Schule. Deren Vertreter bezweifelten, dass der Verlauf der Wirtschaft gewissermaßen Naturgesetzen unterliegt. Nach ihrer Überzeugung verhielt sich ein italienischer Kaufmann in Florenz der Renaissance eben anders als ein Börsenhändler der Neuzeit in London. Sie bezogen kulturelle Faktoren in die Wirtschaftswissenschaft ein. Dafür gibt es auch heute gute Argumente: Schließlich gibt es auch im Kapitalismus kulturelle Unterschiede zwischen China, Deutschland oder Saudi Arabien. Aber damit beschäftigt sich kaum ein Ökonom.
Noch gibt es wenig Pluralität an wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten. Neun von zehn Professoren gehören, laut einer Studie von Forschen aus Linz, zum Mainstream. Andere Ansätze seien nur marginal bei den Lehrstühlen vertreten, andere wie die feministische Ökonomie oder die Österreichische Schule hingegen gar nicht.
Ökonomie durch die Brille mehrerer Denkschulen betrachten
Helge Peukert, Professor an der Universität Siegen, findet es wichtig, ökonomische Entwicklungen durch die Brille mehrerer Denkschulen zu betrachten. Warum, das erklärt er seinen Studenten in der Einführungsvorlesung am Beispiel der Krise in Griechenland:
"Jetzt betrachten Sie das aus Sicht eines Post-Keynesianers. Da sagen die, die haben geringe Löhne, da investieren die Unternehmer nicht, die Banken geben keine Kredite, also Löhne rauf, Hilfsprogramm. Jetzt kommt einer von der österreichischen Schule, ein Marktliberaler, und der sagt, ja, ist kein Wunder, man kann da kaum ein Unternehmen vernünftig gründen, Eigentumsverhältnisse, unklar, wem überhaupt was gehört und so. Da gibt es keine formalklaren Arbeitsverträge und und und - deswegen brauchen die erst mal formale Demokratie, klare formalisierte Märkte, und der Unternehmergeist muss durch Entbürokratisierung gefördert werden. So, und jetzt können sie sich sagen, wer hat denn Recht? Irgendwo beide, wenn Sie mal in dem Land gewesen sind."
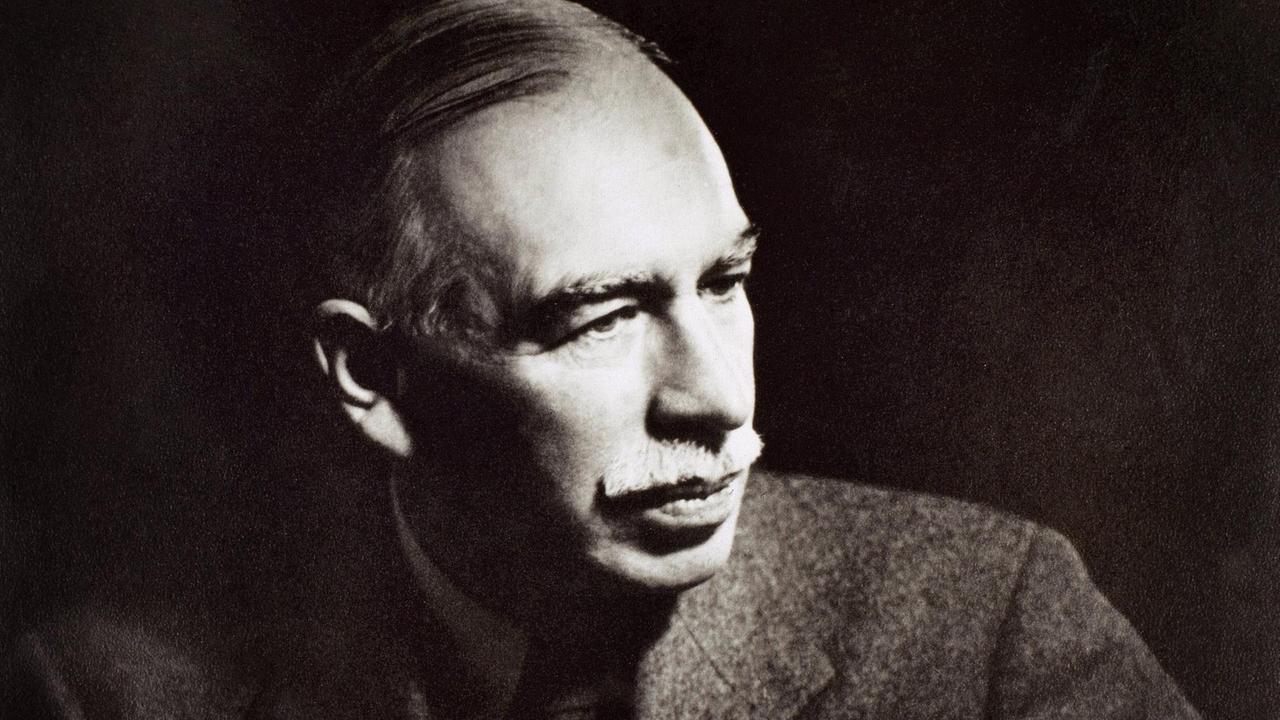
Peukert, der mit einer Griechin verheiratet ist, war oft dort. Nach der Vorlesung holt er sich einen Stapel Lehrbücher aus der Bibliothek, um sie zu analysieren. Er arbeitet sich für ein Forschungsprojekt durch einige Lehrbücher.
"Habe mich gefragt, was wird dort vermittelt, werden die Schlüsse, die dort gezogen werden, ergeben die sich wirklich aus den Modellannahmen? Passen die Beispiele, die dann aus der realen Welt gebracht werden wirklich zu diesen Modellen? Und wird den Studenten so unterschwellig und indirekt eine ganze bestimmte Weltsicht vermittelt? Und mein Eindruck ist, ja, das wird es."
"Manipulation und ideologisches Framing"
Dabei war er zunächst skeptisch gewesen, weil Silja Graupe - eine andere alternative Ökonomin - einigen wichtigen Lehrbüchern eine marktideologische Schlagseite vorgeworfen hat.
"Ich muss aber sagen, von der Grundaussage her hat sie Recht."
Graupe, Mitbegründerin der alternativen Hochschule in Bernkastel-Kues, spricht von einer Manipulation der Studenten. Das geschähe durch ideologisches Framing: Indem die Kategorie Markt immer wieder positiv konnotiert würde, beispielsweise mit Begriffen wie Freiheit und Demokratie. Dagegen würde die Kategorie Staat oft negativ konnotiert, mit Begriffen wie Zwang oder Kontrolle. Johannes Becker, kein Vertreter der pluralen Ökonomie, teilt ihre Beobachtung, zieht aber andere Schlüsse.
"Es gibt dieses Framing in einigen Lehrbüchern, das ist völlig ohne Frage der Fall. Die Frage ist, ob das Auswirkungen hat auf die Art wie praktizierende Ökonomen dann darüber nachdenken. Und wenn man sich die Bandbreite anguckt, mit der der Staat als allgemeines Problem für die Wirtschaft oder als Heilsbringer betrachtet wird, kann ich mir das jetzt gerade nicht vorstellen, dass das Framing hier wirklich so stark ist, wie es hier suggeriert wird."
Neue Studiengänge findet der Ökonom gut, ganz im Sinne des Wettbewerbs:
"Es ist überhaupt nicht sinnvoll, wenn alle das Gleiche machen. Und deswegen begrüße ich das auch, genau unter diesen Gesichtspunkten, dass die Universität Siegen jetzt so ein Programm einberufen hat. Aber letztlich geht es nicht darum, dass man irgendwelche Vorgaben an Bandbreite erfüllt, sondern dass man Forschungsarbeiten hervorbringt, die uns helfen, die Welt besser zu verstehen. Es klingt immer toll, wenn man alles plural macht und so viel über den Tellerrand guckt. Aber letztendlich kommt es nur darauf an, dass Arbeiten erscheinen, die uns helfen, Verhalten vorherzusagen."
"Ökonomik ist keine Esoterik"
Dass die Chancen dafür bei dem Studiengang in Siegen gut sind, glaubt Nils Goldschmidt. Er hat den Aufbau des Studiengangs in Siegen unterstützt. Er denkt dezidiert marktwirtschaftlich und hat lange am Walter-Eucken-Institut in Freiburg gearbeitet.
"Wir wollen hier Ökonomik betreiben, das ist keine Esoterik, was wir hier machen, sondern es ist Ökonomik. Und wir wollen den Studierenden eben auch zeigen, dass das Forschungsfelder sind, dass das auch sinnvoll ist, sich vielleicht auch forschungsmäßig und möglicherweise auch mit Perspektive für eine weiterführende akademische Qualifikation, sich in diese Felder hineinzubegeben."
27 Studenten sind es im ersten Semester, 25 im zweiten – mehr war nicht geplant. Die Lehrenden wünschen sich, die Studierenden sollen lernen, sich in gesellschaftliche Debatten einzubringen.
"Studierende sollen sprachfähig sein, sie sollen wirtschaftspolitische Positionen beziehen, die aber eben ökonomisch fundiert ist und nicht nur politisch gefärbt. Und das ist sozusagen das Ziel, dass wir hier Ökonominnen und Ökonomen ausbilden, die tatsächlich einen breiten Blickwinkel haben und die auch Positionen beziehen können. Und wir sind davon überzeugt, dass das Studierende sind, die im Zweifel für viele, die Ökonomen suchen, vielleicht sogar die besseren Ökonomen sind."




