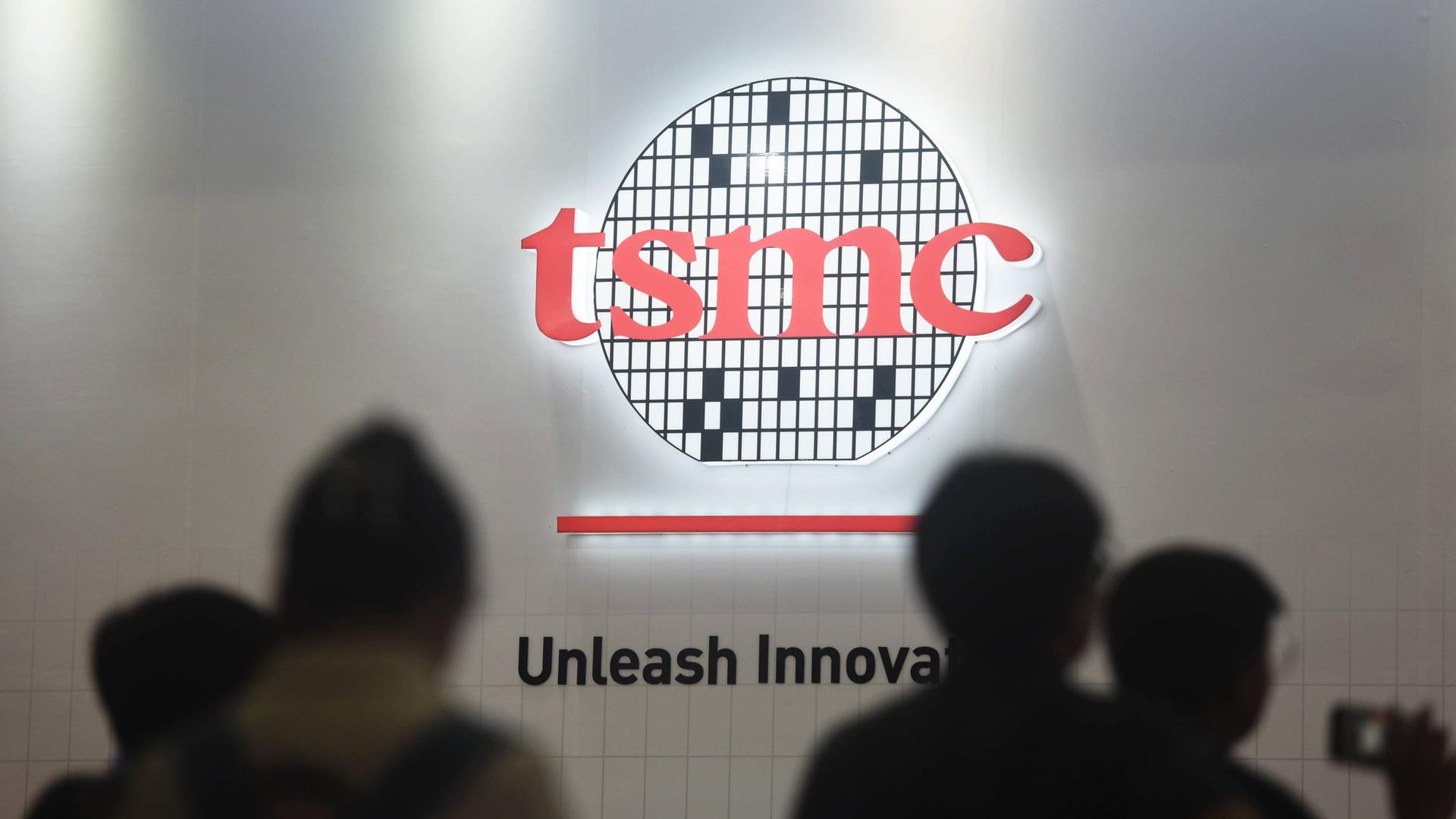
Dazu heißt es in der polnischen Zeitung GAZETA WYBORCZA aus Warschau: "In den letzten fünf Jahrzehnten war mit Blick auf die Geopolitik wichtig, wer über die größten Ölreserven verfügte. Für die nächsten Jahrzehnte wird entscheidend sein, wo sich Halbleiter-Fabriken befinden und wie die Lieferketten aussehen. Wer über Computer-Chips verfügt, hat die Macht. Das TSMC-Vorhaben soll Unterstützung von der Europäischen Union und der Bundesregierung erhalten. Auf diese Weise wollen die EU und Deutschland die Abhängigkeit von asiatischen Ländern verringern und Kapazitäten in der eigenen Region aufbauen. Außerdem wirbt die EU um Taiwan, da die Insel zunehmendem diplomatischen und militärischen Druck von Seiten Chinas ausgesetzt ist", vermerkt die GAZETA WYBORCZA.
Die japanische Zeitung NIHON KEIZAI SHIMBUN aus Tokio bemerkt in einem Gastkommentar: "Die Zahl der aus China exportierten Autos ist jüngst explosiv gestiegen, vor allem von elektrischen Wagen. Deshalb steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Europäische Union als Maßnahme den Import von chinesischen E-Autos regulieren wird. Auch wegen eines möglichen militärischen Vorfalls in Taiwan ist es eine logische Folge, dass TSMC in Europa einen Standort zur Herstellung von Chips für die Autoindustrie errichtet."
Die in Taipeh erscheinende Zeitung ZHONGGUO SHIBAO fragt: "Ist Taiwans technologische Überlegenheit in der Halbleiter-Branche und seine Schlüsselrolle bei der Lieferkette für Hochleistungsrechner tatsächlich ein Wettbewerbsvorteil, der das Land vor Chinas Aggression schützt und ihm seine Existenz sichert? Der Chef von TSMC hat erst vor einigen Tagen in einem Interview die Ansicht vertreten, dass dieses Argument allein keine Garantie dafür ist, dass Peking dauerhaft davon absehen wird, die Insel anzugreifen. Das psychologische Moment der Abschreckung wird seine Wirkung nur in Kombination mit einer schlagkräftigen Armee, die den Feind abwehren kann, entfalten können. Außerdem muss sich die Bevölkerung darüber im Klaren sein, dass die Bewahrung ihrer liberalen und demokratischen Lebensweise nicht billig zu haben ist, sondern einiges abverlangt", gibt ZHONGGUO SHIBAO aus Taiwan zu bedenken.
Themenwechsel. Die NEUE ZÜRCHER ZEITUNG aus der Schweiz geht ein auf die britische Regierung, die erste Asylbewerber auf einem Schiff vor der südenglischen Küste untergebracht hat: "Die Bilder von der 'Bibby Stockholm' richten sich in erster Linie an die Migranten in aller Welt: Die Fahrt über den Ärmelkanal ist zwar nur kurz, aber hier wartet nicht das Paradies, sondern ein gefängnisartiges Lastschiff in einem abgelegenen, trostlosen Hafenareal. Und ohnehin sollen die Migranten möglichst gleich nach der Ankunft nach Ruanda oder in eine britische Kronkolonie im Südatlantik verfrachtet werden. Der Wunsch, die Migranten nicht auch noch anzulocken, ist verständlich und sinnvoll. Wenn es sich um asylberechtigte Flüchtlinge handelt, ergibt eine Einreise nach Grossbritannien keinen Sinn, sie sind in Frankreich ebenso sicher. Und wenn es sich um nicht asylberechtigte Migranten auf der Suche nach einer besseren Zukunft handelt, hat Grossbritannien jedes Recht, sie abzuweisen", folgert die NZZ.
Die österreichische Zeitung DER STANDARD aus Wien äußert sich zu den Plänen, weitere solche Schiffe bereitzustellen: "Viele Hafenbehörden haben der Regierung schon die kalte Schulter gezeigt. Stattdessen werden die Asylbewerber weiterhin in teuren Hotels untergebracht, weil London seit Jahren nicht dazu fähig ist, adäquate günstigere Unterkünfte zu schaffen. Das ist Dilettantismus in Reinform und zeigt: Auch Populismus will gelernt sein."
Die französische Zeitung LES DERNIÈRES NOUVELLES D’ALSACE aus Straßburg äußert sich zur Lage im Niger: "Nachdem das Ultimatum, den gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum freizulassen, abgelaufen ist, hat die internationale afrikanische Gemeinschaft nur noch zwei Möglichkeiten: eine militärische Intervention anzuordnen, die ganz Westafrika ins Chaos stürzen würde, oder den Verlust ihrer ohnehin schon geringen Glaubwürdigkeit. Man droht einem Volk nicht ungestraft mit Aggression, jedenfalls nicht, ohne in der Lage zu sein, diese Logik zu Ende zu führen und die Konsequenzen zu tragen, die hier gigantisch wären. Die Lösung kann nur diplomatisch sein, da eine bewaffnete Intervention den Dschihadisten in die Hände spielen würde, die nur darauf warten, dass sich die Strukturen der Staaten zerrütten", mahnt LES DERNIÈRES NOUVELLES D’ALSACE.
Die dänische Zeitung POLITIKEN aus Kopenhagen stellt fest: "Es ist bereits der fünfte Putsch, seit die bettelarme Nation in der Sahelzone 1960 unabhängig wurde, und die 26 Millionen Einwohner haben um keinen einzigen davon gebeten. Vielmehr haben sie die Regierung von Präsident Bazoum demokratisch gewählt und ganz bestimmt nicht General Abdourahamane Tiani. Schlimmstenfalls droht ein Machtkampf wie weiter östlich im Sudan. Früher hätten sich die Supermächte positioniert, und das kann auch heute noch passieren. Die USA und die frühere Kolonialmacht Frankreich könnten die Putschisten mit Sanktionen wirtschaftlich unter Druck setzen. Aber auch eine solche Rivalität wie einst zwischen den Kolonialmächten ist nicht das, was Niger braucht", meint POLITIKEN.
Die arabische Zeitung AL QUDS AL-ARABY mit Sitz in London beobachtet: "Der Putsch in Niger bedeutet den Fall der letzten demokratischen Regierung in der Region. Inzwischen gibt es einen vom Sudan bis nach Mauretanien sich erstreckenden Gürtel von Ländern, die von Putschisten oder von aus Staatsstreichen hervorgegangen Regimes beherrscht werden. Dieser Umstand wird verstärkt zu Chaos, Unruhe und Instabilität führen, mit katastrophalen Auswirkungen auf die Bevölkerung dieser Länder, die ohnehin schon unter Armut und Hunger leiden", befürchtet AL QUDS AL-ARABY.
Nach Einschätzung der lettischen Zeitung DIENA aus Riga muss es darum gehen, eine Eskalation des Konflikts zu verhindern, denn: "auch die Militärjunta in Niger hat eine ganze Reihe von Unterstützern. Tschad hat bereits angekündigt, sich nicht an einer Intervention zu beteiligen. Das Land ist einer der wichtigsten französischen Stützpunkte in der Region, und die Behörden machen kein Geheimnis daraus, dass sie im Fall eines Krieges antifranzösische Proteste, Unruhen oder gar einen Putschversuch befürchten. Ein Krieg könnte also die Instabilität in mehreren Ländern verstärken, und es ist zu befürchten, dass er zu einem Blutvergießen, einem Flüchtlingsstrom in Richtung Europa und einem drastischen Rückgang des westlichen Einflusses in der Region führt", vermutet DIENA.
Nun noch ein Kommentar zur Kommunikationsstrategie der russischen Führung. Die norwegische Zeitung DAGBLADET aus Oslo führt aus: "Kreml-Sprecher Peskow steht in der ersten Reihe, wenn es darum geht, Putins faktenbefreite Propaganda zu verbreiten. Nun hat er in einem Interview mit der 'New York Times' erklärt, die Präsidentschaftswahlen in Russland seien eigentlich nicht demokratisch, sondern nur kostspielige Bürokratie, und Putin werde im nächsten März mit mehr als 90 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Später beteuerte er, falsch zitiert worden zu sein, ohne jedoch konkret zu sagen, was falsch zitiert sei. Aber wie dem auch sei: Er hat vollkommen recht. Wenn es in den nächsten Monaten nicht zu einem Putsch kommt, ist Putin bei den Wahlen aller Voraussicht nach der einzige Kandidat. Dass diese Wahl nicht der Ausdruck für irgendeine Art von Demokratie ist, wurde auch bei dem Urteil gegen Nawalny in der letzten Woche deutlich. Der Begriff 'kostspielige Bürokratie' ist eine interessante Neubildung, und ausnahmsweise trifft Peskow damit genau ins Schwarze." Und mit diesem Auszug aus DAGBLADET endet die internationale Presseschau.
