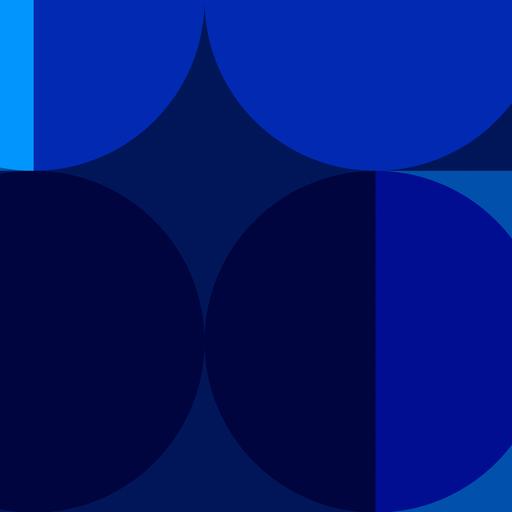Geboren am 24. Juli 1941 in Berlin, Prenzlauer Berg. Früh lesebegeistert und neugierig, bald einer, der etwas zu sagen hat. Ernst Elitz, der Journalist, präsent auf vielen Kanälen, als Zeitungsautor, als Radio- und als Fernsehmann. Gedruckt in "Zeit", "Spiegel" und andernorts, über den Äther gegangen per RIAS, ZDF und Süddeutschem Rundfunk. 1994 eine neue Aufgabe, Intendant der ersten Stunde beim frisch aus der Taufe gehobenen Deutschlandradio. Zwei Radioprogramme sollen nach der Wiedervereinigung deutschlandweit senden, Deutschlandradio Berlin und der Deutschlandfunk. Darin mit aufgegangen: Der Rundfunk im Amerikanischen Sektor, kurz RIAS, und der Deutschlandsender Kultur, ein Radiokind der unmittelbaren Wendezeit, Nachfolger des früheren DDR-Rundfunks. Eine Fusion gegen viele Widerstände, und dennoch eine Fusion von Dauer. Heute, 25 Jahre später, senden Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und das junge Programm Deutschlandfunk Nova weiter nach dem Grundsatz "bundesweit und werbefrei". Ernst Elitz, seit 2017 Ombudsmann bei der "Bild-Zeitung", und Birgit Wentzien, Chefredakteurin des Deutschlandfunks, blicken zurück.
Ernst Elitz: Und das ist dann auch sozusagen durch die Motivation des Ostens dazu gekommen, dass die Hebammen sich dann letztlich entschieden haben, das Deutschlandradio doch zu gründen.
Uneinige Geburtshelfer – das Jahr 1994 und folgende
Birgit Wentzien: "Ich glaube zu wissen, was mich erwartet, und ich hätte den Job nicht angenommen, wenn ich nicht überzeugt wäre, das zu bewältigen." Ein Originalton von Ihnen, Herr Elitz, nach der Wahl zum Intendanten des Deutschlandradio vor einem Vierteljahrhundert. Das klingt selbstbewusst, und das klingt sicher. Waren Sie beides, damals vor 25 Jahren?
Ernst Elitz: Ja, wir haben ja auch das erreicht, was wir erreichen wollten. Denn als ich in das Haus kam, hier in das Berliner Haus, da war ja ein großes Durcheinander, ein großes Tohuwabohu, weil die Kollegen aus Ostberlin hierhergekommen sind von DS-Kultur. Im Kölner Funkhaus gab es Sorgen und Ängste, dass der Deutschlandfunk aus Köln im Zuge des Trends nach Berlin vielleicht letztendlich doch aufgelöst würde. Also, es war schon eine sorgenvolle Stimmung. Aber es ist uns ja gelungen, die relativ schnell zu beseitigen. Denn nachdem das Deutschlandradio jetzt einen Intendanten hatte – am 8. März ist der gewählt worden –, konnte ja endlich mit dem Aufbau des Senders begonnen werden, des neuen Senders, des Deutschlandradios. Und in diesem Moment wussten die Leute auch, jetzt passiert etwas. Denn handlungsfähig in der Umsetzung des Gründungsstaatsvertrags der Bundesländer war ja tatsächlich nur ein Intendant, der den Sender aufbauen konnte, der neue Programme initiieren konnte, der einen Führungsstab berufen konnte, und der den Sender über den Erwerb von Frequenzen überall in Deutschland wirklich für die Hörer auch hörbar macht.
Wentzien: Wenn Sie an diese Zeit denken, an Ihre ja sehr kräftigen, sehr selbstbewussten und sicheren Worte, die ja auch wichtig waren, in beide Mannschaften an beiden Orten hinein, hat Sie irgendetwas überrascht?
Lange Verhandlungen über die Gründung des Deutschlandradios
Elitz: Dass die Sorgen so groß waren, und dass natürlich nach den langen Verhandlungen, die es gegeben hat über die Gründung des Deutschlandradios viele verunsichert waren. Denn ursprünglich wurde ja gesagt, Deutschlandfunk und der RIAS und erst recht DS-Kultur, die brauchen wir gar nicht mehr. Es gibt jetzt die Landesrundfunkanstalten, die Wiedervereinigung ist erreicht. Warum brauchen wir dann RIAS, und warum brauchen wir dann Deutschlandfunk. Das machen doch die Landesrundfunkanstalten. Die Bundesländer waren lange zerstritten, ARD und ZDF waren zerstritten. Das ZDF hätte sich den nationalen Hörfunk gern als Radiostandbein so als Anhängsel besorgt. Die ARD war überhaupt dagegen, dass es diese Konkurrenz gibt. Und da hilft natürlich dann ein Gründungsstaatsvertrag, das sind Paragrafen, das ist ein Konvolut von Paragrafen, auch nicht viel, um die Seelen zu beruhigen. Aber das lag eben an den vorausgehenden Querelen zwischen ARD und ZDF und zwischen den Bundesländern und dem Bund.
Wentzien: Auf all diese Anteilseigner kommen wir bitte, und zwar auch anhand eines Wortes vom Bundespräsidenten Joachim Gauck, der die Situation beschrieben hat in seiner Rede zur 20-Jahr-Feier von Deutschlandradio im März 2014. Gauck hat damals gesagt, es war keine leichte Geburt, es gab auch mächtig Streit unter den Hebammen. Jede hätte das Kind gern allein auf die Welt begleitet, und mindestens so bemerkenswert wie das Kind waren die Eltern. Es gab nämlich drei. Jetzt ist das ja eine biologische sagen wir mal Wundergeschichte. Fangen wir mal mit den Hebammen an. Herr Elitz, wer waren die Hebammen, die vielen?
Elitz: Die bilderreiche Sprache des Bundespräsidenten und Pastors Gauck ist mir jetzt nicht so geläufig.
Wentzien: Er meinte die Ministerpräsidenten.
"Da meinten eben manche, wir brauchen das gar nicht"
Elitz: Die Ministerpräsidenten. Es waren natürlich die Ministerpräsidenten und der Bund, denn die Bundesregierung war ja diejenige, die sowohl den Deutschlandfunk weitgehend finanzierte und den RIAS finanzierte. Und die Bundesregierung hatte immer das Allgemeine im Blick und hatte ganz Deutschland im Blick, während die Ministerpräsidenten natürlich zwangsläufig eher ihre Region im Blick hatten. Und da meinten eben manche in Bayern und in Baden-Württemberg, wir brauchen das da gar nicht, und dann noch Leute aus dem Osten, die dazukommen. Aber letztendlich konnte man auch durch den Druck, den die Bundesländer im Osten ausgeübt haben, zu dieser Vereinigung der drei Sender kommen, denn der Deutschlandfunk und der RIAS waren in der ehemaligen DDR eine große Nummer. Das haben die Leute gehört, und denen haben sie vertraut. Und das ist dann auch sozusagen durch die Motivation des Ostens dazu gekommen, dass die Hebammen in dieser Situation sich dann letztendlich entschieden haben, das Deutschlandradio doch zu gründen.
Wentzien: Wenn Sie mal auf die Ministerpräsidenten schauen, und wenn ich mir Ernst Elitz jetzt so vor dem geistigen Auge vor 25 Jahren vorstelle – waren Sie ein wandelnder Vermittlungsausschuss? Waren Sie eigentlich noch irgendwo anders als im Auto unterwegs? Sie müssen doch wahrscheinlich von Staatskanzlei zu Staatskanzlei gefahren sein?
Elitz: Ich bin sicher jede Woche in irgendeinem Bundesland gewesen, entweder in einer Staatskanzlei bei einem Ministerpräsidenten oder in den Parlamenten in den entsprechenden Ausschüssen und in den Fraktionen. Denn mit dem Gründungsstaatsvertrag war das Deutschlandradio in dem Sinne, in der jetzigen Form, wie wir es haben, noch nicht gegründet. Denn Deutschlandradio war gedacht als ein Anhängsel von ARD und ZDF. Die Finanzierung sollte über ARD und ZDF kommen. Und nach dem Streit, den es da vorher gegeben hat, konnte ich mir nicht vorstellen, dass das klappen kann. Also, um eigenständig zu werden, musste Deutschlandradio die Ministerpräsidenten dazu bringen, dass wir einen eigenen Gebührenanteil haben. Das war sozusagen der erste Schritt. Das dauerte fünf Jahre, das war quasi meine Aufgabe in der ersten Amtszeit, das hinzukriegen. Und seitdem hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk ja auch in all seinen öffentlichen Bekundungen immer drei Säulen, das ist ARD, ZDF und Deutschlandradio. Das ist sozusagen meine erste Amtsperiode gewesen, diese Eigenständigkeit des Deutschlandradios hinzukriegen.

Wentzien: Zwei kleine Schnurren, wenn Sie gestatten. Sie haben mir versprochen, dass wir auch Schnurren hier präsentieren. Der Zeitzeuge Ernst Elitz ist zu Gast, wir freuen uns sehr. Ihr Fahrer hat mit Ihnen ja einiges erlebt bei diesem ganzen Tohuwabohu unterwegs. Und ein platter Reifen hat Sie auch nicht weiter gestört, habe ich gehört. Sie fuhren dann einfach weiter, oder ließen sich weiter fahren.
"Ein Intendant ist auch Psychotherapeut für den Politiker"
Elitz: Ja, das ist wie beim Deutschlandradio. Man kann sich ja durch kleine Unfälle nicht irgendwie beeinträchtigen lassen.
Wentzien: Und gab es irgendwann mal, unabhängig von dem platten Reifen, einen Moment in dieser Zeit, Herr Elitz, wo Sie gedacht haben, Himmel, ich bin hier, ich weiß, was ich kann, ich bin selbstbewusst und sicher, aber so sagen wir mal schnurrig habe ich mir das auch nicht vorgestellt? Gab es irgendwann mal einen Moment, wo Sie dachten, ist doch ein Stückchen wuchtiger, als ich dachte?
Elitz: Nein, das gab es eigentlich nicht. Man ist dann ja da schnell reingekommen und wusste dann, was auf einen zukommt. Also, solche Situationen eigentlich nicht. Es gab ja, da Sie vom Auto geredet haben, manchmal eben amüsante Situationen, dass das Autotelefon klingelt, und dann ist ein Ministerpräsident dran, der unbedingt mit mir sprechen will, weil er sich in einem Interview in den Interviews am Morgen nicht richtig behandelt gefühlt hat. Oder ein anderes Mal, dass da immer sein Widerpart in der eigenen Partei so häufig zu Wort kommt. Na ja, gut, dann ist ein Intendant Psychotherapeut auch für den Politiker. Aber er sagt das natürlich nicht dem Redakteur oder dem Reporter, der davon betroffen ist, sondern es ist die Sache des Hörfunkrats, Beschwerden gegen das Programm entgegenzunehmen. Ein Intendant hört sich das nett an und spricht dem Politiker Mut zu. Und solche Situationen hat es eben auch gegeben.
Elitz: Als ich hier das Intendantenbüro in Berlin bezog, da war das ja noch so möbliert wie von dem amerikanischen Besatzungsoffizier.
Zwei Häuser mit Geschichte. Kalte Krieger, Stasi, RAF.
Wentzien: Sie kamen 1994 in Berlin als Intendant in ein Haus, das Sie ja bereits kannten aus Ihrer Zeit als Redakteur des RIAS in den 60er-Jahren. Nur, die Situation damals, 1994, war ja eine vollkommen andere. Wenn wir uns da noch mal versuchen hineinzuversetzen, wie muss ich mir das vorstellen? Hier arbeiteten oder sollten arbeiten Journalisten und Journalistinnen zusammen, die einander vorher spinnefeind gewesen waren, die sich auch gegenseitig der Agitation bezichtigt hatten. Und daraus sollten von jetzt auf nachher Kollegen werden. Das geht nicht von jetzt auf nachher. Was war das hier in Berlin für eine Stimmung?
Elitz: Es gab ja hier in Berlin, als ich herkam, zwei Programme, eins vormittags und eins nachmittags.
Wentzien: Also die Weltenblende noch zwischendrin.
Elitz: Es war noch die Blende dazwischen. Wie gesagt, es konnte ja vorher keiner entscheiden. Die Ministerpräsidenten konnten ja nicht sagen, wie jetzt ein Programm aussieht. Dieses ganze Konvolut von Aufgaben hatte man eben auf den Intendantenschreibtisch geladen. Und da war es ganz wichtig, ein Programm erst mal zu etablieren, in dem die Mitarbeiter der beiden Ursprungsprogramme, also des RIAS und von DS-Kultur beteiligt waren. Und dann ist es ganz simpel der Arbeitsdruck gewesen, der die Leute dazu gebracht hat, miteinander zu kommunizieren. Wenn ich eine gemeinsame Aufgabe habe, wenn ich sage, wir müssen gemeinsam ein Programm aufstellen, wir müssen das entwickeln. Wie soll das aussehen, wer macht das? Welche Programmformate gibt das? Wie sprechen wir die Hörer am besten an? Mit einer solchen Aufgabe sind alle dann so befasst, und es bestand ja auch Druck, es musste ja schnell gehen. Da konnte man sich nicht viel zum Integrieren irgendwo zurückziehen, sondern da musste man gemeinsam anpacken. Und diese gemeinsame Aufgabe, das hat dazu geführt, dass die Mitarbeiter dann doch sehr schnell zusammengewachsen sind und ja dann, wie man ja bis heute sieht – die Ursprünge sind ja damals gewesen –, ein Programm auf die Beine gestellt haben, das in der Öffentlichkeit auch großen Anklang findet.
Wentzien: Sie mussten entlassen. Es waren mehr Menschen da, also vonnöten waren.
"Gemeinsam kreativ sein, ist letztendlich die beste Medizin"
Elitz: Ja, 980 gab es noch, und da mussten wir runter auf 710. Das war natürlich ein schwerer Einschnitt, denn das ging nach Alter, und nicht, welche Qualifikationen brauchen wir jetzt. Es ist manchmal schwer, einen Mitarbeiter der Finanzabteilung als Moderator einzusetzen, und umgekehrt. Wir mussten das vollkommen neu sortieren. Das waren auch schwere Belastungen für die Mitarbeiter. Aber es ist letztendlich dann auch immer der Erfolg gewesen, der Zuspruch, den das Programm von außen gefunden hat. Und auch die Tatsache, dass die Mitarbeiter gesehen haben, wir haben jetzt noch eine neue Ausstrahlungsmöglichkeit im Norden Deutschlands, im Süden. Wir werden jetzt mehr gehört, wir haben eine positive Resonanz bei unseren Gesprächspartnern und in den Medien. Und das hat dann das Selbstbewusstsein gestärkt.
Wentzien: Ich habe zwei Zitate mitgebracht, von einer Kollegin und einem Kollegen aus der Zeit damals. Das erste stammt von Monika Künzel, die damalige Chefredakteurin von DS-Kultur. Und das zweite ist von Ulf Dammann, damals Redakteur beim RIAS. Frau Künzel sagt über diese Zeit: "Es war eine Stunde der Anarchie, unter deren Deckmantel sich Gutes und Schlechtes verbarg und Extreme in beide Richtungen ermutigte. Eine Stunde der Freiheit." Und der Kollege Dammann sagt: Es gab eine tiefe Spaltung auch, und es gab auch diejenigen, die sagten, wir stellen was Neues auf die Beine. Von jetzt aus betrachtet sind es zwei Programme in Berlin und in Köln. Aber sagen wir mal, der Prozess, bis es so weit war, der war sicherlich auch ein zwischenmenschlich schwieriger. Mir haben hier Kolleginnen und Kollegen auch geschildert, sie sind ins Haus gekommen, und man hat sich morgens gegrüßt und abends, und das war es auch. Also, es gab auch eine Phase der ganz schwierigen Zusammenfindung. Meinen Sie, man kann aus dieser Zeit noch etwas lernen oder für die Zeit heute noch mal sich vergegenwärtigen?
Elitz: Gemeinsam kreativ sein, ist letztendlich die beste Medizin. Und die Mitarbeiter waren jetzt gehalten, sie müssen kreativ sein. Denn es gab eben immer noch diese Unsicherheiten. Wenn es jetzt mit dem Personalabbau nicht geklappt hätte, wenn es irgendwelche größeren Probleme gegeben hätte, dann war da immer noch das Fallbeil, dass gesagt wird, dann lassen wir das doch mit diesem Deutschlandradio. Aber das konnte man eben durch die gemeinsame Arbeit und durch die Kreativität überwinden. Und dann ist man sich ja einander nahe gekommen. Auch in großen Funkhäusern begrüßt man sich morgens und verabschiedet sich abends und sieht sich vielleicht in der Kantine, aber hat auch seinen speziellen Tisch. Das mag jetzt keine Besonderheit des Deutschlandradio gewesen sein.
Wentzien: Das ist Berlin. Und jetzt müssen wir noch nach Köln gucken. Sie haben es angedeutet, der Deutschlandfunk in Köln – eigentlich war mit dem Mauerfall auch der Sendeauftrag gefallen.
"Im Foyer stand noch der Störsender"
Elitz: Beim RIAS wäre es ja ähnlich gewesen.
Wentzien: Genau. Wie war die Stimmung in Köln?
Elitz: Die war etwas betrübt. Die hatten ja schon lange keinen Intendanten mehr, haben alle so vor sich hin gewurschtelt, aber ein gutes Programm gemacht. Aber das war noch etwas altväterlich. Und es kam ja darauf an, dass wir Personen finden an der Spitze der Programme, Programmdirektoren, die erfahrene Journalisten sind, die einfallsreich sind und die die Mitarbeiter auch auf Neues einstimmen können. Das war also auch ganz wichtig bei der Auswahl der Programmdirektoren, die ich dann einstellen konnte.
Wentzien: Sie haben damals sehr schnell Redakteure entsandt in die damals neuen Länder. Das sind die Inlandskorrespondenten, die jetzt da sind, die Botschafter quasi, die in den Bundesländern unterwegs sind. Und Sie hatten, Herr Elitz, müssen wir bitte ansprechen, auch mit der Staatssicherheit zu tun, die natürlich in einem Nervenzentrum wie dem Deutschlandfunk im Westen zugange gewesen war. Wie haben Sie das geschafft damals?
Elitz: Die Korrespondentenstellen in den Ländern waren ganz wichtig, denn der Auftrag des Deutschlandradios war und ist ja, die Vielfalt in ganz Deutschland widerzuspiegeln und als nationaler Hörfunk oder als Radio der deutschen Länder mussten wir natürlich auch unsere Korrespondenten dort haben, dort auch Veranstaltungen haben, dort auch Kulturveranstaltungen machen, das war ganz selbstverständlich. Ich wurde, als ich in dieses Haus kam, auch immer mit der deutschen Vergangenheit konfrontiert. Als ich hier das Intendantenbüro in Berlin bezog, da war das ja noch so möbliert wie von dem amerikanischen Besatzungsoffizier, der in den 40er- und in den 50er-Jahren und dann bis in die 60er-Jahre hinein immer noch die Oberaufsicht über den Sender hatte, mit einem Schreibtisch und mit Ledersesseln und Ledersofa aus dieser Zeit. Und unten im Funkhaus, im Foyer, stand noch der Störsender, mit dem die RIAS-Programme in der Ostzone und dann später in der DDR gestört wurden. Es war noch diese historische Atmosphäre. Hier beim RIAS gab es keine Stasi-Einflüsse, wie dann die Untersuchungen gezeigt haben. Das mag auch daran gelegen haben, ich bin ja früher auch beim RIAS gewesen, als Student habe ich ja schon hier gearbeitet und dann auch kurz noch als Redakteur. Wer zum RIAS kam, wurde vorher vom amerikanischen Geheimdienst abgecheckt. Und das führte möglicherweise dazu, dass die Stasi hier keinen Einfluss nehmen konnte.
"In Köln war noch der Notknopf zur Polizei"
In Köln, als ich dort das Intendantenbüro betrat, da war immer noch die Klingel unten am Knopf, die führende Vertreter der Bundesregierung hatten, die dort installiert worden waren zur Zeit der RAF, weil es da ja viele Angriffe gegeben hat. Das war sozusagen noch der Notknopf zur Polizei. Das war also schon mal deutsche Vergangenheit, die einem dort in beiden Sendern begegnete. Im Deutschlandfunk hatte die Stasi also sicher von Markus Wolf, von der Hauptverwaltung Aufklärung her, den Betriebsratsvorsitzenden, der natürlich Zugang hatte zu allen Akten des Hauses, und dann noch einen Korrespondenten in Brüssel. Ich hatte mal in meiner Fernsehzeit ein längeres Gespräch mit Markus Wolf, und da sind wir noch durch Berlin gefahren. Er hat mir noch die geheimen Grenzübergänge der Stasi gezeigt und so. Da hat er mir noch nicht gesagt, aber da wusste er auch noch nicht, dass ich Deutschlandradio-Intendant werde, welchen Einfluss sie hier hatten. Hinterher hat mir mal jemand, der bei dem Feliks Dzierżyński, bei dem Stasi-Wachregiment war und dann in der DDR in den Journalismus übergegangen ist, der hat mir mal später gesagt: Wenn es anders gekommen wäre und wir hätten den Deutschlandfunk in Köln besetzt – war natürlich ein Hauptziel, weil er national ausstrahlte –, wir hätten gewusst, hinter welcher Tür Sie sitzen. Denn die hatten die gesamten Lagepläne des Hauses und wussten natürlich, wer wo sitzt. Aber diese Fälle waren schon, bevor ich mein Amt übernommen hatte, glücklicherweise geklärt.
Wentzien: Die Westseite der Staatssicherheit, der Notknopf unterm Schreibtisch und die amerikanische Einrichtung hier im Haus in Berlin, die haben Sie dann rausgeschmissen wahrscheinlich, oder haben sich eigene Möbel geholt?
Elitz: Nein. Ich bin ja ein Freund der Geschichte, und man muss eigentlich immer – ich hab die bis zum Schluss gehabt, weil ich das eben interessant fand, dass dieses Haus eine Geschichte hat. Dass das nicht irgendein Sender ist, den man mal schnell etabliert und wo man Sendungen macht, sondern dass das Geschichte atmet. Und deshalb war mir das immer wichtig.
Elitz: Die gesellschaftliche Aufgabe der Medien ist eben, jedem Menschen seinem Bildungs- und Interessenstand entsprechend die Welt zu erklären, um es mal so ganz simpel zu sagen. Und das war für mich immer ein pädagogischer Impetus.
Ein früher Zeitungsleser, der Journalist Ernst Elitz.
Wentzien: Ihre Mutter hat Ihnen Geschichten erzählt, aus ihrem Leben im Prenzlauer Berg und von Ihrem Vater, dem, Zitat, "draufgängerischen Mann aus dem Mecklenburgischen", dem bekennenden Kommunisten, der aus dem Krieg nicht mehr zurückkam. Sie haben ihn selbst nicht kennengelernt?
Elitz: Ich habe nur ganz knappe Erinnerungen an die Kindheit.
Wentzien: In einem sehr persönlichen Brief, Herr Elitz, an Ihre Mutter, erinnern Sie auch an die Kriegssituation in Berlin. Lebensgefährlich, aber Sie haben in diesem Brief geschrieben an Ihre Mutter, immer ohne Angst, weil an ihrer Seite. Und Sie sagen auch, ich weiß bis heute nicht, was dir, also Ihrer Mutter diese Ruhe gegeben hat. Und Sie schreiben in dem Brief, Sie, also Ernst Elitz, seien eine unerträgliche Nervensäge gewesen, sodass Ihre Mutter eines Tages dann sagte, jetzt lerne endlich selber lesen. Und ein halbes Jahr nach Schulbeginn war es so weit, Sie konnten selbst lesen, Sie haben nicht mehr ganze U-Bahn-Waggons, wo Sie mit Ihrer Mutter unterwegs waren, unterhalten, sondern Sie steckten Ihren Kopf selbst hinter eine Zeitung. Sie lächeln und sagen nichts und fallen mir nicht ins Wort, von daher ist es im Moment noch realistisch beschrieben.
Elitz: Ja, das ist realistisch. Ich habe von meiner Mutter immer verlangt, dass sie mir vorliest, und das ging ihr natürlich – sie hatte ja noch mehr zu tun – etwas auf die Nerven. Sie hat gesagt, jetzt komm in die Schule, lern endlich selber lesen. Bin ich mit einer klaren Ambition in die Schule gegangen und habe dann auch lesen gelernt und bin dann relativ schnell zur Zeitung gekommen. Irgendwie hat mich das fasziniert, dass da jeden Tag was Neues auf dem Tisch lag. Ich habe das nicht verstanden, aber da waren auch noch Bilder drin. Insoweit fand ich Zeitung ganz faszinierend und habe dann relativ früh beschlossen, Journalist zu werden.
Wentzien: Im Zeitraffer – wir haben auch einige Stationen schon gehört. Danach würde ich jetzt gern bis zum Studium gehen. Und dann übergebe ich an Sie, bitte, damit wir alle beruflichen Stationen auch haben. Also, im Zeitraffer: Geburt Prenzlauer Berg, aufgewachsen im geteilten Berlin, zu Hause an der Seite Ihrer Mutter. Dort auch Abi gemacht, und das haben Sie im Westen dann noch mal gemacht. Und studiert an der Freien Universität, nämlich in Berlin, Germanistik, Theaterwissenschaften, Politik, Philosophie. Und damals begann Ihr Doppelleben als Student und als Journalist. Und Sie waren eigentlich im Vorfeld, im Glacis der Achtundsechziger. Eine unruhige Zeit.
"Das geteilte Berlin hat mich sicher stark geprägt"
Elitz: Ja, zur Zeit der Achtundsechziger. Ich habe als Student, quasi ab meinem zweiten Semester angefangen, für Zeitungen zu schreiben, und bin dann Chefredakteur der Deutschen Studentenzeitung gewesen, "FU-Spiegel", und habe dann auch über die Situation der Achtundsechziger-Entwicklung für die "Zeit", für andere Blätter geschrieben. Das Studium war ja damals noch nicht so reglementiert. Man ist hingekommen, hat studiert, und irgendwann hat man sich gesagt, wenn deine Eltern dich schon studieren lassen, dann machst du auch Examen. Da gab es ja nicht diese ewige Prüferei, sondern man konnte selbst entscheiden. Das hat (mir) eben die Möglichkeit gegeben, dass ich schon jahrelang journalistisch gearbeitet hatte, als ich dann mein Examen gemacht habe.
Das geteilte Berlin hat mich sicher stark geprägt. Das geteilte Berlin war, damals gab es ja keine Mauer, da war das ja eine Stadt. Man fuhr mit der U-Bahn rüber, und man war jeden Tag, egal, wo man gewohnt hat, auch in einem anderen Stadtteil, weil man Verwandte, Bekannte hatte, weil man dort ins Kino gegangen ist und ins Theater gegangen ist. Aber jede Seite vertrat eben die Position, der Osten und der Westen, wir sind die, die recht haben. Das entnahm man ja auch den Medien, zwischen dem "Neuen Deutschland" und dem RIAS, um mal diese beiden Bestandteile der Medienlandschaft zu nehmen. Und das führt doch zu einer gewissen Skepsis gegenüber solchen Behauptungen, ich habe immer recht. Und diese Skepsis, die zu einem Journalisten gehört, glaube ich, ist bei mir besonders stark ausgeprägt worden durch diese Rechthaberei auf beiden Seiten, die einem im Westen der Stadt begegnete.
Und dann in der 68er-Zeit kamen ja noch mal Verbände, Positionen, Rudi Dutschke oder wer auch immer, die auch immer behaupteten, sie haben recht. Und da war die Skepsis schon hinreichend bei mir ausgeprägt, dass ich das von außen kritisch beobachten konnte. Und wir haben damals hier in diesem Hause, wo wir jetzt gerade diese Aufnahme machen, beim RIAS in Berlin, ausführlich über die Studentenbewegung mit Live-Sendungen berichtet. Und interessanterweise ist uns von keiner Seite der Vorwurf gemacht worden, dass wir antistudentisch sind oder dass wir pro-links sind, sondern es ist offenbar immer gelungen, eine Positionierung zu finden der journalistischen Unabhängigkeit, die von allen akzeptiert wurde. Und da kann man eigentlich sich heute noch wundern, dass das gelungen in diesen aufgehetzten Zeiten. Aber es ist uns gelungen.
Wentzien: Die beruflichen Stationen – ich fange mal an, und Sie übernehmen bitte. RIAS, "Zeit" …
Elitz: Ja, die "Zeit" als freier Mitarbeiter.
Wentzien: Genau. Dort für Hochschule, und dann beim "Spiegel".
"Die Kenntnis beider Seiten war sicher eine Voraussetzung"
Elitz: Beim "Spiegel" war ich für Hochschul- und Wissenschaftspolitik zuständig, habe in dieser Zeit auch sehr interessante "Spiegel"-Gespräche gemacht, mit Adorno kurz vor seinem Tod über die Studentenbewegung, mit Georg Picht, der schon damals die Bildungskatastrophe vorausgesagt hat. Das war eine sehr interessante Zeit, die mich mit diesem Bereich in Verbindung gebracht hat. Und vom "Spiegel" bin ich zum ZDF gegangen, bei der Sendung "Kennzeichen D", die sich mit beiden deutschen Staaten beschäftigt hat. Das hat noch mal meine Kenntnisse über die DDR intensiviert, weil ich dann gelegentlich auch als Korrespondent in der DDR tätig sein konnte. Hat man eben auch gemerkt, wie die Stasi da hinter einem hinterher ist. Und dann "Heute-Journal" und beim Süddeutschen Rundfunk in Stuttgart also als ARD-"Tagesthemen"-Kommentator oder die Sendung "Pro & Contra", die damals ein größerer Hit war, weil wir das erste Mal die Hörerinnen oder die Zuschauer und Zuschauerinnen über ein Teledialogsystem sowohl über das Thema der Sendung entscheiden lassen konnten wie dann auch ihre Beurteilung der Diskutanten, die wir im Studio hatten.
Wentzien: Joachim Braun, der Kollege vom ZDF, hat Sie im Nachgang beurteilt, Herr Elitz, und er hat gesagt, Sie seien der Stationsvorsteher des Deutschlandradio, auf zwei Bahnhöfen sozusagen, und Sie hätten aus der Zeit heraus, die Sie gerade schildern und andeuten, nämlich dieses journalistische Berichten und auch Vermitteln. Sie waren damals ein Dolmetscher von Deutsch zu Deutsch, was ja eine, glaube ich, Charakteristik ist, die auch für die Intendantenaufgabe wesentlich war.
Elitz: Ja, das spielte sicher auch eine Rolle bei der Entscheidung, mich zum Intendanten zu wählen, weil ich sowohl die bundesdeutsche Politik als Journalist verfolgt hatte und wusste, wie dort Entscheidungsprozesse laufen, und dass ich dann gerade über "Kennzeichen D" und auch über meine Erfahrungen, die ich im geteilten Berlin hatte, auch eine Sensibilität für die DDR, auch für die DDR-Bürger hatte. Und weil ich auch die Politik der DDR beurteilen konnte, sozusagen als Fachmann. Und diese Politik der DDR hat ja dann auch zu Folgerungen auch noch in den Köpfen der Menschen geführt, nach der Wiedervereinigung. Und insofern war diese Kenntnis beider Seiten sicher eine Voraussetzung, dass ich, wie Sie es jetzt hier sagen, dolmetschen konnte zwischen den unterschiedlichen Mitarbeiterstämmen, die in dieses Haus gekommen sind.
Wentzien: Ich habe in den Untiefen des Archivs drei Titel für Sie herausgeschöpft und will Sie Ihnen ganz kurz vorstellen. Der eine Titel lautet "Ernst Elitz, das Arbeitstier". Er stammt von Dagmar Reim, der damaligen Intendantin des Rundfunk Berlin-Brandenburg. Der zweite Titel lautet "Der alte Fuchs". Das hat damals Jürgen Dütz gesagt, zu Ihnen, über Sie, zum Abschied aus dem Amt, damals Präsident der privaten Rundfunk- und Telekommunikation. Und das Dritte: "Der Götterbote". Das stammt von der Autorin Silke Burmester in der Tageszeitung "TAZ". Arbeitstier, alter Fuchs, Götterbote. Passt irgendein Titel?
"Aufgabe der Medien ist eben, die Welt zu erklären"
Elitz: Ja, das ist sozusagen die Beschreibung, die man als Intendant eigentlich haben muss.
Wentzien: 2014 wurden Sie Kommentator der "Bild"-Zeitung. Kurze Sätze, klare Meinung, kein Rumeiern, sagten Sie damals selbst. Nicht alle haben Ihre Wahl dieses Mediums nachvollzogen, auch nicht, als Sie 2017 Ombudsmann der "Bild" wurden, als zentraler Ansprechpartner dort, was Sie ja immer noch sind ja, für Leserbeschwerden. Was entgegnen Sie denen, die Stirnfalten haben?
Elitz: Da kann ich vielleicht auch wieder in die Geschichte der Deutschlandradio-Erinnerungen greifen. Man wurde ja dann als Deutschlandradio-Intendant häufig eingeladen zu Foren, medienpolitischen Veranstaltungen. Und dann traten einem immer die begeisterten Hörer gegenüber und sagten, alle Sender müssten doch so sein wie das Deutschlandradio. Und dann waren die immer ganz erstaunt, wenn ich gesagt habe, wenn alle Sender so wären wie das Deutschlandradio, dann würden die Medien und die Journalisten ihrer Aufgabe nicht gerecht werden. Denn es ist natürlich ein Privileg, im Deutschlandradio als Redakteur zu Menschen zu sprechen, die einen ähnlichen Bildungshintergrund haben. Und der Journalismus wird da etwas schwieriger, wenn ich den weitgespannten Auftrag der Medien und des Journalismus nehme, nämlich Menschen unterschiedlichen Bildungsstands, unterschiedlicher Auffassungsgabe, unterschiedlichen politischen Interesses, unterschiedlichen Interesses für Politik und Information überhaupt anzusprechen. Und das hat die Leute dann immer zum Erstaunen gebracht, hoffentlich auch etwas zum Nachdenken. Denn die Aufgabe der Medien, die gesellschaftliche Aufgabe der Medien ist eben, jedem Menschen seinem Bildungs- und Interessenstand entsprechend die Welt zu erklären, um es mal so ganz simpel zu sagen. Das war für mich immer ein pädagogischer Impetus, und insoweit wunderte ich mich, dass aufgeklärte Menschen sich darüber wundern, dass man auch andere Milieus ansprechen muss als Journalist.
Wentzien: Auf den Punkt der Selbstreferentialität kommen wir gleich. Lassen Sie uns ganz kurz bei der "Bild"-Zeitung bleiben. Wie muss ich mir das vorstellen? Sie haben da eine Kemenate wahrscheinlich mit neuzeitlicher Einrichtung, keinen Knopf unterm Schreibtisch.
Elitz: Kein Ami-Sofa …
Wentzien: Kein Ami-Sofa, genau. Wie gehen die Redakteurinnen und die Redakteure und der Chefredakteur mit Ihrer Kritik um? Weil Sie transportieren ja das Echo der Leserinnen und Leser und User in die Redaktion. Und da gibt es ja manchmal auch was zu kritisieren. Wird das angenommen?
"Als Journalist muss man über den Zinnen der Partei stehen"
Elitz: Der Chefredakteur hat mich ja berufen. Es war ja nicht meine Idee, sondern es war ja eine Idee, die mich am Telefon eines Morgens beim Frühstück erreichte, dass man einen Ombudsmann einrichten will, und dass ich doch gebeten bin, diese Funktion zu übernehmen. Diese Transparenz, der ja inzwischen alle Medien gegenüberstehen – sie können nicht in ihrem eigenen Kämmerlein vor sich hin arbeiten, sondern sie müssen begründen, was sie schreiben, sie müssen deutlich machen, dass ihre Quellen sicher sind. Das ist gerade im Zeitalter der ständigen Vorwürfe, "Lügenmedien" und "Fake News", eine ganz wichtige Aufgabe für die Medien. Da ist die "Bild"-Zeitung in dem Sinne vorangegangen, dass sie einen Ombudsmann berufen hat, der eben auch öffentlich auftritt, der auch Kolumnen im eigenen Blatt veröffentlicht, der auch mit Lesern vor Ort spricht. Wenn die Redakteure vor Ort gehen zu Leserstammtischen, dann ist auch der Ombudsmann dabei. Und die Leute, die Leser weisen auf Fehler hin, die sie im Blatt finden. Und dann gehe ich damit in die Redaktion, kläre mit denen – manchmal hat der Leser auch nicht recht, muss man auch sagen. Es ist nicht so, dass der Leser und der Hörer immer recht hat, sondern man muss dann als Ombudsmann immer klären, was sind die Fakten. Und dann veröffentliche ich das im Blatt und auch online, wenn Fehler passiert sind. Die Redaktion entschuldigt sich online, wenn Texte erschienen sind, die Fehler enthalten. Das ist ja der Vorteil des Onlinemediums, dann kann man diese Fehler dort auch korrigieren.
Wentzien: Die Medienjournalistin Ulrike Simon sagt, Sie seien der Seelenreiniger der "Bild". Ist das ein Titel, der passt?
Elitz: Vielleicht ist Frau Simon Psychotherapeutin, deshalb kann ich damit nicht viel anfangen.
Wentzien: Dann noch, bitte, denn die Frage an das SPD-Mitglied seit und mit Willy Brandt, Ernst Elitz – über den Zinnen der Partei, hieß es in einem Artikel über Sie, als Sie aus Stuttgart gingen und Intendant des Deutschlandradio wurden und alles andere, bloß nicht aufhörten zu arbeiten. Sie sind Schriftsteller, Hochschullehrer, Autor, Medienberater. Sie haben vorhin die Geschichte der Ministerpräsidenten-Einzelbeatmung und/oder der Politiker erwähnt. Hat die SPD Sie eigentlich immer in Ruhe gelassen, oder haben die auch mal angerufen?
Elitz: Alle haben sicher irgendwann mal angerufen. Aber mein Verhältnis zu Anrufen von Politikern, glaube ich, habe ich vorhin schon mal geschildert. Also, über den Zinnen der Partei muss man stehen als Journalist. Das gilt jetzt nicht nur für Intendanten, das gilt für jeden Journalisten. Man ist nicht der Wasserträger von Politikern, sondern man vertritt seine eigene Position. Ich halte es auch immer für sinnlos, wenn gesagt wird, Journalisten dürfen keiner Partei angehören. Journalisten gehen wählen. Sie müssen sich in der Wahlkabine für irgendein Programm entscheiden, und dann können sie natürlich auch Mitglied einer Partei sein. Bloß, das darf man nicht dem Programm anhören. Und das, glaube ich, ist uns beim Deutschlandradio auch gut gelungen. Der Deutschlandfunk, am Anfang, galt ja aufgrund seiner Entstehung – er war ja ursprünglich mal als ein Regierungssender geplant gewesen in den 60er- und 70er-Jahren –, er hat dieses Image ganz schnell abgelegt und wird allgemein als ein total unabhängiger Sender angesehen, der alle Politiker kritisch angeht, der sie sich vorknöpft. Das macht der Deutschlandfunk heute, das macht auch das Deutschlandradio Kultur. Das muss die Aufgabe eines Journalisten sein, über den Zinnen der Parteien zu stehen.
Elitz: Man muss schon urteilen. Aber bevor man verurteilt, soll man sich das sehr genau überlegen.
Kommunizieren statt bloßes Senden.
Wentzien: Jay Rosen, der amerikanische Journalismus-Professor aus New York war einige Zeit in Deutschland und hat die Medien beobachtet. Es ist immer so, wenn jemand von außen drauf guckt, sieht man mehr. Und Rosen kommt zu mehreren Schlüssen, und mit denen möchte ich gern Sie konfrontieren, weil ich weiß, dass Sie an der Stelle auch medienphilosophisch oder medienethisch für uns ein wichtiger Auskunftspartner bitte sind. Rosen sagt: Wenn das Vertrauen der Öffentlichkeit in Parteien sinkt, dann sinkt auch das Vertrauen in die Medien. Und Journalisten, die Politik nur als Machtkampf abbilden, drohen die Alltagssorgen der Menschen zu vergessen. Und das letzte und sehr aktuelle aufgrund des Falls des Kollegen Relotius beim "Spiegel": Eine gute Geschichte, eine auch zum Teil erfundene Geschichte wird wichtiger als die Pflicht, zu sagen, was ist. Herr Elitz, was hilft aus Ihrer Sicht gegen diese drei Medienbeobachtungen? Welche Konsequenzen müssen Medien heutzutage ziehen?
Elitz: Der Hörer ist nicht nur der Rezipient – ein grässliches Wort –, sondern der Hörer gestaltet mit. Brechts Radiotheorie ging schon davon aus. Der Hörer ist Lieferant. Ich muss die großen Debatten mit den Ideen des Hörers zusammen gestalten. Das Radio ist ein Kommunikationsapparat, nicht nur ein Sender. Also ganz alte Theorie schon von Berthold Brecht. Auf die Hörer zugehen, die Hörer beteiligen. Das machen ja auch Zeitungen durch Foren inzwischen. Das ist fürs Radio und fürs Fernsehen natürlich etwas leichter. Man kann die Hörer auch ins Studio setzen. Das, was jetzt hier gemacht wird mit der "Denkfabrik" des Deutschlandradios, mit den Äußerungen "Unser Grundgesetz, mein Grundgesetz" – die Hörer einbinden, das ist ganz wichtig, dass die Hörer sich ernst genommen fühlen. Und sie wissen manchmal mehr als mancher Experte, den man einlädt. Auf der anderen Seite, was zu dem Fall Relotius geführt hat: Da wird von der literarischen Reportage, die dann immer ausgezeichnet worden ist, gesprochen. Das ist ein Unding. Journalismus und Literatur sind ganz was anderes. Literatur denkt sich was aus. Das kann sehr schön sein, das kann auch wirklichkeitsnah sein. Aber Journalismus bildet ab, was ist. Und insoweit ist der Begriff der literarischen Reportage schon ein Unding und hat mit zu diesen Überlegungen geführt. Schönschreiben. Ich bin der Schönschreiber der Nation, kriege 25 Preise, aber liefere trotzdem keinen sauberen Journalismus ab. Diese Probleme verstetigen sich jetzt natürlich, weil heutzutage solche Fehlleistungen nicht mehr einfach weggesteckt werden durch den Vorwurf der allgemeinen Lügenpresse. Die Fakes beim Waldsterben waren schnell vergessen, die Hitler-Tagebücher, diese Fakes waren schnell vergessen. Der Ort Sebnitz war schnell vergessen, wo in der Öffentlichkeit durch die Medien die Fake News verbreitet wurde, dort soll ein Flüchtlingskind ermordet worden sein von Rechtsradikalen. Heutzutage bleibt das im Gedächtnis haften. Und deshalb ist es so wichtig, immer wieder deutlich zu machen und zu begründen, Transparenz in den Medien, wie ich zu meinen Fakten komme und jede Quelle noch einmal öffentlich benennen zu können. Das, glaube ich, ist das Entscheidende.
Wentzien: Sind Sie in der Summe optimistisch, was die Anerkenntnis und das Vertrauen-wiedergewinnen anbelangt?
Relotius hat wie Egon Erwin Kisch geschrieben
Elitz: Es lohnt sich ja jetzt nicht zu sagen, alles geht den Bach runter. Wir sehen ja mit der Transparenz-Initiative, die viele Medien jetzt haben, auch mit der Kritik, mit der man anlässlich von Relotius umgegangen ist, und dass man ja vielleicht auch mal den Egon-Erwin-Kisch-Preis, der ja nach einem bekannten Fake-Journalist benannt worden ist, denn Egon Erwin Kisch hat gefakt. Insoweit, er hat geschrieben wie Relotius, und Relotius hat wie Egon Erwin Kisch geschrieben. Dass also solche mangelnden Kenntnisse der Mediengeschichte und der Literaturwissenschaft sich nicht bis in die Köpfe des Gruner-und-Jahr-Verlags verlagert hatten, ist schon erstaunlich.
Wentzien: Das ist die journalistische und sagen wir mal berufsspezifische Perspektive von Ernst Elitz. Jetzt möchte ich gern noch eine deutschlandpolitische von dem deutsch-deutschen Dolmetscher haben. Die Mauer ist seit dem vergangenen Jahr länger weg, als sie jemals existiert hat. Wir haben in diesem Herbst drei Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Dann im November den 30. Jahrestag des Mauerfalls. Und ich zitiere jetzt mal bitte, Ernst Elitz, aus einem Buch, das Sie geschrieben haben, "Ostdeutsche Profile. Von Bärbel Bohley zu Lothar de Maizière" aus dem Jahr 1991. Sie haben damals geschrieben, Herr Elitz: "Ich wollte wissen, warum die einen mutig waren, während die anderen sich noch zurückhielten. Es sind Lebensläufe voller Widersprüche, und bei jedem habe ich mich gefragt, wie hättest du in ihrer Situation gehandelt. Diese Frage muss sich wohl jeder stellen, bevor er verteidigt oder verurteilt. Wichtig ist es erst einmal, die Menschen hinter den Schlagzeilen kennenzulernen." Auf den hohen Zinnen Ihrer Erfahrung, mit dem Blick zurück – wo steht dieses Land? Haben wir genügend zugehört, bevor wir verurteilt und angegriffen haben?
Elitz: Da muss man wieder einen Griff in die deutsche Geschichte nehmen. Denn wenn wir uns ansehen, mit welchem Eifer Nazis in führende Positionen gekommen sind nach dem Zusammenbruch und sich dort auch lange behauptet haben, und wie Richter sich geweigert haben, Nazi-Unrecht zu verurteilen, dann hat Deutschland dazugelernt. Denn mit den Stasi-Leuten ist man schon anders umgegangen als mit den alten Nazis. Und diese Aufklärung ist wichtig. Man muss wissen, warum haben sich Menschen wofür entschieden? Warum sind die einen zur Stasi gegangen, warum haben sie Erpressungsversuchen nicht widerstanden? Warum haben andere widerstanden? Das ist dann nicht immer ein Urteil über die Menschen. Da soll man sich zurückhalten, wenn man nicht in derselben Situation gewesen ist. Aber immer darauf zu blicken, was waren Situationen, vielleicht auch, wie hättest du dich entschieden, selbst – im Nachhinein kann man nie sagen, wie man sich entschieden hätte. Aber das immer mit im Hinterkopf zu haben und Menschen zu verstehen, ist die einzige Möglichkeit, sie vielleicht auch aufzuklären und zu überzeugen. Bevor ich einen Menschen nicht verstehe, nützt es nicht, ihm alle möglichen guten Argumente vorzutragen. Ich muss wissen, welche Argumente er braucht, damit er sich von seiner Versteifung löst.
Wentzien: Das Buch damals, Ihr Buch, Herr Elitz, hieß, Sie waren dabei. Wenn Sie jetzt ein neues schreiben würden, würde es heißen "Zuhören statt urteilen"?
Elitz: Man muss schon urteilen. Aber bevor man verurteilt, soll man sich das sehr genau überlegen.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandfunk Kultur macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.