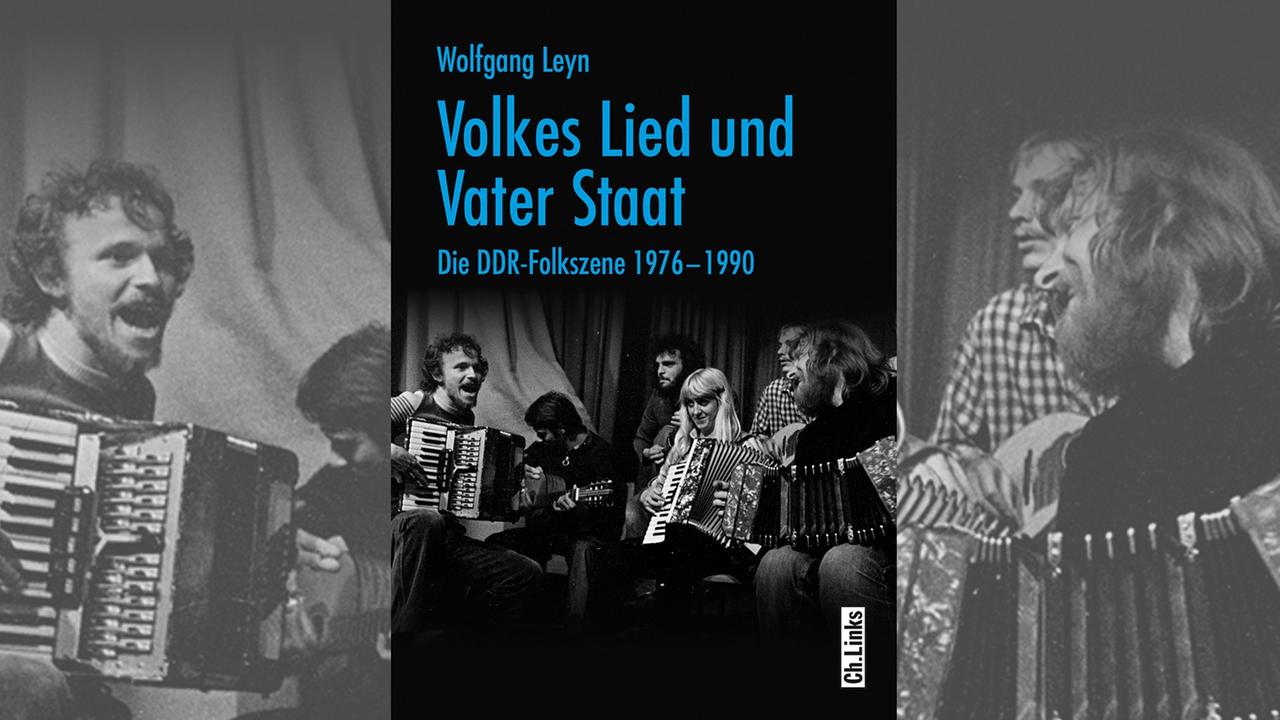
Christoph Reimann: Nicht unbedingt virtuos, aber wichtig. Folkmusik aus der DDR. Das Stück ist eines der Klangbeispiele zum Buch "Volkes Lied und Vater Staat". Auf fast 400 Seiten zeichnet Wolfang Leyn zusammen mit zwei weiteren Autoren darin die Geschichte der Folk-Szene in der DDR nach – und leistet Pionier-Arbeit. So umfassend wie er hat es noch keiner gemacht. Herr Leyn, ich freue mich, Sie zum Corsogespräch zu begrüßen.
Wolfgang Leyn: Hallo.
Reimann: Mit den Songs von Bob Dylan, Pete Seeger oder Joan Baez schwappte in den 60er-Jahren die Folk-Welle auch nach Deutschland – zumindest nach Westdeutschland. Überhaupt schien damals die Zeit günstig für Folkmusik. In Westdeutschland trafen sich in den 60ern die Liedermacher- und Folker-Szene um Hannes Wader bis Franz Josef Degenhardt auf der Burg Waldeck in Rheinland-Pfalz. Den Beginn der DDR-Folkszene datieren Sie auf das Jahr 1976. Was ist damals passiert?
Leyn: Kurze Sache davor, 1966 wurde in Berlin der Oktoberklub gegründet, das heißt, der hieß damals noch 'Hootenanny-Klub' und das war sozusagen die ostdeutsche, die DDR-Entsprechung der Waldeck-Szene. Und dann kam die zweite Welle 1976, und die kam nicht aus Amerika, sondern aus Irland. In der DDR zum Beispiel gab es dieses Festival des politischen Liedes jedes Jahr im Februar, und dort trat 1974 die 'Sands Family' aus Nordirland auf. Das war irgendwie für Jürgen Wolff - von Folkländer dann der Mitgründer - war das die Initialzündung. Und es gab damals schon andere Bands, die in Berlin irische Musik gespielt haben oder in Greifswald. Das war eine Musik, die nach vorne losging, das war eine Musik, die sehr engagiert war, das war eine Musik, wo man die Dinge, die einen interessierten - also Weib, Wein und Gesang; konnte auch Whiskey und Bier sein -, wo das alles zusammen war mit dem Kampf, mit der Rebellerei. Und das war irgendwie attraktiv, war musikalisch interessant und das hat uns begeistert. Uns, das waren viele Leute die aus der Singerbewegung kamen, also sozusagen aus dem Nachfolger der ersten Folk-Welle in der DDR, und dann kam halt diese neue Musik. Und das hat man gemacht und das kannte noch keiner, war in den Clubs aber sofort angesagt. Es gab damals unheimlich viele Jugendclubs und Studentenclubs im Osten, das hat sich in den siebziger Jahren unheimlich entwickelt und das war am Anfang ein absoluter Selbstläufer.
Reimann: Sie waren ja damals selbst Teil der Szene, Sie waren von Anfang an quasi dabei. Die Band Folkländer - die haben Sie schon angesprochen -, da waren Sie auch selbst als Musiker mit unterwegs.
Leyn: Ja, ich hab dort gesungen, irische Irish-Folk-Songs mit Begeisterung. Ich hab kein Instrument gespielt, das war dann auch einer der Gründe, weshalb ich auch nach anderthalb Jahren da raus bin. Aber ich bin der Szene treu geblieben als ehrenamtlicher Festival-Mitorganisator in Berlin, bei diesen Folklorefesten, und ich habe auch Radiobeiträge gemacht und hab für Zeitschriften geschrieben.
Englische Sprache als Problem
Reimann: Aber das mit dieser irischen Volksmusik, mit diesem irischen Volkslied, das stelle ich mir praktisch gesehen schon schwierig vor, denn ich mein das waren immerhin auch englische Texte, die mussten Sie irgendwie wahrscheinlich transkribieren, abschreiben, abhören?
Leyn: Das war ein großes Problem.
Reimann: Eben, wenn man Russisch in der Schule lernt?
Leyn: Naja, Englisch haben wir schon gelernt, aber es gab natürlich keine Liederbücher, keine irischen, sondern man hat wirklich von der Platte versucht das runterzuhören, und der Englischwortschatz des Irish Folk, also Gallows Tree war zum Beispiel in meinem Englischbuch nicht drin. Da waren also Sachen, die man sich mühsam erschließen musste und dann sind auch irgendwelche irischen Ortsnamen dabei. Also manchmal ist da auch sicher nicht so ganz das getroffen worden, was gemeint war, aber doch, von der Stimmung her schon.
Reimann: Irgendwann hat aber dann dieses irische Liedgut nicht mehr ausgereicht.
Leyn: Ja das ging relativ schnell. Es gab also im Oktober '76 in Leipzig diese allererste 'DDR-Folk-Werkstatt'. Werkstatt ist ein Begriff aus der Singerbewegung, also ein gemeinsames Treffen, wo man zum Erfahrungsaustausch hinkommt, wo man öffentlich auftritt, Konzerte macht und dann auch sehr gesellig miteinander umgeht bei ziemlich viel Bier und Karo-Zigaretten - das waren diese Filterlosen, die sozusagen Gauloises des Ostens die da viel geraucht wurden in dem Studentenclub der Hochschule für Grafik und Buchkunst. Und da wurde am Anfang ganz viel Internationales, vor allem Irisches gesungen. Und irgendwie kam uns damals schon der Verdacht, man müsste auch mal gucken, ob es beim deutschen Volkslied auch sowas ähnliches gibt, so bissel die kräftigen, die deftigen Sachen, die rebellischen, nicht so Heidenröslein oder so.
"Irgendwie kamen die Platten doch ins Land"
Reimann: Und wo wurden Sie da fünfig?
Leyn: Ja, also es gab schon Aufnahmen von Liederjan und von Zupfgeigenhansel, die wir auf Platten - die es ja in der DDR nicht zu kaufen gab, aber irgendwie kamen die doch ins Land -, die man da gehört hatten diesen Steinitz, Wolfgang Steinitz. Zwei dicke Bände, "Deutsche Volkslieder demokratischen Charakters", 1954 und 1962 in Ostberlin erschienen, im Akademieverlag. Und da haben wir diese Lieder gefunden.
Reimann: Und diese Sammlung von Steinitz, die bezeichnen Sie in Ihrem Buch als so etwas wie die Bibel der Folk-Szene.
Leyn: Das war's auch.
Reimann: Was war das besondere an diesen Stücken darin?
Leyn: Wie gesagt, das waren eben nicht die romantischen Volkslieder, die schön waren, sondern: Man hat dort eben die Wut, den Zorn, den Spott, die Klage gehört. Und das hat uns irgendwie fasziniert und auch dieses Kämpferische, was da drin war. Und eben nicht nur einfach schöne Lieder in irgendwelchen Chorsätzen, sondern irgendwie, vielleicht: Die Jugend will ja auch rebellisch sein, und das hat uns irgendwie gut in den Kram gepasst.
Reimann: Fällt Ihnen ein textliches Beispiel ein?
Leyn: Ja das war so ein Soldatenlied: "Was nützt mir mein Studieren, viele Schulen absolvieren. Bin doch ein Sklav' und Knecht, oh Himmel ist das recht?". Also wer da irgendwie Abitur gemacht hatte und oder wer schon studiert hatte und dann zur Nationalen Volksarmee eingezogen wurde und dann war er irgendwie nichts, das konnte man irgendwie gut nachfühlen.
Reimann: Und diese Texte waren der SED recht oder gab es da Probleme?
Leyn: Das kann man nicht so genau sagen, also das Buch ist erschienen - wie gesagt - in der DDR im Akademieverlag, ist allerdings nie wieder aufgelegt worden in der DDR, es gab nur eine Kurzausgabe. Es ist nur im Westen bei "Zweitausendeins" dann erschienen als Fotokopie, die beiden Bände in einem. Vielleicht hat's eben doch nicht so gepasst und ich hab beim Recherchieren den Herausgeber von dieser Kurzausgabe gefragt, was er meint warum das nicht erschienen ist. Und er meinte, in den achtziger Jahren hätte das Antimilitaristische - was ja in diesem Steinitz natürlich drin ist - nicht mehr so in den Kram gepasst, weil da hat man dann den Wehrunterricht erfunden und das war dann nicht mehr so passend. Ich weiß nicht ob's stimmt, aber es könnte so sein.
Arbeiten mit Tabus
Reimann: Stand die Szene denn unter Beobachtung?
Leyn: Es stand alles unter Beobachtung, was mit Texten gearbeitet hat, weil: In der DDR waren die Leute gewohnt, wegen verschiedener Tabus, die man nicht nennen durfte in den Medien, in der Presse, im - was weiß ich - auf der Bühne, hat man zwischen den Zeilen gelesen. Das haben alle gekonnt und damit haben die Bands auch gearbeitet. Sie haben eben dann ein Lied genommen aus dem 19. Jahrhundert gegen den Drill in der preußischen Armee, aber alle wussten natürlich: gemeint war die Nationale Volksarmee. Oder man hat ein Auswandererlied gemacht und da wusste natürlich auch jeder, es war die Zeit der Ausreiseanträge - dann Mitte der 80er Jahre - worum es eigentlich ging. Das Publikum hat besonders auf das gehört, was nicht gesagt wurde. Und das haben die Behörden, das hat natürlich die Stasi auch gewusst und hat die Szene schon beobachtet, aber in dem Moment konnten sie wenig machen.
Reimann: Wenn man jetzt über die Folk-Szene musikalisch sprechen möchte, also nicht unbedingt um die Texte - wir haben gerade ein Klangbeispiel gehört - aber was zum Beispiel sind die Brummtöpfe? Nach denen hat sich ja dann auch eine Band benannt.
Leyn: Genau. Brummtöpfe waren die ersten Eigenbau-Instrumente, also man nimmt so einen Gurkentopf, so einem Tontopf, spannt ein Trommelfell drüber oder eine Schweinsblase und bindet einen Stab dort rein. Und dann, wenn das richtig fest gespannt ist, reibt man an diesem Stab und es gibt so einen dumpfen, ja, furzähnlichen Ton und damit kann man schön begleiten. Es hat was Ürsprüngliches, was Archaisches und irgendwas Freches - und das war grade richtig.
Kultur wurde finanziell gefördert
Reimann: Wenn man öffentlich auftreten wollte, brauchte man eine Spielerlaubnis. In die sogenannte Amateurpappe oder Profipappe wurde eingetragen, wie viel Geld man dann bei Konzerten verlangen konnte – und das wurde auch gezahlt. Denn die Veranstalter bekamen dafür Geld. Geldsorgen hatte man damals also nicht. Also man hätte auch als Musiker profitieren können von diesem System.
Leyn: Das ist so. Die DDR hat sehr viel für die Kultur ausgegeben. Und ich hab mal gezählt - 1989 gab es 16 Profibands in der DDR-Folk-Szene - wenn man das mal hochrechnet auf die Bundesrepublik, dann hätte man ungefähr die fünffache Zahl haben müssen - die es nicht gab. Also ich war sehr erstaunt, als ich 1989 erfahren hab, dass zum Beispiel die Gruppe Lilienthal aus Göttingen - eine tolle Gruppe, die auch Platten gemacht hat - dass sie von der Musik nicht leben konnte, sondern sie mussten ein Studio betreiben, Musikunterricht geben oder irgendwie durch andere Berufe eben den Lebensunterhalt verdienen. Das war in der DDR anders. Und wenn du diese Einstufung hattest, du musstest vor einer Kommission vorspielen, die nicht unbedingt sehr kompetent war - das war unterschiedlich. Aber wenn du diese Auftrittsgenehmigung hattest, konntest du ein festes Honorar verlangen. Das war nicht unheimlich hoch, aber da die Lebenshaltungskosten gering waren... Jo Meier hat mal gesagt, von Jams aus Berlin, Geld hat eigentlich kaum eine Rolle gespielt. Teuer waren allenfalls Instrumente, wenn du die haben wolltest, dann eben in Markneukirchen, bei irgend einem Musikinstrumentenbauer, die eine Drehleier hast bauen lassen. Die war schon teuer, und teuer war auch irgendwie gute Technik. Aber alles andere war kein Problem.
"Bei vielen ist es weitergegangen"
Reimann: Nur mit dem Ende der DDR endete auch dieses Bezahlsystem. Die Musik musste sich dann auf einmal selbst tragen. Klappte das?
Leyn: Es war ein Einbruch für viele, und es ist auch von denen die heute noch von der Musik versuchen zu leben, die haben es sehr viel schwerer, zumal ja 1990 auch die wichtigsten Auftrittsorte, also die Klubs, viele zugemacht wurden oder aber keine Veranstaltung mehr gemacht hatten, da war die Währungsunion, 'können wir das noch bezahlen?'. Die Jugendclubs liefen zwar offiziell unter FDJ, aber de facto unterstanden sie den Kommunen und die hatten da einen Fond dafür, und die Kommunen hatten dann plötzlich keinen Fond mehr und dann machten die zu. Das war natürlich ein Einschnitt. Aber: Es haben sich allerhand gehalten, erstaunlich viele. Das steht ja auch bei den Bandportraits, wenn ich also irgendwo wusste, dass es da weitergegangen ist nach 1990 - und bei vielen ist es weitergegangen -, da haben wir es auch drin vermerkt.
Reimann: Was ist das Vermächtnis der DDR-Folk-Szene?
Leyn: Ich würde sagen, das Lebendigste an diesem Vermächtnis ist das Festival in Rudolstadt, was seit 1991 jedes Jahr Anfang Juli dort stattfindet.
Reimann: Deutschlands größtes Folk-, Roots- und Weltmusikfestival.
Leyn: So sieht es aus. Und das ist nicht zufällig im Osten, und der Festivaldirektor Uli Doberenz ist ein Mitglied von Folkländer und der Chefgrafiker in Rudolstadt ist ein Mitglied von Folkländer und noch weitere Gestalter, und die Frau, die das Kinderfest gestaltet, die war bei Folkländer. Es sind eine Menge ostdeutsche Folk-Leute dort, es ist eine deutsch-deutsche Veranstaltung, der künstlerische Direktor kommt aus Bonn und wohnt in München, Bernhard Hanneken. Und es ist sozusagen, dort hat sich auch verwirklicht - ich habe es im Buch so geschrieben - wahrscheinlich ist die Folk-Szene einer der ganz wenigen Bereiche, wo es wirklich eine Vereinigung gegeben hat und nicht ein Beitritt zu den Bedingungen des Stärkeren. Vielleicht liegt es daran, dass die Folk-Szene im Osten stärker war. Es gab - ich denke mal - bessere Bands, das haben mir auch etliche Leute bestätigt, dass die im Schnitt besser waren, weil sie öfter spielen konnten, weil sie finanziell unabhängig waren. Es war auch ein bisschen später, das war auch gut, die Folk-Szene im Westen war schon ein bisschen abgeflaut, hatte kein eigenes Festival mehr. Und in Rudolstadt gab es das Tanzfest, die hatten immer schon den Kontakt auch in den Westen. Bei den diversen Werkstätten der Ost-Folk-Bands waren meistens irgendwelche Leute aus dem Westen auch dabei, 'ach ja hier, das ist der Bernhard' und da wurde nicht gesagt, wo der herkam oder so sondern: 'das ist der Bernhard und der hört sich das jetzt mal mit an'.
Reimann: Wolfgang Leyn, Journalist und Autor des Buchs "Volkes Lied und Vater Staat. Die DDR-Folkszene 1976 bis 1990". Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Leyn: Gerne.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.