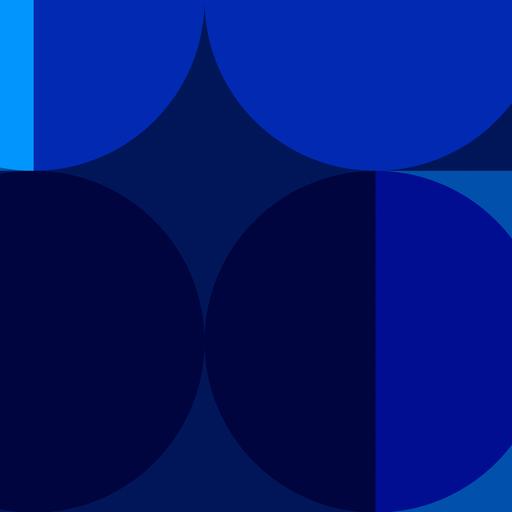Stephan Detjen: Herr Professor Schwarz, Sie wurden 1934 geboren. Also, das heißt, die Zeit des Heranwachsens der politischen, der wissenschaftlichen Sozialisation begann für Sie nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Sie verlief also parallel und mit dem Wiederaufstieg Nachkriegsdeutschland aus Schutt und Schuld des Zweiten Weltkrieges. Das ist das, was Helmut Kohl, der Protagonist eines Ihrer großen Werke, Ihrer großen Biografie, die Gnade der späten Geburt genannt hat. Oder?
Schwarz: Ich habe mit diesem Slogan nie viel anfangen können. Ich finde, ich bin zur rechten Zeit geboren, ich habe den Krieg wirklich noch erlebt, die Stimmung des Krieges, aber nicht sehr ernsthaft. Ich komme aus dem Südbadischen, da war nicht viel los.
Detjen: In Lörrach geboren.
Schwarz: Lörrach, ja, da waren keine großen Bombardierungen, es war mehr die Stimmung, die man nun mitgekriegt hat. Die französische Besatzung, zwei, drei, vier Jahre, recht lästig im Grunde. Andererseits wurde das Französisch obligatorisch eingeführt, wofür ich sehr dankbar bin, weil ich jetzt zu den Deutschen gehöre, die sich französisch unterhalten können. Interessant bei mir ist – weil Sie ja sagen: Sozialisation – das Gymnasium gewesen. Ich ging auf ein humanistisches Gymnasium. Wir hatten einen ausgezeichneten Literaturunterricht, Geschichtsunterricht, und zwar einen Geschichtsunterricht, der bis zum Kriegsbeginn des Zweiten Weltkriegs lief.
Detjen: Also das war, um das zeitlich einzusortieren, dann in den unmittelbaren Nachkriegsjahren.
Schwarz: Ja, recht objektiv. Ich würde also sagen, wenn ich mir heute so die Hefte da ansehe, das ist, also in vielem hat die Forschung Differenzierung vorgenommen, aber es war eine gute Ausbildung und es war eine bemerkenswert europäische Ausbildung.
Herkunft aus Südbaden, die sehr diskussionsfreudige Nachkriegszeit der 50er-Jahre und das Freiburger Seminar von Professor Arnold Bergstraesser
Detjen: Das ist ja eine Perspektive, eine Zeit auch, eine frühe Ausbildung, die andere Generationsgenossen ganz anders erlebt haben. Die würden dann erzählen von Lehrern, die immer noch nationalsozialistisch-autoritär geprägt sind. Und da entwickelten sich dann unterschiedliche Perspektiven, die sich ja im Werk dann niederschlagen.
Schwarz: Ja, das ist in der Tat so, Drittes Reich ist auch gründlich durchgenommen worden, auch im Abitur musste ich da im Vortrag extemporieren dazu. Also, ich kann es nicht bestätigen – ich habe 53 Abitur gemacht, das Dritte Reich und diese ganzen Grässlichkeiten, auch Zweiter Weltkrieg und so, auch die Vorgeschichte selbstverständlich, also Erster Weltkrieg, Wilhelminischer Imperialismus und so –, dass das nicht durchgenommen und problematisiert worden ist. Insofern haben manche andere andere Erfahrungen.
Detjen: Und Sie haben als Historiker dann später, etwa in Ihrer Geschichte der Bundesrepublik in der Adenauer-Zeit, diese 50er-Jahre in ein Licht gerückt, in dem es so nach wie vor von vielen anderen nicht gesehen wird. Viele beschreiben es nach wie vor als eine Zeit des Muffs, der Restauration. Sie haben es geschildert als eine Zeit, in der sehr viel Aufbruch, Perspektiverweiterung stattgefunden hat, wissenschaftlicher Austausch stattgefunden hat, der dann Biografien wie die Ihre geprägt hat.
Schwarz: Das hing teilweise natürlich mit dem Freiburger Seminar von Arnold Bergstraesser zusammen ...
Detjen: Politologe, bei dem Sie dann später ...
Schwarz: ... 55, 56, da angedockt habe. Bergstraesser kam aus der amerikanischen Emigration, relativ spät erst wieder zum Zug gekommen, also so 51, 52. Und er hat es verstanden, einmal einen interdisziplinär breiten Kreis zusammenzukriegen, Diplompolitologen gab es ja noch gar nicht in Freiburg, ich habe einen Doktor gemacht in der philosophischen Fakultät, sondern das Fach politische Wissenschaft war mit Soziologie verbunden. Wir hatten im Seminar neben Philologen, Historikern, Juristen, Ökonomen. Recht bunt das Ganze also, und zwar zugleich politisch bunt, also von links bis rechts, dauernd heftige Diskussionen. Insofern, schon in der Studentenzeit habe ich die Bundesrepublik nicht muffig erlebt. Wir hatten die großen Diskussionen um die Wiederbewaffnung, um die Antiatomtodkampagne, die Auseinandersetzungen zwischen den Gaullisten und Atlantikern. Das empfinden natürlich Politologen ganz anders als der normale Student. Wir hatten in Freiburg, ich war so ein paar Jahre lang zuständig für das sogenannte Colloquium politicum, zusammen mit den politischen Hochschulgruppen, also SDS – damals noch ein unrevolutionärer sozialdemokratischer, wenn auch linkssozialdemokratischer Verein, mit den Christlichen Demokraten, mit den Liberalen. Also insofern ist es mir schwergefallen, als dann so die etwas aufgeregten Studenten der 68er- oder 67er-Bewegung, muss man ja sagen – in Deutschland ging es 67 los –, ist es mir schwergefallen nun zu glauben, dass die ganzen Jahre, aus denen ich kam, muffig und diskussionslos und, und, und waren. Und interessant waren natürlich auch die wissenschaftlichen Entwicklungen.
Detjen: Darauf wollte ich zu sprechen kommen! Sie haben das ja geschildert, ein – heute würde man sagen – ganz interdisziplinäres Umfeld, was da entstanden ist, dann insbesondere in Freiburg, der Schule am Seminar Bergstraessers. Sie sind Historiker geworden, so werden Sie auch wahrgenommen, aber Sie haben als Politologe eigentlich angefangen. Was ist das für ein Weg gewesen?
Schwarz: Ich war dauernd Politologe, bis zum Schluss war meinetwegen politische Wissenschaft. In Bonn kam dann ab 87 Zeitgeschichte dazu ...
Detjen: Aber würde Sie eben als Historiker ansprechen.
Schwarz: Meine Hauptaufgabe war es in Hamburg, in Köln Diplompolitologen sozialwissenschaftlicher Richtung systematisch als Politologen auszubilden. Also, die Zeitgeschichte, die gab zwar die Perspektive, das historische Verständnis der politischen Wissenschaft, aber die reale Aufgabe von Montag bis Freitag war es, Politologen auszubilden. Aber noch mal zu Ihrer Frage zurückzukommen: Das Interessante in den 50er-Jahren war die Entdeckung der Sozialwissenschaften, der empirischen Sozialwissenschaften, die sich in den USA stark entwickelt hatten, aber auch damals in Frankreich, eine Sozialwissenschaft, die auch stark ökonomische Komponenten miteinbezogen hat. Und das führte also so aus dieser Engführung der Historiker einfach heraus und brachte ein Verständnis der Geschichtswissenschaft auch, das im Grunde dann später als Entdeckung der Sozialwissenschaft, der Kulturwissenschaft und, und, und gefeiert wurde, das aber schon in den 50er- und frühen 60er-Jahren angelegt war. Und das hat mich im Grunde interessiert und fasziniert.
Problematik der Zeitgeschichte, die Rolle außenpolitischer Konzeptionen für Deutschland und Europa gestern und heute
Detjen: Lassen Sie uns einen Begriff klären, der jetzt mehrfach gefallen ist, den Begriff der Zeitgeschichte. Das ist ja ein Begriff, der von jeder Historikergeneration wieder neu für sich definiert, geklärt werden muss. Hans Rothfels, der große deutsche Historiker, hat sie mal als die Geschichte der Mitlebenden bezeichnet, die amerikanische Historikerin Barbara Tuchman als Geschichte, die noch qualmt, Martin Sabrow, einer Ihrer heutigen Kollegen, sagt, Zeitgeschichte ist Streitgeschichte. Was ist es für Sie?
Schwarz: Ich würde schon sagen: die Geschichte der Mitlebenden. Es ist etwas anderes, ob ein Historiker, der mit wachen Antennen die Strömungen, die Kontroversen, die Widersprüche seiner jeweiligen Zeit erlebt hat, ob er sich dann diszipliniert mit Befragungen und Heranziehung sämtlicher denkbarer Archive und so weiter, ob er eine Darstellung der Zeit schreibt oder ob jemand Zeitgeschichte betreibt, dem nur zur Verfügung stehen Filme, Fernsehaufzeichnungen. Ich meine, das ist heute ja was ganz anderes, heute haben Sie ja die ganzen ikonografischen Materialien, die viel zu wenig ausgewertet werden. Oder ob der Betreffende das erlebt hat. Insofern ,ich war ja der Nachfolger von Rothfels auch bei , - nie sein Schüler, aber der Nachfolger - als Herausgeber der "Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte", zusammen mit ...
Detjen: Das ist sozusagen das Standesorgan der Zeithistoriker in Deutschland.
Schwarz: ... zusammen mit Bracher. Aber ich fand den Ansatz von Rothfels richtig, ja.
Detjen: Wenn man den Begriff von Rothfels noch mal aufnimmt, Zeitgeschichte ist die Geschichte der Mitlebenden, dann heißt das auch immer: Es ist die Geschichte der eigenen Zeit. Der Zeithistoriker schreibt also zwangsläufig immer auch ein Stück der eigenen Biografie?
Schwarz: So ist das. Und das bringt natürlich ein gewisses Moment der Subjektivität mit hinein, das ist ganz unvermeidlich. Sie sind als Historiker verpflichtet, ihre Subjektivität zu kontrollieren, aber Sie sind nicht verpflichtet, Ihre Subjektivität zu kastrieren.
Detjen: Das ist dann eine Auseinandersetzung, welchem Wagnis Sie sich auch gestellt haben mit Ihrem ersten großen zeithistorischen Werk, bis heute ein Standardwerk, "Vom Reich zur Bundesrepublik. Deutschland im Widerstreit der außenpolitischen Konzeption in den Jahren der Besatzungsherrschaft 1945 bis 1949", ich glaube, 1966 erschienen, Ihre Habilitationsschrift, dann 1980 noch mal neu aufgelegt. Also, die Verknüpfung eines ganz neuen Ansatzes, einer Neudefinition der Zeitgeschichte auch, die sich den Wurzeln der Bundesrepublik zuwendet mit einer eigentlich traditionellen Perspektive, nämlich der Perspektive auf die Außenpolitik als ein ganz klassisches Feld geschichtswissenschaftlicher Betrachtung.
Schwarz: Das war der Ansatz. Aber es gab zwei Eigentümlichkeiten dieses Buches: Erstens konnte ich mich mit wenigen Ausnahmen noch nicht auf archivarische Quellen stützen. Ich hatte das Glück, das habe ich in Niedersachsen an der Staatskanzlei, konnte ich es einsehen, rangehen, die Vatikanischen Archive, nun also Exzerpte machen mit Genehmigung des Staatssekretärs. Ich konnte also die Akten der Konferenz 1948 in Niederwald und in Koblenz, aus der dann die Entscheidung gefallen ist, den Parlamentarischen Rat einzuberufen, das konnte ich mir ansehen. Aber sonst musste ich mich in starkem Maße auf Zeitungsquellen oder auf auch Interviews stützen. Ich habe einen Großteil der damals ja noch lebenden frühen Politiker der Bundesrepublik interviewt. Und das Zweite: Ich habe relativ stark – und ich fand, das ist nützlich bis heute – mit dem Begriff von außenpolitischen Konzepten gearbeitet. Ich meine, wir hatten in der Innenpolitik, schon Hermann Heller wurde damals bei uns in den 50er-Jahren stark rezipiert, die Ideenkreise der Innenpolitik, Liberalismus, Sozialismus, Konservatismus und, und, und. Das können Sie aber auch mit außenpolitischen Ideenkreisen machen. Und ich habe versucht, das Konzept vom Hermann Heller nun für ein Verständnis der amerikanischen, der französischen, sowjetischen Ideenkreise zu fruktifizieren und zu zeigen, wie sich das mit den Ideenkreisen in den Westzonen, in der Ostzone – die natürlich nun in beiden Fällen von den Siegermächten manipuliert werden, in der Sowjetzone sehr viel stärker noch als in den Westzonen –, das war der Ansatz und der ist also ganz gut aufgenommen worden.
Detjen: Lassen Sie mich, Herr Professor Schwarz, mal einen ganz weiten Sprung machen! Wenn man den Untertitel dieses ersten großen Buches, Ihrer Habilitationsschrift heute liest, "Deutschland im Widerstreit der außenpolitischen Konzeptionen", dann könnte das auch der Titel für eine ganz gegenwärtige Beschreibung außenpolitischer Debatten sein. Auch da haben wir es in diesen Tagen sozusagen mit Ideenkreisen zu tun in Deutschland in einer neuen Dimension, als militärischer Akteur, auf der Bühne der Weltpolitik. Was haben diese Diskussionen heute, was hat diese Bundesrepublik heute noch mit der frühen Bundesrepublik, die Sie damals beobachtet haben, zu tun?
Schwarz: Also, was die Frage der militärischen Sicherheit angeht, die ist ja nicht allzu tief. Wir haben in der Bundesrepublik zwischen 1955, als die Entscheidung zur Wiederbewaffnung fiel, bis 1989/90, da hatten wir ja eine Bundeswehr, deren Aufgabe es war zu kämpfen. Abzuschrecken zwar, aber notfalls auch zu kämpfen, man war da nicht sehr zimperlich in diesen Fragen. Im Nachhinein ist dann so die Vorstellung lanciert worden, stark von grünem Gedankengut beeinflusst, aber nicht nur, die Bundesrepublik eine Zivilgesellschaft, die in diesen Fragen von Krieg und Frieden anders ist. Sie war bestimmt keine Zivilgesellschaft in dem Sinne, dass nun das Element der militärischen Macht nicht da war, nicht in den Jahren bis 1990. Es hat sich also erst so entwickelt in den Jahren darauf. Andererseits muss man sagen, wenn Sie allein die Frage der Rüstungslieferungen nehmen, was passiert im ersten Irak-Krieg, als die Iraker ein paar Raketen auf Tel Aviv schießen, Genscher und Kohl durchbrechen alle Grundsätze, nicht Waffen in Spannungsgebiete zu liefern, und liefern den Israelis Abwehrraketen und manches andere. Für Israel gilt das ganze ja ...
Detjen: Das ist sicherlich ein Sonderfall. Angela Merkel hat mal gesagt, die Sicherheit Israels ist Teil der deutschen Staatsräson. Und man könnte das auf solche Entscheidungen dann begründend zurückführen.
Schwarz: Ja gut, ich meine, jede Entscheidung ist ein Sonderfall. Das von Schröder durchgezogene, von der UN nicht mandatierte Eingreifen im Kosovo-Krieg mit der Bombardierung Jugoslawiens, die Bundesrepublik war dabei, Grenzfall! So könnte man also weitermachen. Also, so groß ist die Zäsur nicht. Aber ich würde schon sagen, die eigentliche Zäsur beginnt in den frühen 90er-Jahren, aus guten Gründen, als sich die Bundesrepublik doch stark zurückgehalten hat. Ich meine, ich habe es damals scharf kritisiert, auch publizistisch, dass man nicht früh in Jugoslawien zusammen mit Franzosen, Engländern interveniert hat, um also dieses Völkermorden da zu beenden, abgewartet hat bis 95 und 96. Aber ich war immer sehr kritisch, was Aktivitäten außerhalb Europas anging. Mir hat es nie einleuchten können, wie es möglich wäre, in Afghanistan, wo die Stämme seit 200 Jahren große Freude daran haben, Kriege gegen die Eindringlinge zu führen, wie man da eine Demokratie etablieren könne. Dasselbe gilt für den Irak. Also, es gibt Unterschiede, aber sie sind nicht so gravierend, wie man immer tut.
Detjen: Es sind ja viele Diskussionen, die wir heute führen, für die die Debatten in der Gründerzeit der Bundesrepublik in den 50er-Jahren aufschlussreich sind, weil dort eben Weichen gestellt wurden, mit denen wir uns heute wieder auseinandersetzen. Das gilt auch ganz besonders für die Europapolitik, auch da stehen wir in einer Phase der europäischen Entwicklung, wo die Frage aufgeworfen ist in einer ganz besonderen Intensität, wohin entwickelt sich dieses Europa eigentlich. Und ich würde damit gerne auf Adenauer zu sprechen kommen, dem Sie eine große, zweibändige Biografie gewidmet haben. Da wurde die Europapolitik, da wurde das europäische Verständnis Deutschlands entwickelt, und es war – wenn ich das richtig verstehe – ein Verständnis einer Entwicklung, die immer auf eine Integration Deutschlands in einen europäischen Bundesstaat hinausführt, letztlich auf eine Aufgabe, Nationalstaatlichkeit in einem tief integrierten Europa. Davon sind wir heute eigentlich weit weg!
Schwarz: Ich habe eigentlich immer versucht, ein differenziertes Bild der Adenauerschen Europapolitik zu bringen. Er hat in den frühen 50er-Jahren das aufgegriffen, was er haben konnte. Als es um die Kohle- und Stahlindustrie ging, die ja noch unter der Ruhrkontrolle stand, ist er auf den Plan von Schuman aufgesprungen. Er wollte eigentlich direkt die Verteidigung im Rahmen der NATO machen, als er merkte, dass die amerikanische Führung in den Jahren 51/52 sich dafür entschieden hat, diese Kunstkonstruktion einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft zu schaffen, ist er da draufgesprungen. Als die kaputt gemacht wurde in der Französischen Nationalversammlung, ist er auf die NATO-Lösung umgeschwenkt. Er hat dann aus Sorge immer, dass die Amerikaner sich zurückziehen einerseits, andererseits wirtschaftlich zu stark in Europa dominieren, mitgewirkt an der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, Hallstein, der bisher einzige deutsche Präsident, war ja nun eh Mitarbeiter von Adenauer gewesen. Als de Gaulle kam, hat er diese EWG zwar weiter unterstützt, aber auf einen deutsch-französischen Bilateralismus gesetzt und sich im Grunde auf dieses zwischenstaatliche, aber nicht integrative Konzept von de Gaulle eingelassen. Das heißt, Adenauer war in starkem Maß ein Pragmatiker, aber die Vision eines europäischen Bundesstaates, die hat er vielleicht ganz am Anfang, 50/51, je deutlicher ihm dann wurde, was in England läuft, was in Frankreich läuft, wozu also die Belgier, die Niederländer und die Italiener bereit sind oder nicht bereit sind, umso weniger kann ich also bei ihm das föderative Element erkennen. Priorität die deutsche Westbindung – und damit zusammenhing die Europapolitik – vor einer Politik nun der Blockfreiheit, das war die große Auseinandersetzung mit den Sozialdemokraten, auch mit einem Teil der FDP damals. Und in dem Punkt war er also ganz entschieden.
Detjen: Europa war, auch so, wie Sie es jetzt schildern, natürlich eine Konsequenz, eine Lehre aus den Katastrophenerfahrungen des 20. Jahrhunderts, es war ein Friedensprojekt auch in der Politik Kohls, dann die Euro-Einführung war für Kohl ein großes Friedensprojekt. Wie weit reichen diese Erfahrungen, diese Motive, diese Impulse noch, um Europa im 21. Jahrhundert zu gestalten?
Schwarz: Wenn ich eines noch nachschieben darf: Im Unterschied zu Adenauer war Kohl ein 150-prozentiger Föderalist. Kohl wollte einen Bundesstaat, das war seine Vision, ist es wahrscheinlich bis heute. Er ist zwar Enkel Adenauers und hat den auch so interpretiert, aber er war ein Föderalist, und zwar im Sinne von Walter Hallstein, der dieses berühmte Buch geschrieben hat, "Der unvollendete Bundesstaat", wo er im Grunde dann in den europäischen Institutionen, wie sie schon bestanden – der Kommission, die ja als Exekutive konzipiert hat, dem Parlament, das eigentlich eine Versammlung war, noch nicht direkt gewählt damals, dem Rat und dem EuGH –, hat er im Sinne des deutschen Föderalismus ein Konzept eines Bundesstaates entwickelt. Und das hat Kohl übernommen.
Detjen: Für den seine europapolitische Motivation – und das lässt sich an Ihrer Biografie Helmut Kohls ja auch sehr schön ablesen – ja auch ganz unmittelbar biografisch aus den Erfahrungen der letzten Kriegsjahre resultiert, der Tod des Bruders an der deutsch-französischen Grenze, das war das zentrale und sehr idealistische Motiv Helmut Kohls gewesen. Von daher noch mal die Frage: Inwieweit reichen diese Prägungen durch die Katastrophen des 20. Jahrhunderts, um Europa, die Weiterentwicklung Europas in unserer Zeit zu prägen, zu gestalten?
Schwarz: Was die Auswirkungen der Katastrophen angeht, es ist immer noch da, würde ich schon sagen. Man betrachtet den Zweiten Weltkrieg zu gutem Recht so, wie man im 19. Jahrhundert noch den grässlichen Dreißigjährigen Krieg betrachtet hat. Diese Prägung, glaube ich, bei der Politik, in der Publizistik, auch bei den Leuten ist noch da. Nur natürlich die Frage stellt sich: Ist Europa richtig konstruiert?
Detjen: Auch eine Frage an das Leben, an die Entscheidungen Helmut Kohls, wenn man auf die Euro-Einführung schaut.
Schwarz: Die Euro-Einführung, ging das nicht zu weit?
Detjen: War es, so wie Sie es auch schildern, der Preis, den Kohl an Frankreich zahlen musste, um die Wiedervereinigung zu erlangen?
Schwarz: War es zweckmäßig? Ich meine, es ging ja schon vor der Wiedervereinigung los. Ich glaube, der Euro wäre auch gekommen ohne die Wiedervereinigung. Aber gerade bei Frankreich war natürlich die Wiedervereinigung ein mächtiger Impuls, noch stärker darauf zu drängen. Also bei dem Euro ist die Frage natürlich, das Ganze anzulegen als ein paneuropäisches Konzept. Es hätte sich auch vorstellen lassen, dass man gesagt hätte, wir hören bei 15 auf und machen dann ein Neues, andere Institutionen. Aber wenn eine starke Kommission mit einer starken Bürokratie auf Länder stößt, die aus unterschiedlichsten Gründen jeweils Nachbarländer zu Mitgliedern machen wollen, im Fall Deutschland war es Polen, was sehr sinnvoll ist, Polen ist ein ureuropäisches Land, und auch natürlich die baltischen Länder, schon fraglich, ob - aber es ist durchgegangen, bei den Russen, dann natürlich der ganze Balkan. Jetzt sagt man auch den Albanern und, und, und, die Italiener wünschen natürlich, Malta dabei zu haben, Griechenland wünscht, Zypern dabei zu haben. Also, die Tendenz bei den unterschiedlichen regionalen Komponenten der Europäischen Union, das auszudehnen in Verbindung mit der ganz unvermeidlichen Gefräßigkeit einer Zentralbürokratie, das führte ja dazu, dass man diese unvorsichtige Ukraine-Politik betrieben hat. Also, das ist fast ...
Detjen: Warum fanden Sie die Ukraine-Politik unvorsichtig?
Schwarz: Na ja, es ist natürlich schon ein Problem, wenn eine Volksbewegung sich gegen einen korrupten Präsidenten wendet und wochenlang bürgerkriegsähnliche Situationen da sind und dann also alle möglichen europäischen Abgeordneten, Regierungen und, und, und fliegen da ein und mischen mit, ohne genau sich klar zu werden darüber, dass Russland das nicht gerne hinnimmt. Das war also so etwas Pfadfinderpolitik schon.
Von der Bonner zur Berliner Republik, die neue Rolle der Massenmedien, eine Kanzlerbilanz und Aussagen zu Angela Merkel
Detjen: Wie hat sich aus Ihrer Sicht die Politik Deutschlands, gerade die außenpolitische Mentalität Deutschlands durch den Umzug von Bonn nach Berlin – den Sie heftig kritisiert haben damals ...
Schwarz: Ich habe nur kritisiert, warum soll die Bevölkerung das nicht entscheiden! Das kann man doch also im Rahmen einer Volksabstimmung machen! Also, was mich gestört hat, das waren diese ganzen Verrücktheiten, ein Teil in Bonn, ein Teil nach Berlin und, und, und, und. Warum nicht das das Volk entscheiden lassen? Aber das ist eine Sondersache. Was sich in Berlin geändert hat: Ich hatte 2002/2003 eine Festschrift für den Genscher zu schreiben und da war die Frage: Ist es ein Umzug und ändert sich nichts? Und ich war im Jahr 2002/2003 der Meinung, viel geändert hat sich eigentlich nichts, mit einer Ausnahme: den Medien. In Bonn waren die Medien kontrolliert, jedenfalls die Zeitungen, die hatten ihre Bonner Korrespondenten, die aber lange Jahre da waren, alle vier Wochen kam mal ein Chefredakteur rein und hat so die Runde gemacht in den Ministerien. Fernsehen war auch da, auch schon wichtig, aber es war das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Und auf einmal, ich war 2002/2003 schon der Meinung, Medien in Berlin, das ist ganz anders, ich meine, auch deshalb ...
Detjen: Natürlich auch ein technischer Medienwandel dazu, eine Vervielfältigung von Möglichkeiten zu publizieren.
Schwarz: Technischer Medienwandel, also, da geht es rauer zu, es geht oberflächlicher zu teilweise auch. Und die Politik kann nicht mehr so frei und gut mit den Zeitungsredaktionen oder auch mit den Fernsehredaktionen zusammenspielen, wie das in der Bonner Republik noch war. Wenn Sie mich fragen, was sich heute geändert hat, dann würde ich doch sagen, es ist anders, ja. Das hängt nicht mit Berlin zusammen, es hängt in der Tat damit zusammen, dass die ganze Politik in Osteuropa eben wieder von vorrangiger Bedeutung wird. Ich meine, es hängt auch damit zusammen, dass diese ganze EU im Grunde stagniert, und zwar in dem Sinne, dass das Ganze ein Staatensystem nach neuen Regeln geworden ist, wo aber die jeweiligen Staaten ihre Interessen im Rahmen der Spielregeln verfolgen, gebändigter, zivilisierter als früher, aber es ist ein Staatensystem. Und das haben die Deutschen langsam erkannt oder beginnen es langsam zu erkennen. Den Franzosen war das immer sehr viel klarer und den Italienern, Briten ohnehin, ohnehin den Kleinen natürlich, die ständig fürchten nun zu versinken da in dieser Mannschaft. Daran gewöhnen sich jetzt auch die Deutschen langsam. Und das ist die eigentliche Veränderung.
Detjen: Helmut Kohl hat mal vor einiger Zeit in einem Aufsatz, den er veröffentlicht hat oder hat veröffentlichen lassen, gesagt, die deutsche Politik habe in diesem Veränderungsprozess, wie er gesagt hat, den Kompass verloren. Würden Sie ihm da zustimmen?
Schwarz: Ich habe ein Buch geschrieben, "Politik ohne Kompass".
Detjen: Was heißt dieser Verlust des Kompasses?
Schwarz: Im Jahr 2004, ich war immer so der Meinung, die Bundesrepublik ist verpflichtet, das Spiel auf verschiedenen Ebenen zu spielen. Sie braucht die Amerikaner, was man bei der Auseinandersetzung mit Russland jetzt wieder sieht oder im Irak, wo die ungeheuren Unfug gemacht haben, aber sie werden natürlich gebraucht, so problematisch sie sind! Die EU muss zusammengehalten werden, weiterentwickelt werden. Man muss Weltpolitik betreiben, nicht umsonst ist Helmut Schmidt der große Popularisator einer engen wirtschaftlichen, aber auch politischen Verbindung zu China. Aber die eigentlichen Praktiker, die das gestaltet haben, das ist Helmut Kohl und das ist Angela Merkel, die ist nämlich dauernd dort, und bemühen sich, diese Komponente mit einzubringen.
Detjen: Wir haben jetzt über Kanzler gesprochen, verschiedene Namen sind gefallen, zwei große Kanzler sind Gegenstände Ihrer großen Werke, Konrad Adenauer, über den wir gesprochen haben, Helmut Kohl, über Brandt gibt es in einem Ihrer Bücher – "Das Gesicht des Jahrhunderts", Porträts von prägenden Figuren des 20. Jahrhunderts – eine sehr freundliche Betrachtung. Lassen Sie uns ein paar Worte zu den anderen Kanzlern sagen! Helmut Schmidt, den viele Deutsche in die Reihe der ganz großen deutschen Kanzler stellen würden, Sie haben eben gesagt: der Popularisierer!
Schwarz: Es gibt zwei Helmut Schmidts. Das eine ist der Politiker, der ein Kanzler der Defensive war. Sie hatten seit 1973 die erste große Weltwirtschaftskrise, am Schluss dann noch die Krise im Ost-West-Verhältnis, hat eine gute Defensivoperation geleistet, ist aber da gescheitert an der eigenen Partei, wie wir wissen, 82. Und dann hat er eine zweite Karriere begonnen als politischer Publizist, also hierin zu vergleichen mit Kissinger, der ja auch nur ein paar Jahre Präsidentensicherheitsberater und dann Außenminister war und dann eine große Karriere als Publizist begonnen hat. Und das macht ihn im Grunde einzigartig in der deutschen ...
Detjen: Fänden Sie Gerhard Schröder als Objekt einer Kanzlerbiografie interessanter?
Schwarz: Schröder würde mich reizen, aber ob ich an das Material rankäme, das weiß ich nicht. Ich meine, Herr Schröder ist ein herrlich ungebremster Machtpolitiker, wie sie in Deutschland eigentlich wenig kommen, fast eine Bismarcksche Figur, auch in den ganzen Wendungen, die er betreibt. Er hat natürlich einen Riesenfehler gemacht, dass er also nach der verlorenen Wahl in Nordrhein-Westfalen das Handtuch geworfen und Neuwahlen gemacht hat, der Kohl wäre sitzen geblieben, hätte abgewartet und hätte wahrscheinlich, als die Konjunktur dann wieder anzog, die Wahlen gewonnen. Aber ich finde Schröder eine interessante Figur!
Detjen: Und dann gehen wir die Reihe durch in die Gegenwart! Angela Merkel, wie würden Sie sagen, können Sie sagen, wie sich Angela Merkel einmal in die Reihe der deutschen Kanzler einreihen wird?
Schwarz: Bei jedem Kanzler kommt es für die Bewertung auch darauf an, wie er endet und wie das dann in den nächsten drei, vier, fünf Jahren weiterläuft, vorher können Sie sich im Grunde kein klares Bild über diese Gestalt machen. Aber sie ist natürlich bemerkenswert!
Detjen: Und es wäre die historische Leistung, als erste Kanzlerin eine geordnete Übergabe des Amtes hinzubekommen!
Schwarz: Das ist noch keinem gelungen. Ist dem Adenauer misslungen, ist dem Kohl misslungen, Schmidt und Brandt kamen gar nicht in die Möglichkeit, das zu tun. Also, im Grunde die beiden bedeutenden Kanzler Adenauer und Kohl, die lange dran waren, die sind dabei gescheitert, alle Erfahrungen sprechen dafür, dass man sehr hoffnungsvoll sein müsste, wenn man meint, dass das Angela Merkel gelingen könnte. Das ist schwer vorstellbar. Die Kanzler scheitern.
Detjen: Die Objekte Ihrer großen Biografien, Ihrer Werke sind – das hat auch was mit der Zeit zu tun – meistens Männer, auch in dem Buch "Das Gesicht des 20. Jahrhunderts", in dem Sie viele biografische Skizzen, kurze Biografien vereinen, kommen hauptsächlich Männer vor, Margaret Thatcher ist die Einzige, wenn ich das richtig sehe, der Sie das Prädikat historischer Größe zubilligen. Was macht das aus? Und würde Angela Merkel für Sie auch in diese Kategorie historischer Größe möglicherweise schon jetzt fallen?
Schwarz: Was die Thatcher angeht, da lässt sich sagen ... Ich kannte England ganz gut, das war also wirklich in einem tiefen Loch seit den frühen 70er-Jahren. Und sie hat da nun zweifellos grausam, aber entsprechende Reformen doch durchgezogen. Wie es sich langfristig ausgewirkt hat, ist eine Frage für sich. Als Reformerin ist Angela Merkel ja nicht nur gerichtsnotorisch geworden bisher. Aber sie ist eine bewundernswert kühle, ruhige Managerin der Macht.
Sprecher: Qualitätsunterschiede deutscher Universitäten und die erfreuliche Arbeit mit Studenten.
Detjen: Herr Professor Schwarz, lassen Sie uns über das Umfeld sprechen, in dem Sie geforscht haben, in dem Sie gearbeitet haben! Es hat sich bewegt in Universitäten, aber auch in Institutionen, da steht natürlich an erster Stelle die Universität. Und aus heutiger Sicht muss man wohl sagen, das ist die Universität, die deutsche Universität, an der Sie unterrichtet haben, ist die Vor-Bologna-Universität, schon fast selbst wieder Gegenstand geschichtlicher Betrachtungen. Eine vergangene Epoche deutscher akademischer Geschichte?
Schwarz: Ich meine, ich bin der Sohn eines Lehrers, der begeisterter Lehrer war, ein guter Lehrer. Und irgendwie hat es mir immer am meisten Spaß gemacht, mit Studenten zu arbeiten! Also, die Universität, die ganzen Streitigkeiten, die Sie in Fakultäten haben und, und, und, ist überhaupt für einen Professor nur ein erträglicher und schöner Platz, weil Sie mit Studenten arbeiten! Das ist der eigentliche Witz der Sache. Und da gibt es nun mal verschiedene Modelle. Ich meine, ich habe die alte Ordinarienuniversität kennengelernt, die war nicht so gut, wie die Ordinarien gemeint haben, aber nicht so schlecht, wie die Studenten, also die 67er-, 68er-Studenten gemeint haben. Sie war vor allem nicht mehr in der Lage, mit der Massenuniversität fertig zu werden. Ich habe die Reformuniversität kennengelernt, das war so in der munteren Zeit zwischen 67 und 73, 74, war ich Ordinarius in Hamburg, war einer der Professoren, die also, ich meine, das war immer eine Riesengaudi, das war eine junge Universität, die Hamburger Universität ist erst nach dem Ersten Weltkrieg gegründet worden, die mussten natürlich dann ähnlich wie die uralten Universitäten wie Heidelberg und Tübingen und, und, und, mussten die auch Talare haben, dann haben sie also die Hamburgischen Hauptpastoren zum Vorbild genommen, mit Halskrausen. Also, es war eine Kostümierung ohnegleichen. Also, diesen ganzen Spaß habe ich erlebt, unter den Talaren der Muff von 1000 Jahren. Die Studenten, die waren anfangs gar nicht schlecht, das waren so linke Sozialdemokraten, Reformdemokraten, eigentlich fast gar nicht marxistisch. Die Marxisten kamen dann erst so ab 1970/1971, wurden teilweise geschult an Wochenenden in der DDR, dümmliche Leute meistens aus der pädagogischen Fakultät, und das war nicht sehr erfreulich. Und die ganze Reformuniversität hat mir entsetzlich viel Zeit gefressen und war also ziemlich unproduktiv. Meine Sorge war immer, dass schon diese Gruppenuniversität in den Jahren 67 bis 73/74 doch die Verwaltung sehr gestärkt hat, und im Grunde ist dann dieser ganze Bologna-Prozess im Wesentlichen ja von der Verwaltung, Politik und Verwaltung durchgesetzt worden gegen zu geringen Widerstand der Fakultät. Ich möchte heute nicht mehr Student sein in so einem Magisterkurzstudium!
Detjen: Was heißt das für Ihre Wissenschaft, für die Zeitgeschichtsforschung in Deutschland, welche interessanten Wissenschaftler sehen Sie da, welche interessanten Entwicklungen beobachten Sie da heute?
Schwarz: Der ganze Betrieb ist entsetzlich bürokratisiert. Die Studenten sind natürlich sowohl in der Geschichte wie in der politischen Wissenschaft auch ein Problem, die haben es auf den Schulen schon gelernt, fast nur noch mit dem Internet zu arbeiten, lesen wenig. Auch da gilt es wieder wie für die Wissenschaftler: Unter großen Mengen finden Sie immer wieder jede Menge Edelsteine und Goldkörner. Aber wie soll ich sagen, die Holzwolle, in der nun also diese Edelsteine und Goldkörner verpackt sind, die ist doch also sehr, sehr groß!
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.