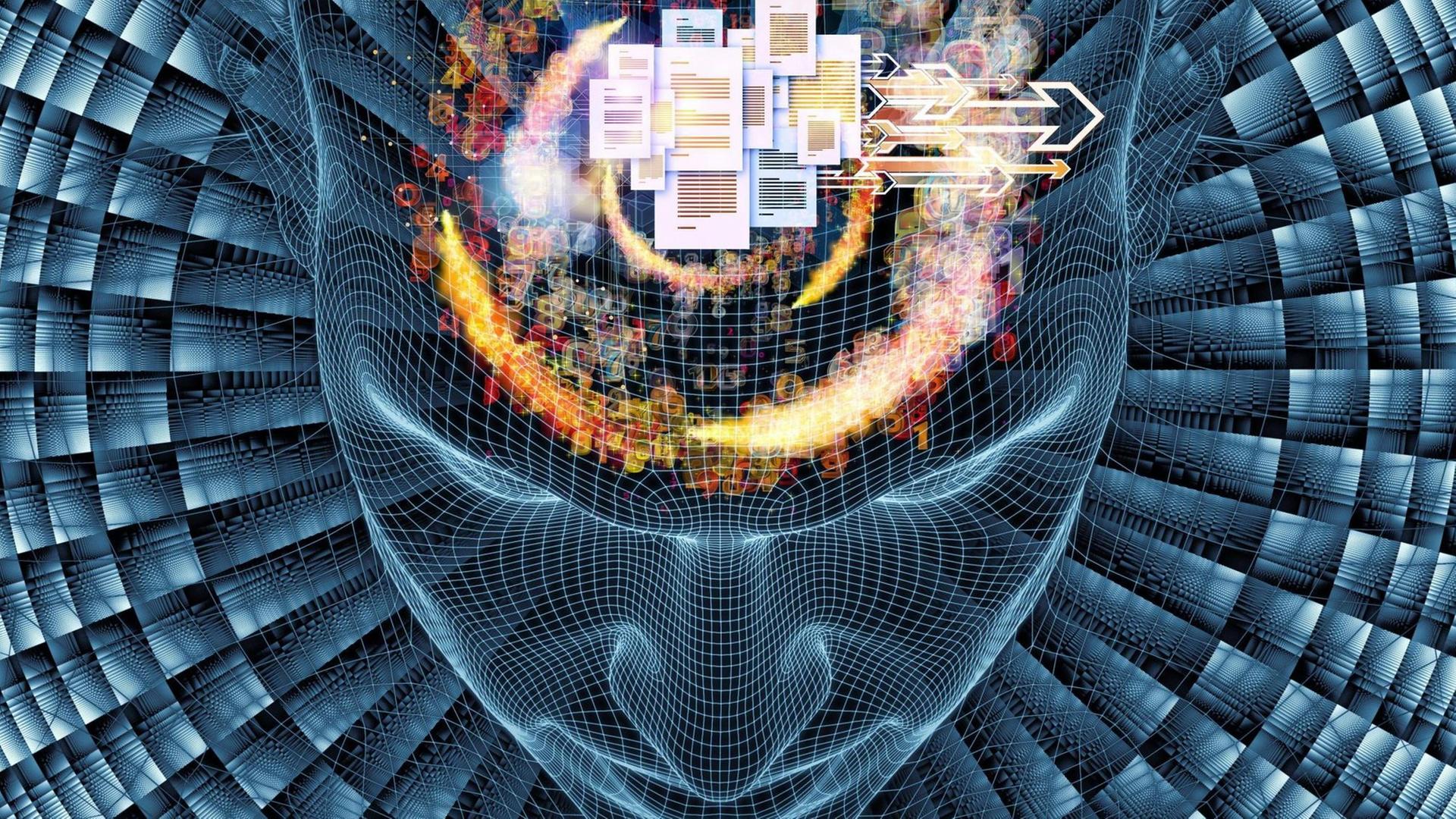
Julia Macher: Diego Redolar, wenn ich mich mit Konsole oder Joystick vor den Bildschirm setze: Zu was mutiere ich dann am ehesten – zur unbesiegbaren Heldin, die sich mit Superkräften durch fantastische Welten kämpft – oder zum Zombie?
Diego Redolar: Je nachdem, wie du das Spiel nutzt, kannst du dich entweder in das eine oder in das andere verwandeln. Wenn du wegen des Videospiels andere Tätigkeiten wie Sport oder Treffen mit anderen Menschen versäumst, dann kannst du vereinsamen. Die Gefahr gibt es vor allem bei Online-Spielen, in denen man sich ein soziales Netz aufbaut, das lediglich aus Mitspielern besteht und nicht aus Menschen, mit denen man auch in der Realität interagiert. Das könnte dich tatsächlich zum Zombie machen.
Macher: Gerade in Familien mit Kindern ist das zur Zeit ein großer Streitpunkt. Wie viel Stunden Bildschirm darf sein? Ein, zwei Stunden am Tag? Ein, zwei Mal in der Woche? Gibt es da so etwas wie eine goldene Regel?
Redolar: Wichtiger als die Frage nach dem "Wie viel?" ist die Frage, ob die Kinder deswegen auf andere Tätigkeiten verzichten. Wenn sie wegen der Computerspiele aufhören, rausgehen zu wollen, aufhören, sich mit ihren Freunden zu treffen oder zu lesen – dann ist das nicht gut. Wenn sie aber weiter auch anderes tun wollen, was essenziell für ihre Entwicklung ist – Sport zum Beispiel stimuliert das Wachstum der Neuronen im Hippocampus – dann sind zwei Stunden an der Konsole oder am Computer kein Problem.
"Die Industrie hat das Belohnungsprinzip perfektioniert"
Macher: Wenn ich meinen Sohn vor die Wahl stelle "Tablet oder Mensch-ärgere-dich-nicht", entscheidet er sich garantiert fürs Erste. Sie leiten in Barcelona ein Forschungsprojekt, in dem Sie mit Ihrem Team erkunden, was beim Videogaming im Gehirn passiert. Was macht das digitale Spiel denn so viel attraktiver als analoge Spiele?
Redolar: Computerspiele sind so entworfen und designt, dass sie uns gefallen, dass wir sie als beglückend, als belohnend empfinden. Wenn wir ein Gehirn im Ruhezustand beobachten, sehen wir, sobald jemand zockt, wie die neuronalen Netze, die für Verstärkung und Belohnung zuständig sind, aktiviert werden. Das passiert bei Gesellschaftsspielen auch, allerdings lange nicht so stark. Denn hinter den Computerspielen steckt eine mächtige Industrie, die dieses Belohnungsprinzip in den letzten Jahren perfektioniert hat. Dazu kommt die kognitive Ebene: Die heutigen Computerspiele ermöglichen – zum Beispiel bei Sport- oder Shooter-Spielen – räumliches Erleben und Interaktion mit der Umgebung. Das aktiviert Gehirnregionen, die von anderen Spielen einfach nicht stimuliert werden können.
Macher: Was macht das mit meinem Gehirn? Ändert es sich dadurch?
Redolar: Ja. Wir haben 2017 in einem Forschungsprojekt alle vorhandenen Studien zu dem Thema ausgewertet und gesehen, dass es tatsächlich einen Zusammenhang zwischen der kognitiven und neuronalen Ebene gibt: Die Gehirnregionen, die wichtig sind für Konzentration, räumliches Begreifen oder Erinnerung, funktionieren anders, wenn jemand spielt. Überrascht haben uns vor allem die strukturellen Änderungen, also die Tatsache, das neue Verbindungen zwischen einzelnen Gehirnregionen entstehen oder sich die Größe mancher Bereiche verändert. Das zeigt, wie wichtig Videospiele beim Gehirntraining sein können.
Suchtverhalten wie bei Kokainabhängigen
Macher: Welche Bereiche wachsen denn beim Spielen?
Redolar: Es gibt Studien, die zeigen, dass dreidimensionale Games, in denen sich die Spieler in einem Raum orientieren müssen, das Wachstum des Hippocampus stimulieren, also jenen Bereich, der mit für das Gedächtnis verantwortlich ist. Auch der sogenannte dorsolaterale präfrontale Kortex, ein Teil des Frontallappens der Großhirnrinde, ändert seine Struktur: Das ist der rationalste Teil unseres Gehirns. Diese Region ist sehr wichtig für die kognitive Kontrolle oder für Entscheidungsfindungen.
Macher: Das klingt alles ziemlich gut, Computerspiele können die Leistungen des Gehirns fördern. Was spricht denn dann gegen hemmungsloses Daddeln?
Redolar: Wenn man alles in die Waagschale wirft, glaube ich tatsächlich, dass das Positive überwiegt. Aber alles hat zwei Seiten: Wir haben nämlich auch gesehen, dass sich die Struktur des Belohnungszentrums und damit das Suchtverhalten ändern kann – und zwar in der gleichen Weise, wie das bei Kokainabhängigen passiert. Deswegen gilt Game-Sucht inzwischen ja auch als anerkannte Krankheit.

Macher: Wäre es theoretisch nicht möglich, das zu trennen? Also Computerspiele zu entwerfen, die das Gehirn trainieren, aber nicht süchtig machen?
Redolar: Das ist so gut wie unmöglich. Denn das Belohnungsprinzip ist ja für den Lernprozess notwendig. Je mehr man auf die – potenziell süchtig machende – Aktivierung des Belohnungszentrums abzielt, desto stärker entwickeln sich die kognitiven Fähigkeiten. Das ist auch der Grund, warum viele klassische Gehirntraining-Programme gescheitert sind. Sie motivieren einfach nicht genug: ohne Suchtpotenzial kein Lernerfolg.
Warum aber letztendlich manche Menschen süchtig werden, andere nicht: Das ist eine der großen neurobiologischen Forschungsfragen. Zum einen hat es vermutlich mit den Genen zu tun, zum anderen mit der Umgebung oder möglichen traumatischen Erlebnissen. Sucht ist ein komplexes Phänomen, bei dem sehr viele Faktoren eine Rolle spielen.
"Unsere Gehirne werden garantiert anders aussehen als jetzt"
Macher: Laut einer Studie von 2018 spielen Jugendliche in Deutschland im Durchschnitt 103 Minuten an Computer, Tablet oder Handy, in Spanien sind es ein paar Minuten mehr – Tendenz steigend. Wenn sich durch das Gaming tatsächlich die Gehirne verändern: Wie sehen unsere Gehirne dann in 50, 60 oder 100 Jahren aus?
Redolar: Das ist eine sehr spannende Frage. Denn unser Nervensystem und vor allem die Großhirnrinde sind extrem plastisch: Die einzelnen Bereiche können ganz unterschiedliche Funktionen einnehmen. Bei den Digital Natives sind zum Beispiel die Bereiche, die Daumen und Zeigefinger koordinieren, stärker repräsentiert. Sie haben mehr Neuronen, die dafür zuständig sind. Warum? Einfach, weil sie diese beiden Finger häufiger benutzen. In 50 Jahren wird der Gebrauch der neuen Medien zwar nicht die Evolution verändert haben – es dauert sehr lange, bis sich erworbene Fähigkeiten im Erbgut niederschlagen oder bis es tatsächlich zu einer Selektion kommt. Aber unsere Gehirne werden garantiert anders aussehen als jetzt.
Macher: Wenn wir uns immer mehr in digitalen Welten bewegen, werden wir die reale Welt dann überhaupt noch brauchen? Schon jetzt scheint ja beides immer mehr zu verschmelzen, indem Computerspiele mit Sensoren arbeiten und die virtuellen Welten immer echter werden.
Redolar: Ich glaube, dass kann tatsächlich zur Gefahr werden. Wenn wir, statt im Wald spazieren zu gehen, uns aus Zeitmangel oder Faulheit im Wohnzimmer einschließen und den Waldspaziergang lieber virtuell erleben, haben wir ein Problem.
"Nur im Kontakt mit der Wirklichkeit funktioniert das Gehirn"
Macher: Mehr Kontakt mit der wirklichen Welt – das fordern inzwischen eine ganze Reihe Kultur- und Naturwissenschaftler. Warum ist es denn so wichtig, einen echten Baum zu berühren, wenn der virtuelle sich – fast – genauso gut anfühlt?
Redolar: Das ist evolutionär bedingt. Viele der neuronalen Netze, die wir als Wissenschaftler erforschen, viele unserer kognitiven Funktionen, versteht man nur im Zusammenhang mit der Entwicklung der Menschheit. Unsere Gehirnstruktur ist Ergebnis der Lebensbedingungen unserer tierischen Vorfahren und hat sich in hunderttausenden Jahren in Reaktion auf die Umwelt entwickelt. Das heißt im Umkehrschluss: Nur im Kontakt mit der Wirklichkeit funktioniert das Gehirn richtig.
Macher: Sie selbst verbringen berufsbedingt eine Menge Zeit in der Gaming Welt. Merken Sie auch bei sich selbst das Suchtpotenzial – oder kommen Sie ganz problemlos wieder zurück in die wirkliche Welt?
Redolar: Ich bin eigentlich kein klassischer Gamer. Ich habe als Kind zwar auch gespielt, aber sehr gemäßigt, vielleicht einmal die Woche. Mein Interesse an digitalen Spielen ist rein beruflich. Das fing mit einer Doktorarbeit an, und sukzessive haben wir dann unseren – damals noch ziemlich neuartigen – Forschungsschwerpunkt aufgebaut. Was mich dabei am meisten beeindruckt hat, sind übrigens gar nicht die neuronalen oder funktionalen Auswirkungen des Computerspielens auf unser Hirn, sondern die Gaming-Welt an sich: die Industrie, die sich dahinter verbirgt, der Einfluss der Profis, die gigantischen Follower-Zahlen, die manche Gamer haben. Das Phänomen, das auf YouTube Hunderttausende zugucken, wie andere zocken, ist faszinierend. Was da im Gehirn der Zuschauer passiert – das wäre einmal eine eigene Forschung wert!
Äußerungen unserer Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.

