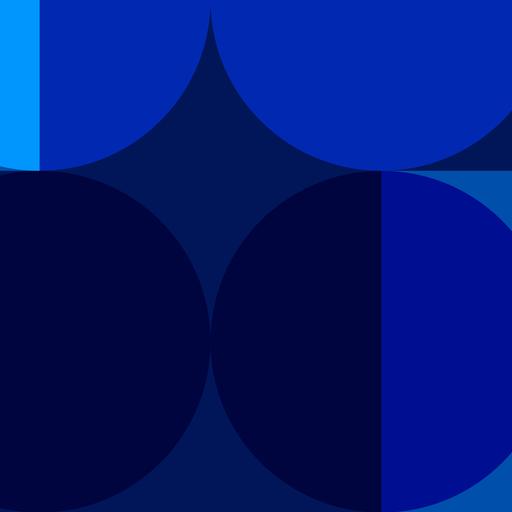In der Wildwestbar in Kalgoorlie steppt fast jeden Abend das Känguru. Musik hämmert im Halbdunkel, die Gäste brüllen dagegen an. Die Luft ist testosterongeschwängert und riecht nach dem billigen Parfüm, das man sich in der Männertoilette aus dem Automat aufsprühen lassen kann. Caitlin, eine der drei "Skimpies of the week", der Barmädchen der Woche, wirbelt hinter der Theke und durch den Raum. Sie lässt die dünnen Fähnchen, die sie am Leib trägt, gern mal verrutschen und ist zu jedem der Männer frech und nett.
"Ich laufe hier rum, schenke Bier aus, zeige mich im Bikini und kassiere gute Trinkgelder. In der Bar nebenan gehe ich auch mal oben ohne, hier nicht. Wir sind so eine Art Barmädchen und schaue, dass die Jungs genügend trinken. Harte Arbeit, aber es bringt Geld. Und genau dafür mache ich es."
Die Jungs schielen sich die Augen aus dem Kopf, lassen ihre Finger aber bei sich. Ein "Skimpy" anzufassen, zieht sofortiges Lokalverbot nach sich. Sonny, der bullige Türsteher, tritt dann in Aktion. Er hat es jeden Abend mit einem unterschiedlichen Publikum zu tun.
"Du weißt nie, wer so auftaucht, die Arbeiter in den Minen wechseln häufig. Dann sind da Jungs, die kommen nach vier Wochen aus dem Busch zurück. Vier Wochen lang haben die nur Bäume und Dreck gesehen. Jetzt sind sie wieder in der Zivilisation und wollen sich nur noch die Kante geben. Am Mittwoch ist Zahltag, da kommen die meisten und dann sind sie oft schnell bei der Sache. Ich hatte ein paar Prügeleien - aber nichts Ernsthaftes. Bei diesem Job geht es mehr ums Reden als um Action. Und die körperliche Präsenz macht natürlich auch einiges aus."
Sonny kam vor sechs Monaten aus Sidney nach Kalgoorlie. Den Job an der Tür betrachtet er nur als Übergangslösung.
"Jeder hier will in den Minen arbeiten. Ich will da auch hin. Ich arbeite nur solange als Türsteher, bis ich die nötigen Unterlagen zusammenhabe. Aber viele Leute haben die Arbeitslizenz und finden trotzdem keinen Job. In dieser Branche hängt alles von Beziehungen ab. Du musst jemand kennen, der wieder jemand kennt, und so weiter. Auch darum stehe ich gerne an der Tür. Hier findest du dauernd neue Kontakte."
Fast jeder in Kalgoorlie will in die Mine. Die Stadt lebt vom gelben Metall, und sie lebt gut davon. Bungalows aus Backstein säumen die Einfallstraße, große Vierradfahrzeuge stehen in den Auffahrten. Und die mit 24-karätigem Gold ummantelte Spitze des Rathausturms signalisiert weithin: Hier ist Geld zuhause.
Begonnen hatte das alles vor etwa 120 Jahren, 180 Kilometer weiter südlich, im heutigen Norseman. Die rote Erde ist schütter mit Akazien- und Eukalyptusbäumen bestanden, von einem Hügel schweift der Blick über ein paar Straßen mit heruntergekommenen Häusern und eine Goldgrube, in der derzeit niemand arbeitet.
Angeblich hatte in dieser gottverlassenen, ausgedörrten Gegend jemand ein paar Goldkörner gefunden, erzählt Jec Eerbeek, der für die westaustralische Regierung arbeitet und die Geschichte kennt wie nur wenige. Und nun, wir schreiben das Jahr 1892, waren ein paar Kerle unterwegs, um herauszufinden, was es damit auf sich hatte.
"Einer der Goldsucher und seine Freunde machten am Fuß dieses Hügels Halt. Sie banden ihre Pferde an einen Baum, bauten das Zelt auf und verbrachten die Nacht dort. Als sie am nächsten Morgen aufbrechen wollten, sahen sie, dass eines der Pferde den Boden aufgescharrt hatte - und da lag ein großes Nugget. Sie staunten nicht schlecht: Das war mehr, als sie sich je erträumt hätten. Und deshalb heißt diese Stadt hier Norseman - sie wurde nach dem Pferd benannt."
Doch Norsemans Blütezeit dauerte nur kurz. Schon bald galt ein Gebiet um das heutige Coolgardie, 170 Kilometer weiter nördlich, als das neue Eldorado. Und plötzlich machten sich Glücksritter aus dem ganzen Kontinent und der halben Welt auf den Weg, viele gezeichnet von einer fast unheilbaren Krankheit: Sie hatten Goldfieber. In Perth im Westen und in Esperance im Süden gingen sie an Land und machten sich auf den mehrere hundert Kilometer langen Weg ins Innere.
"Viele von ihnen gingen zu Fuß. Andere kauften eine Schubkarre oder bauten sich selbst eine aus altem Holz. Man musste Wasser mitnehmen, unterwegs gab es das kaum. Manche kauften sich Pferde, aber auf den Goldfeldern war Wasser so teuer, dass man Pferde einfach nicht versorgen konnte. Später versuchte man es mit Kamelen. Wenn man heute durch die Städte hier kommt, findet man diese großen, breiten Straßen. Sie wurden so gebaut, damit man mit Kamelen umkehren konnte, denn Kamele gehen nicht rückwärts."
Die Männer stellten Zelte auf oder Hütten aus Holz und Sackleinen. Und machten sich mit Schaufel, Hacke und einem Rüttelsieb an die Arbeit. Sie wurden reichlich fündig. Die Gerüchteküche dampfte und aus dem Nichts entstand eine Stadt. 1898 zählte Coolgardie bereits 15.000 Einwohner. Es gab 26 Hotels, 60 Läden, drei Brauereien, mehrere Kirchen und eine Rennbahn.
Es waren die Jahre der Wanderschaft. Und nicht nur Goldsucher waren unterwegs. Auch Schafscherer, Saisonarbeiter, Tramps gehörten zu jener Armee der Heimatlosen, von denen die inoffizielle Nationalhymne Australiens erzählt.
Heute fällt es schwer, sich dieses quirlige Leben vorzustellen. Einzelne Gebäude reihen sich an der Hauptstraße: das Gericht, verlassene Geschäfte mit blinden Scheiben, die schneeweiße Fassade des "Marvel"-Hotels. Bis 1927 war es in Betrieb, informiert ein Schild. Und es war höchst beliebt: Das Essen schmeckte, jeder Gast war willkommen, unabhängig von seiner Kleidung, und hatte einer der Männer mal lange kein Glück mehr gehabt, gab es eine Mahlzeit auf Kosten des Hauses.
Besonders eindringlich erinnert der Friedhof von Coolgardie an die große Zeit des Goldrausches: 1108 Menschen wurden hier Ende des 19. Jahrhunderts begraben, viele davon anonym.
Besonders eindringlich erinnert der Friedhof von Coolgardie an die große Zeit des Goldrausches: 1108 Menschen wurden hier Ende des 19. Jahrhunderts begraben, viele davon anonym.
"Hier liegen viele der frühen Pioniere, die leider oft schon ganz jung gestorben sind, nach einem kurzen und verdammt harten Leben. Die ersten wurden 1897 begraben. Durst war ein großes Problem, und Krankheiten. Manche starben auch, wie es heißt, an Verzehr - sie haben sich mit Methylalkohol vergiftet."
Gold zu schürfen, war Knochenarbeit, eine üble Schinderei. Und die Verpflegung war miserabel.
"Manchmal gab es Fleisch, Känguru war das meist. Aber das Grundnahrungsmittel war Mehl, aus dem machte man Brot, oder Damper, das ist Buschbrot. Gemüse bekam man fast gar nicht, das musste teuer aus Perth hergebracht werden. Es ging wirklich sehr, sehr einfach zu: Mehl, Wasser, Reis - das war es. Dazu kam, dass das Wasser oft sehr verdreckt war. Es kam zu Typhus und Ruhr - kein Wunder, dass viele sehr früh starben."
Eine der Grabstätten trägt neben den lateinischen Buchstaben ganz unbekannte Schriftzeichen.
"Das ist ein afghanischer Grabstein. Der Mann, steht hier, starb durch die Hand eines Mörders in Coolgardie im Jahr 1896 und er wurde 35 Jahre alt. Offenbar gab es da Streit zwischen ein paar Leuten in der Stadt und gerade ihn mochte man nicht so besonders. Und dann hat jemand ihn umgebracht."
Es gab Menschen, die litten gewaltig unter der Ankunft geschätzter 50.000 Abenteurer. Doc Reinolds ist Aborigine vom Volk der Noongar. Seine Leute, die seit Zehntausenden von Jahren in diesem Land lebten, wurden von der Invasion der Glücksritter richtiggehend überrannt.
"Aus allen Ecken Australiens kamen sie, aber auch Chinesen und Afghanen waren darunter. Und das brachte eine Menge Konflikte mit sich. Die Aborigines hier hatten einen sehr natürlichen Lebensstil und trugen selten Kleidung. Als die Goldsucher kamen und die attraktiven, nackten, jungen Frauen sahen, wollten sie sie haben. Es kam zu heftigen Kämpfen mit den Männern. Außerdem brachten die Weißen Alkohol - und Alkohol hat bekanntlich eine zerstörerische Wirkung auf Aborigines. "
In Esperance, an der Südküste, gibt es eine Bucht namens Hellfire - Höllenfeuer. Die Weißen benannten sie nach den blauen St.-Elmos-Feuern an den Mastspitzen von Schiffen. Die Aborigines haben einen anderen Namen dafür.
"Die Leute meines Vaters, im Westen, nennen den Platz Kokona-Massaker. Hier hatten die Weißen einige Aborigine-Männer in einen Schuppen gesperrt und vergewaltigten dann ihre Frauen. Eines Nachts konnten die Frauen fliehen, sie befreiten ihre Männer und die töteten einen der Weißen. Als Vergeltung brachten die jedes Kind und jede Frau um - daher: Kokona Massaker."
Auch in Coolgardie war nach kurzer Zeit alles Glitzernde und Schimmernde aufgehoben und ausgegraben. Die Karawane zog weiter, sie zog nach Kalgoorlie.
"25.000 Menschen leben heute in Kalgoorlie, was für eine ländliche Gegend in West-Australien eine Menge ist. Aber in den großen Zeiten, vor hundert Jahren, waren es mindestens doppelt so viele. Kalgoorlie sieht aus wie eine Wildweststadt: Schöne breite Straßen. Und die meisten Gebäude stammen noch aus den 1890er-Jahren. Der Preis von Gold variiert ja stark, man kann schlecht planen. Deshalb rissen viele Leute ihre alten Häuser lieber nie ab, sondern behielten sie - und das Ergebnis ist diese schöne alte Stadt."
Beiderseits der Hannan Street sind die Häuser mit viktorianischen Erkern, Türmchen und Kuppeln verziert. Filigrane Ziergitter säumen luftige Veranden, gusseiserne Säulen stützen Vordächer aus Blech. Aber die Stadt ist kein Freilichtmuseum. Banken, Cafés und Geschäfte haben in den schattigen Arkaden geöffnet. Und der Treibstoff der städtischen Wirtschaft ist immer noch Gold. Oder genauer: Die Mine, in der Türsteher Sonny und viele andere so gern arbeiten würden. Australiens "Golden Mile". Der Superpit.
"Die größt Mine hier heißt KCGM. Diese Firma kaufte eine Menge kleiner Minen auf und beschloss, künftig nicht mehr unterirdisch zu graben. Stattdessen hoben sie ein gigantisches Loch aus - und dieses Loch heißt Superpit."
Wie ein riesiger Bombentrichter liegt der Superpit am Rand von Kalgoorlie: Vier Kilometer lang, zwei Kilometer breit und 600 Meter tief. Besucher können sich einer geführten Bustour anschließen.
Zu Terrassen geformt, fallen die Wände schräg ab, am Grund tummelt sich eine abwechslungsreiche Sammlung von Matchbox-Fahrzeugen. Beim Näherkommen entpuppen sie sich als gigantische Schaufellader, LKW und Bohrmaschinen. June, die den Bus lenkt, erklärt, wofür sie da sind.
"Sie bohren zehn Meter tiefe Löcher in den Fels, jedes drei Meter vom nächsten entfernt. In jedes Loch wird sechseinhalb Meter hoch Sprengstoff gefüllt, darauf kommt Dämmmaterial. Man sprengt nicht an jedem Tag zur gleichen Zeit - es ist immer vom Wind abhängig. Wenn er in Richtung Kalgoorlie weht, geht das nicht. Wenn er richtig steht, wird die Sprengung eine Stunde vorher angezeigt. Und dann kracht es pünktlich."
Die gewaltigen LKW transportieren das Erz nach oben. Im Schritttempo kriecht der Bus zwischen Gesteinshalden und Förderbändern mit Abraum dahin. Matt, der die Touren veranstaltet, hat ein paar imponierende Zahlen zum Maschinenpark parat.
"Jeder dieser LKW kostet viereinhalb Millionen Dollar. Jeder hat acht Reifen, jeder Reifen kostet allein 38.000 Dollar. Vierzig LKW gibt es und jeder trägt bis zu 250 Tonnen Gestein. Dann haben sie Raupen, die bewegen rund 200.000 Tonnen Fels am Tag. Und aus denen gewinnt man etwa 2000 Unzen Gold - rund 68 Kilogramm."
In der "Fimistone Mill" wird es laut. Riesige Trommeln zermahlen das Erz zu immer kleineren Brocken und schließlich zu Staub. Immer komplizierter erscheinen die Anlagen, eine Abfolge von Tanks und Röhren, Ventilen, Gestänge und Öfen. Hier wird das Gold unter Zugabe von Chemikalien vom Stein gelöst und eingeschmolzen.
Es gibt einige Sportvereine in Kalgoorlie, aber das beliebteste Freizeitvergnügen ist immer noch das traditionellste: Wer auf sich hält, zieht am Wochenende hinaus und schürft nach Gold. Matt Cook von "findersXkeepers" in der Hannan-Street hat alles auf Lager, was ein Prospektor, ein Goldsucher, braucht:
"Wir verkaufen hier die allerbeste Ausrüstung - verschiedene Modelle, je nachdem, was die Leute ausgeben wollen. Metalldetektoren gibt es zum Beispiel von 1000 Dollar abwärts. Und wir haben auch alles andere: Tragegurte, Hacken, Schaufeln. GPS-Geräte, Landkarten, Hämmer - einfach alles, was da draußen nötig ist."
Matt zieht an Wochenende auch selbst los. Er wird immer wieder fündig. Und es ist jedes Mal eine Art Höhenflug.
"Es ist eigentlich egal, ob groß oder klein: Wenn du ein Stück Gold findest, das schon über zwei Milliarden Jahre in der Erde gesteckt hat und du überlegst, dass hier schon Dinosaurier darübergelaufen sind. Dann gräbst du es aus und bist der erste Mensch, der es je zu Gesicht bekommen hat. Du fühlst das Gewicht in deinen Händen und guckst darauf - das ist schon ein tolles Gefühl. Je größer das Stück, desto besser, klar - aber ich kann mich eigentlich nicht beklagen."
Wer Glück hatte und seine goldene Ernte versilbern will, ist ein paar Türen weiter an der richtigen Adresse. Lecky Mahoney kauft und verkauft Edelmetall.
Umstandslos holt die freundliche Blondine eine 20 Zentimeter lange, goldgelb schimmernde Kruste hervor. Einer ihrer 4000 Lieferanten hat das Nugget heute Morgen gebracht. Mit 35.000 Dollar in bar, etwa 22.000 Euro, spazierte er fröhlich zur Tür hinaus. Die Händlerin hat schon viele Finder erlebt, glückliche - und andere.
"Manche Leute werden total aufgeregt und trinken eine Menge. Andere sind ganz still und verraten niemand etwas, denn große Nuggets bedeuten immer große Probleme. Plötzlich behauptet jeder: Das gehört mir, der hat auf meinem Boden geschürft, immer heißt es: Meins, meins, meins. Manchmal fahren welche heimlich den Findern hinterher, um die Fundstelle zu entdecken - Gold bringt die schlimmsten Seiten der menschlichen Natur ans Licht. Viele Leute können sich einfach nicht für andere freuen."
Wenn die Prospektoren früher den Boden oberflächlich durchwühlt hatten, zogen sie weiter. Ihnen folgten kapitalkräftige Minenunternehmen, die mit schwerem Gerät tiefer buddelten. Im Lauf von zehn Jahren schossen in der Gründerzeit rund um Kalgoorlie etwa 50 Städte in die Höhe. Fast alle sind sie verschwunden, oder nur noch geisterhafte Ruinen.
So wie Gwalia etwa, 150 Kilometer nördlich von Kalgoorlie. Herbert Hoover, der spätere Präsident der USA, war hier Chef der Mine. 1898 holte er italienische Arbeiter ins Land. Sie lebten in einer Siedlung aus Wellblechhütten, die immer noch erhalten ist. Mopeds und Schubkarren lehnen an den wackligen Wänden, Messer und Teller stehen noch auf den Tischen.
"Der Ofen ist in einem Extrabereich in die Wand eingelassen. Man hatte damals eine Riesenangst vor Feuer - und wenn der Ofen mitten im Raum stand, konnten immer mal Funken fliegen und das Haus in Brand setzen. In der Küche sehen wir einen schmalen Tisch mit zwei Bänken - alles aus Abfallholz gezimmert. Das Regal steht auf Ölkanistern - alles, was irgendwie noch brauchbar war, hat man verwertet, weil das billiger war, als etwas Neues in der fernen Stadt zu kaufen."
Nach Norden zu verschwinden die Bäume. Rote, von Büschen grün beflockte Erde, erstreckt sich bis zum Horizont. 90 Kilometer sind es bis Kookynie (Kakuni). In Kookynie wohnen heute acht Menschen, um 1900 waren es 2300.
Margret Pusey betreibt mit ihrem Mann Kevin das "Grand Hotel". Es hat bessere Zeiten gesehen, aber wer aus dem heißen Outback in die glitzernde Bar mit dem ausgestopften Krokodil tritt und sich ein kühles Bier zapfen lässt, glaubt sich erst mal im Paradies angekommen. Margret ist 72 und führt seit über 30 Jahren das Zepter. Gefürchtet hat sie sich nie hier draußen - außer, wenn das Wetter verrückt spielt.
"Immer wenn mein Mann verreist, gibt es ein Gewitter. Heftiger Wind, Donner, Blitze. Aber ansonsten geht es bei uns meistens recht ruhig zu. Wir hatten nie einen großen Überfall - nur ein paar kleine. Viele Aborigines schauen gern bei uns vorbei. Ich habe sie alle aufwachsen sehen, darum habe ich auch nie Probleme. Wenn jemand betrunken ist, kommt er nicht rein - basta! Und sie respektieren alte Frauen mit weißem Haar."
Es waren schöne Jahre hier. Aber jetzt wollen sie das Hotel verkaufen.
"Ich habe genug. Ich bin jetzt 72 und arbeite jeden Tag von halb fünf Uhr morgens bis zehn Uhr nachts - das ist lang. In aller Frühe werfe ich den Generator an. Einmal in der Woche kriegen wir neue Vorräte. Der LKW-Fahrer stellt unsere Waren an die Straße, und wir müssen sie dann abholen. Früher, in den 60ern, kam ja der Zug noch jeden Tag - das war die größte Abwechslung am Tag."
Und dann kommt natürlich auch hier irgendwann die Rede auf Gold. Margret holt aus einer ihrer Schubladen eine messingfarbene, abgeplattete Kugel hervor.
"Das nennt man einen Button, einen Knopf, das ist eine Unze Gold. Er war ein Hochzeitsgeschenk. Ein alter Goldgräber saß da drüben an der Bar und ich sagte: Pit, wir werden bald heiraten. Er zog einen Beutel aus der Tasche, und wie in einem Western schubste er das Stück Gold über die Theke und sagte: Hier, das ist dein Hochzeitsgeschenk."
Go for the gold, hieß es, für Zehntausende von Männern. Und sie fanden es - oder auch nicht. Gold ist der Stoff, der seit über hundert Jahren das Leben hier prägt und von dem die Menschen so viele verrückte, abstoßende und rührende Geschichten erzählen. Gold - wen es einmal hat, den lässt es nie mehr los.