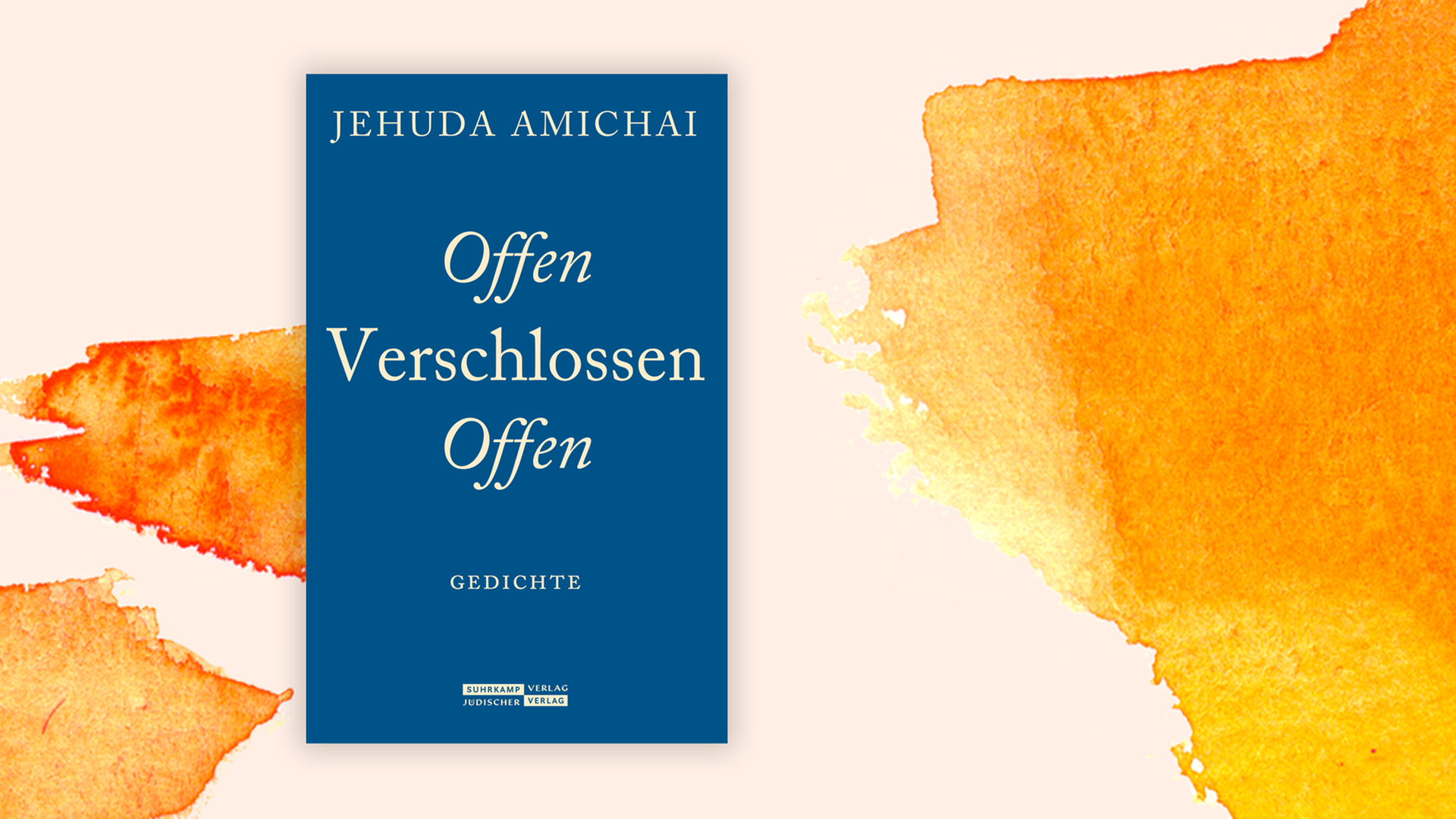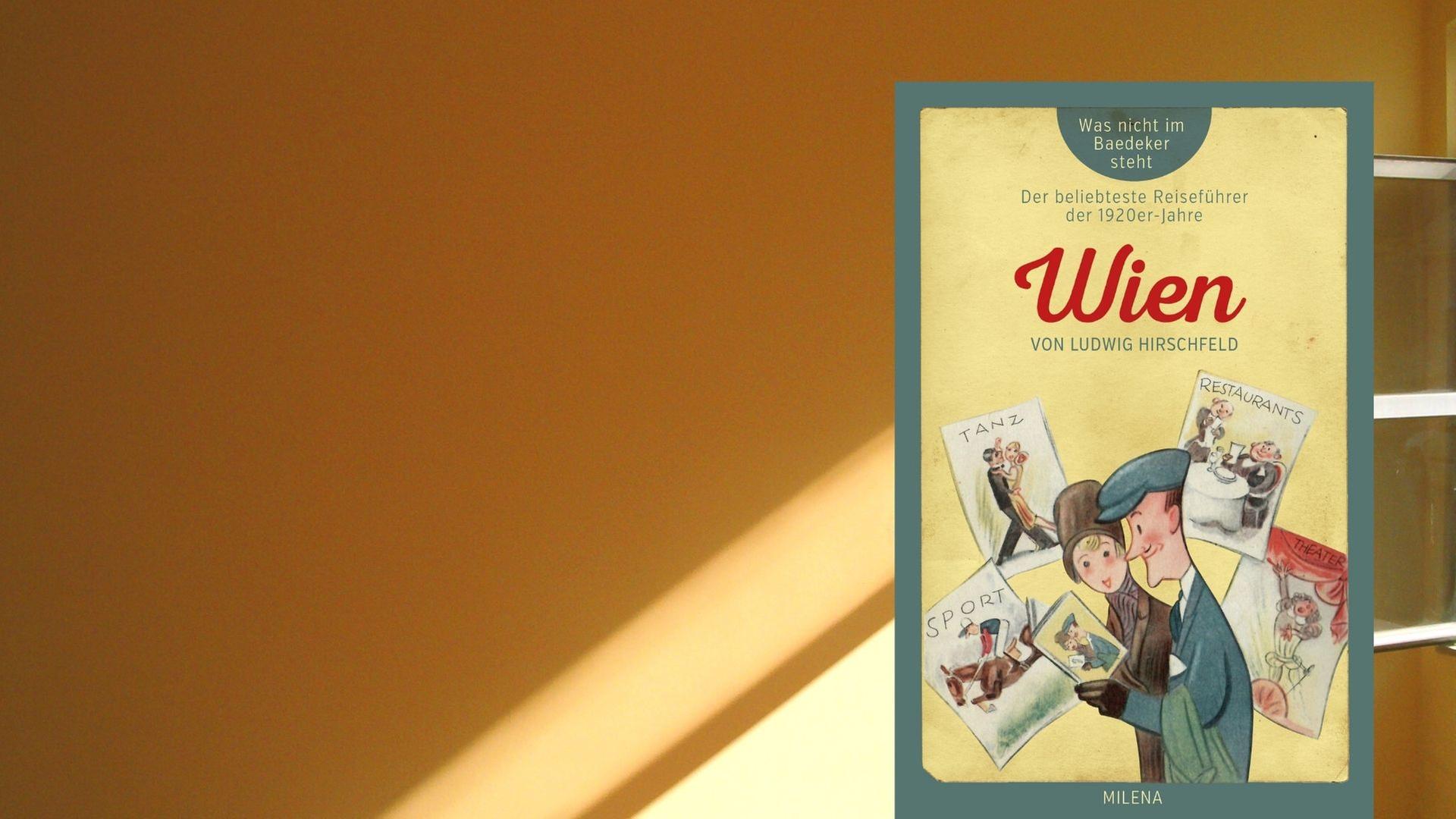
Wenn jemand eine Reise tat, so rüstete er sich seit 1835 mit dem "Baedeker" oder ab 1853 mit einem "Griebens Reiseführer" aus. 1927 aber war das Geburtsjahr einer neuen Reihe, die den Pionieren den Rang ablief. Sie versprach, "Was nicht im Baedeker steht". Am bekanntesten von den 17 Bänden ist heute "Das Buch von der Riviera" von Klaus und Erika Mann.
Zum Erfolg trug die Gestaltung durch den Prager Grafik-Profi Walter Trier bei, der auch die berühmten Einbände von Erich Kästner schuf. Die Erfindung des Piper Verlags wurde so erfolgreich, dass sie bis heute unter neuem Gewand fortlebt. Denn Pipers "Gebrauchsanweisung" für verschiedene Länder beruht auf einem ähnlichen feuilletonistischen Konzept. Ludwig Hirschfeld war der ideale Plauderer für den jetzt aufs neue erschienenen Wien-Band. Etwas machte ihm aber zu schaffen:
"Dem Verleger fiel folgendes ein: Viele Fremde, die nach Wien kommen, fahren auch nach Budapest. Zu dem Wiener Buch muß daher auch ein Anhang geschrieben werden: Ausflug nach Budapest. Nur das Wichtigste, zirka 16 Seiten, das genügt völlig. Gutmütig erklärte ich mich bereit, aber es tut mir jetzt noch leid."
Wien, nur du allein
In der nun wiederaufgelegten zweiten Auflage, die 1929 auch ins Englische übersetzt wurde, konzentrierte sich Hirschfeld, mit eigenen Worten verhinderter Banker sowie "Humorist, Sonntagschroniqueur der Neuen Freien Presse und Lustspielautor" wieder auf Wien allein. Dieses umfasste für ihn vor allem die Innere Stadt und angrenzende Bezirke innerhalb des Gürtels.
Kein Wunder, denn die Adressaten waren ja nicht zuletzt zahlungskräftige deutsche Gäste. Immer wieder klingt in diesem Buch durch, dass Wien eine infolge des Ersten Weltkriegs deklassierte Hauptstadt ist. Manches können sich nur die Ausländer leisten, und wer auf Erfolg aus ist, hat sein Glück längst in der Fremde gefunden:
"Auch Josma Selim und Ralph Benatzky sind nach Berlin ausgewandert, wie so viele andere, weil man in diesen schlechten Zeiten von der Wiener Note nur dann gut leben kann, wenn man sie im Ausland in Mark oder tschechische Kronen umwechselt."
Mythos Kaffeehaus
Mit dem Kapitel "Kaffeehauskultur" erwartet deutsche Touristen gleich die erste, bis heute gültige strenge Lektion:
"Um Gottes Willen, sagen Sie nicht ,Káffeeʻ wie die Reichsdeutschen, sondern sagen Sie ,Kaffeehʻ, das klingt gleich viel aromatischer."
Nach ganzen zwei Seiten über die Kaffeespezialitäten wird ein Loblied in Moll aufs Kaffeehaus gesungen. Denn Hirschfeld macht immer wieder deutlich, dass die alte Zeit vorbei ist, und die Klischees überholt sind:
"Oder haben Sie vielleicht erwartet, dass jeder der Wiener Autoren hier mit einem süßen Mädel im Arm sitzt?"
Schöne Literatur und schöne Musik
Im Café Herrenhof sitzen zwar die Autoren Leo Perutz und Anton Kuh. Wer nun aber aus erster Hand eine Galerie weiterer literarischer Berühmtheiten erwartet, wird sie vergeblich suchen. Suchen, denn leider hat die Neuausgabe ein Register der Örtlichkeiten, aber keins der Personen. Es wäre ein Whoʼs Who der damaligen Zeit, darunter Peter Altenberg, Sigmund Freud und Max Reinhardt, Arthur Schnitzler oder die Tenöre Richard Tauber und Leo Slezak. Auch sie sind, wie alle, Cafégänger:
"So leben wir alle Tage. Nämlich im Kaffeehaus. Von acht Uhr früh bis zwei Uhr nachts spielt sich hier ein wesentlicher Teil des Wiener Lebens ab. Hier werden die Meinungen gebildet, die Gemeinplätze und manchmal auch die Gemeinheiten."
Ähnlich ausführlich kommen Musik und Kleinkunst, Restaurants, Tanzbars mit Eintänzern, der Prater, die Heurigen und die Vorläufer der Shopping-Center zur Geltung. Verblüffend ist dabei, wie viele dieser Orte sich bis heute erhalten haben: von der Tanzschule Elmayer bis zum Warenhaus Gerngroß, vom Griechenbeisl bis zum Heurigen Kierlinger. Und selbst ins Stadion scheint sich Ludwig Hirschfeld verirrt zu haben:
"Und nirgends ist die heutige Wiener Bevölkerung so leidenschaftlich wie begeistert wie bei einem Fußballmatch. Auf dem Platz des Wiener Athletik-Sportklubs im Prater, auf der Hohen Warte, in Hütteldorf. Dort fallen die großen Entscheidungen zwischen den führenden Vereinen, der Hakoah, der Vienna, dem Rapid und wie sie alle heißen."
Die Größe des jüdischen Wiens
Wie selbstverständlich nennt Hirschfeld allen voran die Hakoah, den ersten österreichischen Profi-Meister von 1925. Den jüdischen Verein, der als erste Mannschaft des Kontinents bei einem englischen Klub – West Ham United – gewinnen konnte. Damit kommt beklemmend eine weitere Dimension hinzu: Das, was noch nicht in diesem alternativen "Baedeker" stehen konnte.
Ludwig Hirschfeld ruft uns ein Wien ins Gedächtnis, das wenig später unterging, indem nach 1938 sein jüdisches Leben ausgelöscht wurde. Das konnte er zwar nicht ahnen. Aber wir lesen im Wissen um die kommende Katastrophe mit Gänsehaut eine Passage, die wie ein Fremdkörper den üblichen Plauderton stört:
"Ich möchte Sie nur auf die spezifisch wienerische Judenfrage aufmerksam machen. Sie hat gar nichts mit Politik oder Rassenantisemitismus zu tun, denn diese Frage wird hier von allen, ohne Unterschied der Konfession gestellt, von Hakenkreuzlern wie von Juden: ,Ist er ein Jud?ʻ. Alle anderen Fragen kommen später. In jedem Gespräch wird man Ihnen damit aufwarten."
Der Judenhass wird mörderisch
Auch Fritz Grünbaum war Jude. Für Hirschfeld war einzig wichtig, dass er als Direktor des berühmten Kabaretts "Simplizissimus" auf der Bühne stand:
"Er macht ein Gesicht, als könnte er nicht bis zwei zählen und ist in der Diskussion doch von einer ätzenden Schärfe des Witzes, von einer Schlagkraft des Einfalles, einer gutmütigen Bosheit, einer verbindlichen Perfidie, die die Leute zum Lachen bringt."
Was Hirschfeld hier über einen seiner Lieblinge schreibt, wurde zu einem Gedenkblatt. Fritz Grünbaums letzter Auftritt soll Silvester 1940 in Dachau gewesen sein, 14 Tage später war er tot. Überliefert ist sein Satz an einen KZ-Aufseher:
"Wer für Seife kein Geld hat, soll sich kein KZ halten."
Auch einer der größten Geiger seiner Zeit wird den Wien-Touristen vom Konzertbesucher Hirschfeld angepriesen:
"Sie werden heute jene berühmte Stelle aus der dritten Leonoren-Ouvertüre hören, die den Philharmonikern niemand nachspielt. Saß doch am Pult der ersten Violine seit Jahren kein Geringerer als Arnold Rosé, der Führer des Rosé-Quartetts."
In den Bezirken der Toten
Rosés Tochter Alma trat wenige Jahre später in Auschwitz auf, bis zu ihrem Tod im April 1944 als Dirigentin des Mädchenorchesters. Ihr Schicksal war keine Ausnahme. Ludwig Hirschfeld wohnte in der Bechardgasse im dritten Wiener Bezirk. Und damit in einem der Zentren des bürgerlichen jüdischen Wiens. Zahlreiche Stolpersteine und Gedenktafeln mahnen heute daran, wie sein Viertel zwischen 1938 und 1945 in eine Stadt der Geister und Toten verwandelt wurde. 200 Meter von den Hirschfelds entfernt, in der Gärtnergasse, war das Haus des Dichters und Dramatikers Jura Soyfer, zu dessen letzten Gedichten das "Dachau-Lied" wurde.
"Doch wir haben die Losung von Dachau gelernt. Und wir wurden stahlhart dabei. Bleib ein Mensch, Kamerad!"
Gleich ums Eck der Hirschfelds, an den berühmten Sophiensälen vorbei, in der Marxergasse 25, wohnte ein weiterer Promi der Unterhaltungsbranche:
"In der BAR ZUM KROKODIL in der Habsburgergasse kreiert Hermann Leopoldi, der wirksamste und populärste Klaviersänger Wiens, seine neuen Kompositionen."
Die verschwundenen Kaffeesieder
Weil im März 1938 die Tschechoslowakei die Grenze für Flüchtlinge aus Österreich dichtmachte, landete Leopoldi im KZ. Nach der Freilassung aus Dachau küsste er bei der Ankunft in New York amerikanischen Boden. Robert Musil lebte bis 1938 nebenan in der Rasumofskygasse, und auch die modernistische Villa von Ludwig Wittgenstein und Peter Engelmann war nicht weit.
Die jüdischen Kaffeesieder in der Löwengasse verschwanden wie ihre Cafés. Es ist gut, dass dieser besondere Wien-Reiseführer an die Zeit erinnert, als Juden selbstverständlich ihre Heimatstadt mitprägten. Dazu trug auch Ludwig Hirschfeld bei. Seine Frau, zwei seiner Kinder und er wurden am 6. Dezember 1942 aus Frankreich nach Auschwitz deportiert. An ihn, den keine Gedenktafel ehrt, erinnert nun dieses unbeschwert-heitere Buch – auch dank des Nachworts des Wiener Autors Martin Amanshauser – sowie ein Auswahlband seiner Feuilletons.
Ludwig Hirschfeld: "Wien. Was nicht im Baedeker steht".
Milena Verlag, Wien. 256 Seiten, 23 Euro.
Milena Verlag, Wien. 256 Seiten, 23 Euro.