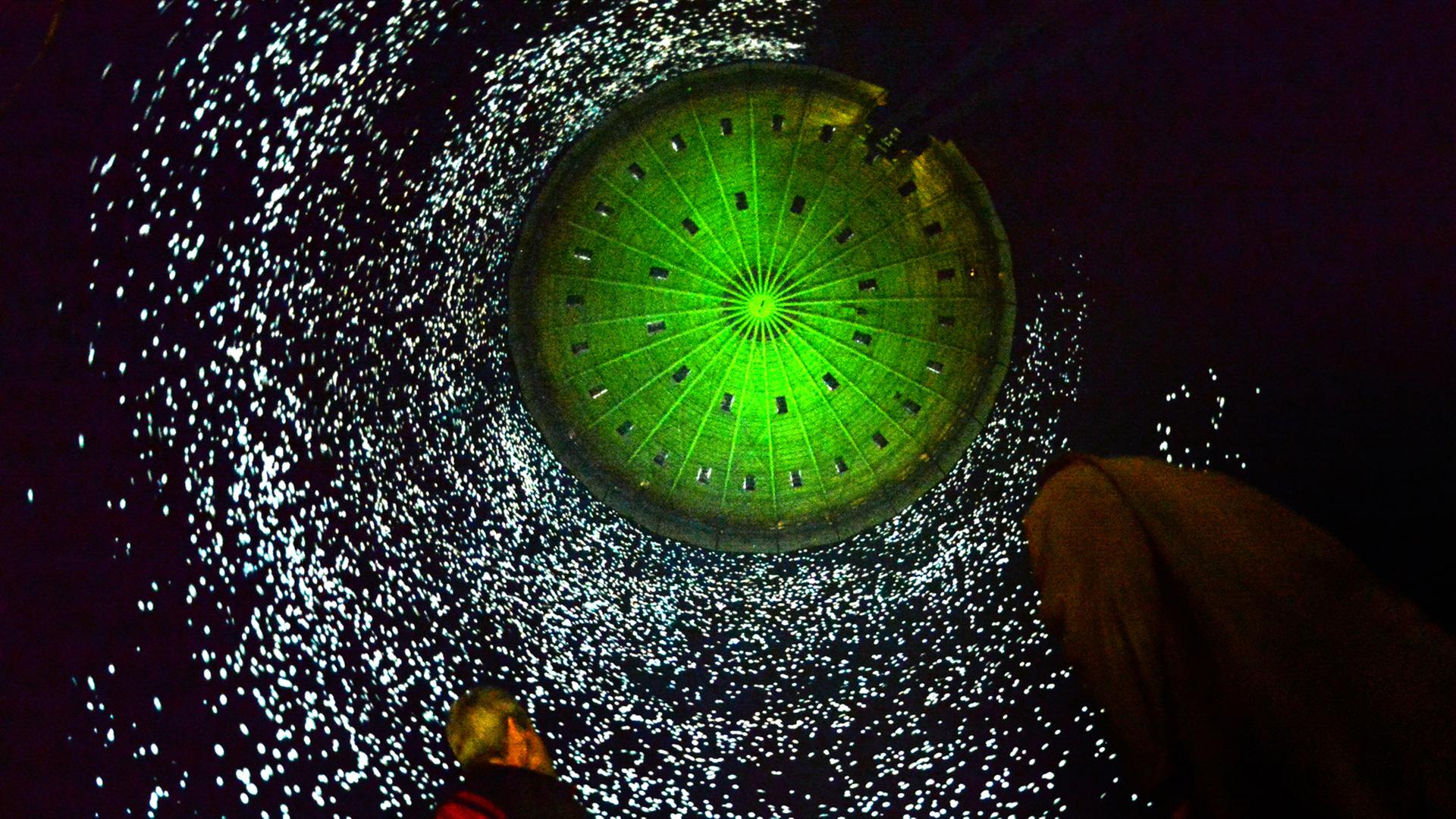"Ich hoffe vielleicht auf eine einfache Lösung der Frage: Was ist schön?"
"Schönheit ist in gewisser Weise Durchschnitt."
"Ich denke, Schönheit ist auch immer was sehr Individuelles. Es hat was mit Geschmack zu tun."
Wir alle wissen sehr genau, was schön ist. Oder wir glauben, es zumindest zu wissen. Wenn wir einem Menschen begegnen, wissen wir in Sekundenbruchteilen, ob er attraktiv ist oder nicht. Wenn wir ein Bild sehen, eine Landschaft, ein Gesicht, wissen wir genau, ob wir es schön finden oder nicht. Problematisch wird es, wenn wir nach Gründen gefragt werden. Warum ist das schön? Wie so oft sind die einfachen Dinge so schwer zu beschreiben.
Deshalb widmet sich das Studium Generale der Friedrich-Schiller-Universität Jena in diesem Semester dem leichten, schweren Thema Schönheit.
"Jeder benutzt - das ist ja auch das Interessante! - jeder benutzt diesen Begriff "schön" oder auch "Schönheit" ja auch beständig im Alltag. Wenn wir mal überprüfen würden, wie oft wir eigentlich sagen, "Das war jetzt schön!", "Guck mal, wie schön!", "Das ist eine Schönheit!". Und da ist einfach interessant zu sagen: Was meinen wir damit? Wir benutzen diesen Begriff, aber die wenigsten können erklären, warum sie eigentlich etwas als schön empfinden."
Dirk von Petersdorf ist Germanist und Lyriker. Er hat die Vorlesungsreihe Schönheit konzipiert. Er hat einen Mediziner als Vortragenden gewinnen können, eine Mineralogin, einen Philosophen, einen Kunsthistoriker, einen Musikwissenschaftler, eine Mode-Professorin.
"Der Ansatz in unserer Reihe ist breit; aber das entspricht auch der Vielfalt der Phänomene, die wir als "schön" bezeichnen: Wir würden sicher alle in der Natur öfter etwas als schön empfinden, bei einer Wanderung. Wir würden natürlich zu Kunstwerken sagen, wenn wir meinetwegen ein Musikstück gehört haben, ein Bild sehen, sagen, "Das ist schön." Wir würden über schöne Menschen sprechen. Aber viele von uns würden auch technische Hervorbringungen als schön empfinden; manche können sich an der Schönheit von Autos gar nicht satt sehen. Es gibt Mathematiker, die finden mathematische Formeln schön; das ist nicht allen Menschen eingängig, aber auch das ist sehr glaubwürdig. Also, wir bezeichnen ein großes Spektrum als schön; und die Frage ist natürlich auch: Meinen wir damit etwas Gemeinsames; gibt es gemeinsame Strukturen, die bestimmen, was wir in diesen Bereichen als schön empfinden?"
Der Neurobiologe: Reize und Hirnreaktionen
Den Auftakt machte Professor Christoph Redies. Er ist Anatom, Neurobiologe und Hobbymaler. Die Kernfragen, denen er sich stellt, sind: Ist die Schönheit in den Dingen oder in uns? Und ist sie natürlich oder ein Produkt der Kultur?
"Das ist kein Entweder-oder, sondern es ist in beiden Fällen ein Und. Es ist völlig klar, dass Kunst kulturellen Einflüssen unterliegt, aber es ist auch klar, dass Kunst über unser Sehsystem wahrgenommen wird. Und dieses Sehsystem hat eine bestimmte Struktur, die sich aus der Evolution ergibt. Und damit bedingt auch diese Struktur, was wir wahrnehmen können und wie wir es wahrnehmen. Und deswegen gibt es ein Wechselspiel erstens zwischen den Reizen, den Kunstwerken, die vor uns liegen, die wir uns anschauen, und dem Sehsystem, das diese Reize aufnimmt und verarbeitet in einer speziellen Weise. Also, es geht sowohl um die Reize als auch um die Hirnreaktionen. Es geht sowohl um kulturelle Einflüsse - die sehr wichtig sind, ohne Zweifel! -, aber auf einer kürzeren Zeitschiene uns prägen; und es geht über die Biologie des Sehsystems auch wahrscheinlich dann über biologische Prinzipien, die universeller Natur sind und die bei uns Menschen auch alle gleich sind."
Christoph Redies verglich in seiner Vorlesung natürliche Bilder, also Fotos, und künstliche Bilder, also Kunstwerke miteinander: Wie sie strukturiert sind, wie sie sich ähneln und unterscheiden, und wie sie auf das menschliche Hirn wirken.
"Man weiß schon seit Langem, dass komplexe natürliche Szenen sehr spezielle Bilder sind, die nämlich eine fraktale Struktur, eine selbstähnliche Struktur haben. Und an diese Struktur ist auch der Mensch in besonderer Weise überhaupt adaptiert, indem es diese Strukturen besonders gut verarbeiten kann. Und die These ist jetzt, dass der Künstler etwas schafft, was eine ähnliche Struktur hat, und was damit auch der Biologie des Sehsystems insofern entspricht, als auch hier die Informationen ähnlich wie bei natürlichen Szenen besonders schnell und eingängig verarbeitet werden kann."
Schön ist also für uns vermutlich, so Redies' These, was von mittlerer Komplexität und hoher Selbstähnlichkeit ist, Strukturen also, die nicht zu einfach und nicht zu schwierig sind und sich im Bild wiederholen. Wir Menschen lieben Symmetrie, gerade in Gesichtern; schöne Strukturen regen das Belohnungssystem an, genauso wie Schokolade, Musik, Sex oder Drogen. Ist es wirklich so einfach?
"Warum soll so etwas Grundlegendes wie die Wahrnehmung von Schönheit so schrecklich kompliziert sein? Ich glaube eher, dass es etwas Grundlegendes und damit Einfaches ist! Und so grundlegend, dass es unserem Intellekt gar nicht mal zugänglich ist, dass wir es nur intuitiv begreifen können. Ich denke nicht, dass ästhetische Theorien unbedingt komplex sein müssen. Im Gegenteil: Ich hoffe auf eine einfache Lösung der Frage: Was ist schön?"
"Die Schönheit ist vielleicht ein biologisches Programm, das jeder hat und das man auch relativ unwillkürlich sieht. Man muss nicht lange ausgebildet sein, um eine schöne Frau zu erkennen als Mann oder eine schöne Landschaft schön zu finden."

Der Kunsthistoriker: Original und Kopie
Karl Schawelka hält die zweite Vorlesung der des Studium Generale zur Schönheit in Jena. Er ist Kunsthistoriker und emeritierter Professor der Bauhaus-Uni Weimar. Auch ihm reicht es nicht mehr, das Kunstwerk an sich zu betrachten. Er kommt an den Erkenntnissen der Neurowissenschaften nicht vorbei.
"Also, es zeigt sich, dass die Vorstellung, mit der ich noch aufgewachsen bin, also "Schönheit liegt im Auge des Betrachters", mittlerweile revidiert werden muss, weil eben Schönheit etwas ist, was biologisch angelegt ist."
Schawelka betrachtet das schwierige Verhältnis von Kunst und Schönheit. Dass Kunst schön sein muss, sei eine recht moderne Erfindung und keinesfalls von globaler Bedeutung. Man könnte fast von einem Ausrutscher sprechen.
"Ja, das ist die - wenn man so will - Ideologie des Klassizismus: Das kam im 18. Jahrhundert auf; da kam eben auf die Vorstellung der "schönen Künste" und leitet sich ab von den Griechen, die sehr viel Gewese um Schönheit und Kunst gemacht haben und sich sehr um Schönheit bemüht hatten. Allerdings waren die Griechen eine Ausnahme gegenüber den anderen Kulturen drum herum. Und auch in späteren Zeiten und außerhalb der europäischen Kunst ist der größte Teil der Kunst eigentlich nicht schön. Also, die Kunst ist immer weiter als das Schöne allein!"
Das Grausame, das Erhabene, das Schreckliche - das alles können wir in der Kunst genießen, den Schauder im Museum, im Kino oder im Fernsehsessel, wenn andere stellvertretend für uns Dinge erleben, die keinesfalls "schön" sind. Und doch ist es Kunst. Und sie unterscheiden sich erheblich in Fragen der Originalität.
"In der Kunst geht es ja auch um Original und Kopie. Also, wir gehen davon aus: Das Original ist alles wert und die Kopie ist nichts wert. Aber bei der Schönheit ist es unerheblich. Eine schöne Frau, die eine Kopie einer schönen Frau ist, ist weiterhin schön! Ein schönes Auto, das eine Kopie von einem anderen schönen Auto ist, ist weiterhin schön! Aber in der Kunst würden wir eben sagen: Der nachgemalte Rembrandt von irgendeinem Fälscher ist eben nichts wert. Also, das heißt: Wir haben da eine Unterscheidung von Original und Kopie, die sich mit der Schönheit schlecht verträgt."
Schön in unserem biologischen Programm, so Schawelka, ist schlicht das Vernünftige, Zweckmäßige, Durchschnittliche, das uns sicher zum Ziel führt, zu gesundem Nachwuchs oder in eine Landschaft, die nicht lebensfeindlich ist. Schönheitsideale seien nicht so variabel wie angenommen und umspielten immer nur einen festen Kern, der überzeitlich und überregional konstant sei.
"Hat sich im Prinzip bewährt. Ist natürlich das Problem bei all diesen Programmen, die wir haben: Passen die noch in unsere Zeit? Wir haben ein Programm, dass wir Zucker eben angenehm finden - und das ist natürlich nicht mehr gesund und führt zu Fettleibigkeit und Karies und allem Möglichem. Und die Frage ist natürlich, inwieweit Schönheit bei der Partnerwahl beispielsweise so entscheidend ist, wo wir eben die Pille haben und wo wir uns ohnehin nicht mehr fortpflanzen. Und natürlich ist dieses Programm immer nur zu 70-80 Prozent richtig gewesen. Also, es gab immer Ausnahmen, es gab immer Situationen, wo man aufpassen sollte: Also eine schöne Frucht, die mich lockt, sie zu verzehren, ist sicher ein nützliches Programm, aber natürlich es so etwas wie Tollkirschen, die , obwohl sie schön aussehen, uns nicht guttun. Oder auch schöne Frauen natürlich! Und auch schöne Männer! Also, man kann sich nicht unbedingt drauf verlassen! "
Die Mineralogin: Optisch perfekt, aber empfindlich
Die Mineralogin Birgit Kreher-Hartmann, auch sie eine Vortragende des Studium Generale "Schönheit", ist noch viel skeptischer, das Schöne, das optisch Perfekte unbedingt mit dem Nützlichen zu verbinden. In der Mineralogie sei es genau andersrum.
"Alles Perfekte im Mineralreich ist von den Mitmineralen benachteiligt. Also, wenn man jetzt das Mineral Quarz nimmt, gerade an das Mineral Bergkristall denkt, wo man die charakteristischen Formen mit den langen Prismenflächen und den Häubchen drauf, die dann ganz spezielle Flächen haben - wenn die besonders schön ausgebildet sind, sind sie zwar etwas Ästhetisches, aber sie sind fast empfindlicher gegenüber der Natur, als wenn sie nicht so ideal ausgebildet sind. Wenn sie einzeln in einen Hohlraum wachsen, sind sie ja immer auch, haben ein gewisses Maß an Fragilität, also Empfindlichkeit; sie können leichter abbrechen, können von Lösungen, die vielleicht durchfließen mit anderen Elementen, eher angegriffen werden und aufgelöst werden, also: Schönheit ist da eher verletzlich, sagen wir mal."
Schönheit könnte also Teil einer Programmierung in unserem Hirn sein; Schönheit hilft uns, Entscheidungen zu fällen; ob aber der dabei gefundene schöne und zweckmäßige Weg der richtige ist, sagt uns das Programm nicht. Und Schönheit kann auch gefährlich sein - für das Schöne und für den Betrachter. Christoph Redies hat keine Angst vor der Entzauberung der Schönheit, auch wenn er noch genauer herausfinden sollte, was sie ist und wie sie auf uns wirkt.
"Es gibt sehr viel Widerspruch! Und zwar kommt der aus verschiedenen Ecken. Es gibt Menschen, die sagen: Wenn wir Schönheit erklären können, entzaubern wir Schönheit; dann ist es nicht mehr schön, weil dann das Göttliche in eine Formel gepackt ist und damit der Reiz verloren geht. Ich glaube das nicht! Ich glaube, die ästhetische Wahrnehmung, die Wahrnehmung von Schönheit ist so grundlegend, dass wir's gar nicht abstellen können. Das ist vielleicht ähnlich wie bei der Liebe: Da wissen wir auch ganz genau, wie der Körper reagiert und wo da was erweitert wird und welche Hormone ausgeschüttet werden - trotzdem nimmt uns das ja nicht die Freude!"