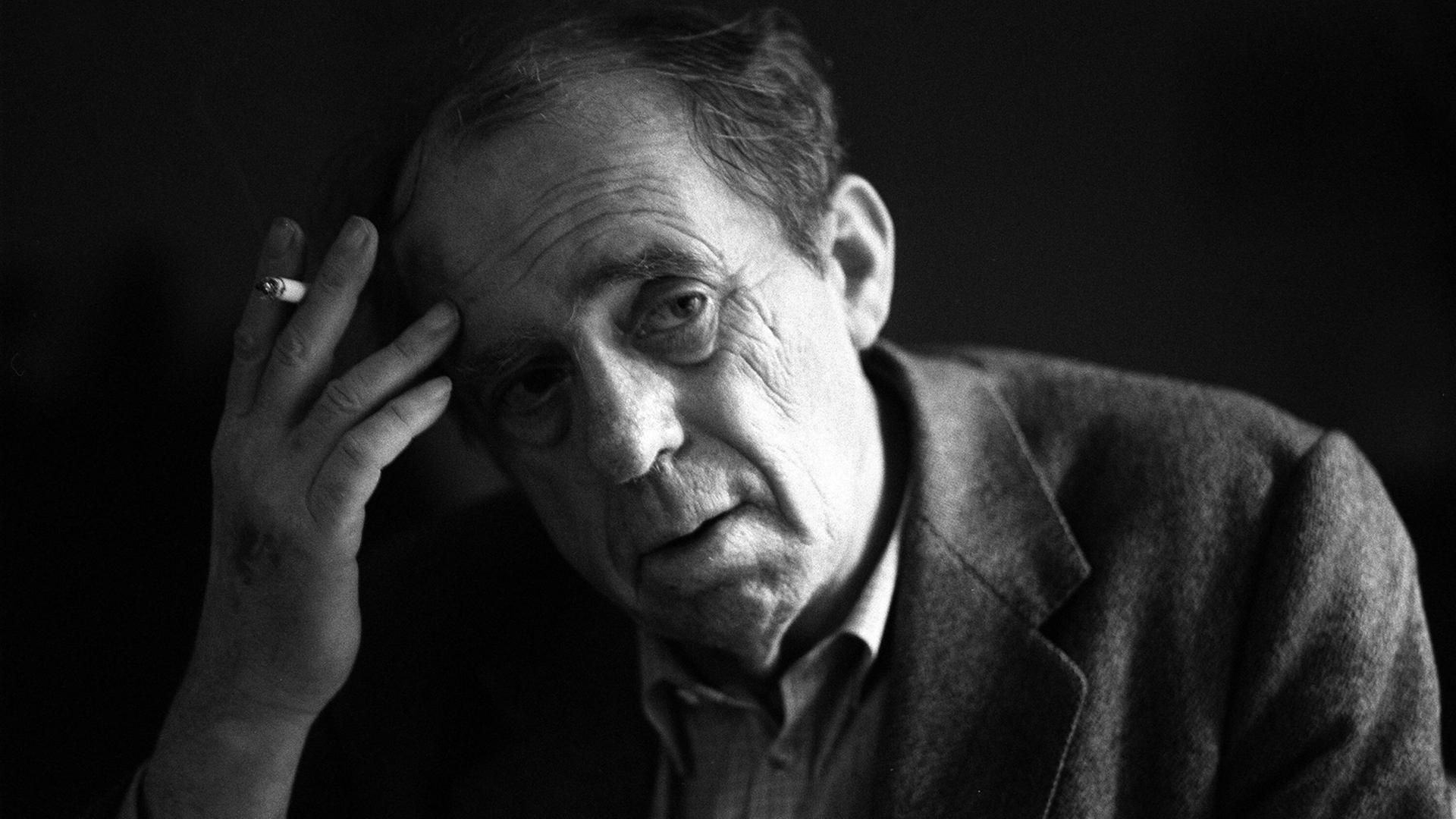Wir haben das alles ja längst vergessen, wie das war im katholischen Rheinland nach dem Krieg - bis weit in die 1970er-Jahre hinein: Der Terror der Kirche, der Terror der Altnazis, die es immer noch und schon wieder besser wussten, der Terror der tugendhaften Nachbarn, der Terror der Studienräte, der Terror der Eltern.
Einer steht auf und sagt: Nö, mach ich nicht mehr mit - und wird Clown. Kein ehrbarer Beruf, versteht sich, aber immerhin einer in der Tradition der Artistenfakultät - und in der Tradition der reinen Toren, der Hofnarren und produktiven Außenseiter. Hans Schnier, Sohn aus gutem Hause, Vater Fabrikant, Mutter alte Nazi-Parteigenossin, versucht das ganz andere Leben, weil das normale ihm nicht offensteht. Heinrich Böll hat diese melancholische Figur 1963 ersonnen, deren Problem darin besteht, tatsächlich zu lieben und nicht nur einer Konvention zu folgen: Ehe, Kinder, Reihenhaus. Seine sehr katholische Geliebte läuft ihm weg, weil er sie nicht heiraten will – und sie dem Druck der Verwandtschaft nicht standhält und sich dann einem Heribert Züpfner hingibt. Dabei ist er doch völlig monogam, der Clown, nur eben ohne den Segen der Kirche.
"Er sagte, ich sei das einzige Mädchen, mit dem er diese Sache tun wollte. Er hätte immer nur an mich gedacht, wenn er an die Sache gedacht hätte. Auch schon im Internat. Immer nur an mich."
System von Beobachtung und Kontrolle
Es kommt nicht von ungefähr, dass ausgerechnet ein oppositioneller russischer Regisseur mit diesem Stoff etwas anfangen kann. Ein System ständiger Kontrolle und Beobachtung ist dem 38-jährigen Maxim Didenko offenbar aus seiner Heimat vertraut. So übersetzt er nun das rheinisch-katholische Tugend-Regime in einen theatralen Alptraum, in dem Nachbarn, Eltern und sogenannte Freunde aus allen Schubladen, Fenstern und Zimmertüren kriechen und dem Clown Hans Schnier zugucken.
Die gesamte Bühne wird per Film-Projektion abwechselnd in Weltkriegs-Blut und in Nachkriegs-Blümchentapete getaucht. Spieluhren klingeln und ticken, leise Atemgeräusche werden rhythmisiert zu dezent hallenden Beischlafsounds, ein Horrorkabinett – optisch wie aus dem expressionistischen Stummfilm, akustisch und sprachlich dann aber grotesk kirchenkritisch. Denn Didenko sakralisiert einige Dialoge, er lässt sie singen wie eine Liturgie.
"Wissen Sie, was man sich von dem katholischen Schriftsteller Besewitz erzählt? Dass er lange selbst mit einer geschiedenen Frau zusammenlebte…"
Und der Clown kontert mit den Mitteln der Notwehr, der Parodie:
"Ich kenne auch eine Geschichte, von unserem Nachbarn S. Er lebte auch mit einer geschiedenen Frau zusammen und ernährte deren drei Kinder…"
Katholisches Milieu - sarkastisch verfremdet
Didenko bleibt inszenatorisch streng im katholischen Milieu, freilich in einem sarkastisch verfremdeten. Schniers Vater will dem Sohn eine Pantomimen-Ausbildung bezahlen, obgleich der doch sehr behende durch die Aufführung turnt; die Mutter ist ein schwarzer Drachen und Vorsitzende des "Zentralkomitees zur Versöhnung rassischer Gegensätze". Die tote Schwester, von der Mutter in den Flakhelfer-Tod geschickt, schlafwandelt durch die Szenen, der Bruder will Priester werden und setzt sich als wächserner Aushilfs-Jesus an den Abendbrottisch wie zum letzten Abendmahl. Es ist einfach surreal - und gar nicht so betulich, wie es bei Böll manchmal klingt.
Sophie Arbeiter spielt Schniers katholische Geliebte mit verführerischer Kühle, ständig eine Bibel auf dem Kopf. Und der großartige Christoph Bornmüller als Clown tut lange Zeit so, als sei er nur ein verkrachter Rummelplatz-Komiker, der sich immer im Telefonkabel verheddert. Dabei ist er vor allem ein großer Einsamer, dem die Welt abhandengekommen ist. Nein, er sitzt am Ende nicht, wie im Roman, vor dem hässlichen Bonner Hauptbahnhof: Er bewegt sich als einzig Normaler mit einer Clownspuppe durch eine Geisterbahn gläubiger Katholiken. Dies ist eine niederschmetternde Diagnose der Adenauer-Zeit. Und eine Inszenierung, von der man noch viel hören wird.