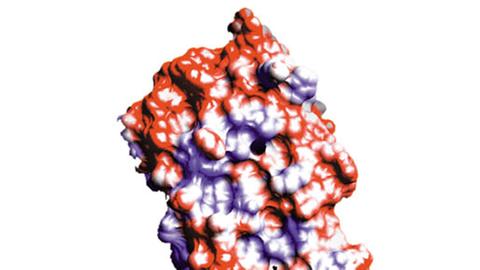Gerd Pasch: Was unterscheidet denn die Proteomik von der Genomik, die ja Ähnliches macht?
Michael Lange: Ja, auch die Genomik schaut auf die Gesamtheit in einer Zelle, auf die Gesamtheit der Gene. Aber sie ist im Grunde genommen viel einfacher: Denn das Genom ist linear, einfach eine Folge von Buchstaben. Das Genom, das Erbgut ist in jeder Zelle gleich und es bleibt auch während des ganzen Lebens identisch. Die Proteomik, also die Gesamtheit der Eiweiße, das ändert sich im Laufe des Lebens. Das sieht in einem jungen Menschen ganz anders aus als in einem alten Menschen. Und das sieht in jeder Zelle anders aus, das ist das Schwierige daran. In einer Leberzelle sind ganz andere Eiweiße als in einer Gehirnzelle. Und das müssen die Wissenschaftler erst alles untersuchen in der Proteomik.
Gerd Pasch: Mit welchen Methoden gelingt denn dann die Entschlüsselung des Proteoms?
Michael Lange: Das ist auch ganz anders als beim Genom. Beim Proteom gibt es sehr viele verschiedene Methoden und deshalb auch ganz unterschiedliche Wissenschaftler, die sich hier auf dem Weltkongress in München treffen. Eine sehr wichtige Methode ist, dass man sich die Eiweiße in einer Zelle einfach auftrennt. Man reinigt die Eiweiße in der Zelle, trennt sie auf und schaut dann, welches Eiweiß hat welche Aktivität, und versucht daraus zu schließen, welche Funktion könnte dieses Eiweiß in einer Zelle haben. Eine andere Methode: Da wird untersucht, wie sich denn verschiedene Zellen voneinander unterscheiden. Da hat man Antikörper, die kennt man aus dem Immunsystem, und die benutzt man dann als Werkzeug. Ein Antikörper, der ein bestimmtes Eiweiß erkennt, untersucht, ist dieses Eiweiß in einer Gehirnzelle vorhanden. Und gibt dann das Signal "Ja" oder "Nein". Oder ist dieses Eiweiß in einer Leberzelle vorhanden. Das liefert sehr viele Daten hier für die Proteomikforscher.
Gerd Pasch: Zehn Jahre hat die Entschlüsselung des menschlichen Genoms gedauert. Wann denken die Proteom-Forscher mit ihrer Arbeit fertig zu werden?
Michael Lange: Das ist überhaupt nicht absehbar. Also das Genom war schneller fertig als die Wissenschaftler anfangs glaubten. Bei dem Proteom ist es so, dass ein Ende eigentlich gar nicht in Sicht ist. Man sagt zwar, im Moment ist eine ganz heiße Zeit, da laufen ganz viele Informationen ein. Es ist gewissermaßen die Pubertät dieses Forschung, wurde gesagt, aber es wird wohl noch hundert Jahre dauern, bis man das genau verstanden hat. Und in etwa zehn Jahren versucht man einen einigermaßen Überblick zu bekommen. Dennoch gibt es schon einen Einblick, und zwar sozusagen ein Ergebnis dieser Proteomforschung. Und das wurde heute hier in München vorgestellt. Das ist der erste Proteinatlas. Der ist seit heute Mittag, 12.00 Uhr, unter www.proteinatlas.org nachzulesen. Das ist schon ein Durchbruch. Schwedische Wissenschaftler haben den vorgestellt.
Gerd Pasch: Michael Lange, wie muss man sich denn diesen Proteinatlas vorstellen?
Michael Lange: Das ist im Grunde eine riesige Datensammlung. Man kommt auf eine Oberfläche und kann dann zum Beispiel in Richtung verschiedener Gewebe gehen. Man kann zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt gerne mehr über die Bauchspeicheldrüse erfahren. Dann drückt man "Bauchspeicheldrüse" und dann sieht man eine riesige Gruppe von Proteinen, die in dieser Bauchspeicheldrüse vorkommen. Da kann man sich zum Beispiel ein Protein anklicken. Dann sieht man einen Gewebeschnitt von einem Menschen durch Antikörper markiert, wo das Eiweiß steckt. Dann kann man zum Beispiel diesen Gewebeschnitt vergleichen mit einem Gewebeschnitt aus einem Krebsgewebe, auch aus der Bauchspeicheldrüse, und die Unterschiede sehen: Dieses Eiweiß ist in Krebsgewebe zum Beispiel häufig und in gesundem Bauchspeicheldrüsengewebe ist es relativ selten. Das liefert natürlich sehr viele Informationen vor allen Dingen für die Entwicklung von Medikamenten: Wenn man ein gewisses Eiweiß bekämpfen möchte, dann kann man sehen, wo es überhaupt steckt. Und natürlich auch für die Medizin.
Gerd Pasch: Kein Schulatlas. Aber wer kann und was kann man mit dem Proteinatlas anfangen?
Michael Lange: Im Grunde genommen ist es erst einmal ein Werkzeug für die Forschung. Das ist genau das gleiche wie beim Genom: Das Genom ist ja auch noch kein Wissen an sich, sondern die Wissenschaftler benutzen es, um weitere Informationen zu gewinnen. So ist das mit dem Proteinatlas auch. Er soll aber auch - und dafür dienen vor allen Dingen diese Bilder, die ich gerade beschrieben habe - auch am Krankenbett sozusagen helfen, indem der Arzt die Bilder aus dem Gewebeschnitt seines Patienten, den er vor sich liegen hat, vergleicht mit dem Atlas. Er schaut in den Atlas und kann dann eine bessere Diagnose durchführen.
Michael Lange: Ja, auch die Genomik schaut auf die Gesamtheit in einer Zelle, auf die Gesamtheit der Gene. Aber sie ist im Grunde genommen viel einfacher: Denn das Genom ist linear, einfach eine Folge von Buchstaben. Das Genom, das Erbgut ist in jeder Zelle gleich und es bleibt auch während des ganzen Lebens identisch. Die Proteomik, also die Gesamtheit der Eiweiße, das ändert sich im Laufe des Lebens. Das sieht in einem jungen Menschen ganz anders aus als in einem alten Menschen. Und das sieht in jeder Zelle anders aus, das ist das Schwierige daran. In einer Leberzelle sind ganz andere Eiweiße als in einer Gehirnzelle. Und das müssen die Wissenschaftler erst alles untersuchen in der Proteomik.
Gerd Pasch: Mit welchen Methoden gelingt denn dann die Entschlüsselung des Proteoms?
Michael Lange: Das ist auch ganz anders als beim Genom. Beim Proteom gibt es sehr viele verschiedene Methoden und deshalb auch ganz unterschiedliche Wissenschaftler, die sich hier auf dem Weltkongress in München treffen. Eine sehr wichtige Methode ist, dass man sich die Eiweiße in einer Zelle einfach auftrennt. Man reinigt die Eiweiße in der Zelle, trennt sie auf und schaut dann, welches Eiweiß hat welche Aktivität, und versucht daraus zu schließen, welche Funktion könnte dieses Eiweiß in einer Zelle haben. Eine andere Methode: Da wird untersucht, wie sich denn verschiedene Zellen voneinander unterscheiden. Da hat man Antikörper, die kennt man aus dem Immunsystem, und die benutzt man dann als Werkzeug. Ein Antikörper, der ein bestimmtes Eiweiß erkennt, untersucht, ist dieses Eiweiß in einer Gehirnzelle vorhanden. Und gibt dann das Signal "Ja" oder "Nein". Oder ist dieses Eiweiß in einer Leberzelle vorhanden. Das liefert sehr viele Daten hier für die Proteomikforscher.
Gerd Pasch: Zehn Jahre hat die Entschlüsselung des menschlichen Genoms gedauert. Wann denken die Proteom-Forscher mit ihrer Arbeit fertig zu werden?
Michael Lange: Das ist überhaupt nicht absehbar. Also das Genom war schneller fertig als die Wissenschaftler anfangs glaubten. Bei dem Proteom ist es so, dass ein Ende eigentlich gar nicht in Sicht ist. Man sagt zwar, im Moment ist eine ganz heiße Zeit, da laufen ganz viele Informationen ein. Es ist gewissermaßen die Pubertät dieses Forschung, wurde gesagt, aber es wird wohl noch hundert Jahre dauern, bis man das genau verstanden hat. Und in etwa zehn Jahren versucht man einen einigermaßen Überblick zu bekommen. Dennoch gibt es schon einen Einblick, und zwar sozusagen ein Ergebnis dieser Proteomforschung. Und das wurde heute hier in München vorgestellt. Das ist der erste Proteinatlas. Der ist seit heute Mittag, 12.00 Uhr, unter www.proteinatlas.org nachzulesen. Das ist schon ein Durchbruch. Schwedische Wissenschaftler haben den vorgestellt.
Gerd Pasch: Michael Lange, wie muss man sich denn diesen Proteinatlas vorstellen?
Michael Lange: Das ist im Grunde eine riesige Datensammlung. Man kommt auf eine Oberfläche und kann dann zum Beispiel in Richtung verschiedener Gewebe gehen. Man kann zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt gerne mehr über die Bauchspeicheldrüse erfahren. Dann drückt man "Bauchspeicheldrüse" und dann sieht man eine riesige Gruppe von Proteinen, die in dieser Bauchspeicheldrüse vorkommen. Da kann man sich zum Beispiel ein Protein anklicken. Dann sieht man einen Gewebeschnitt von einem Menschen durch Antikörper markiert, wo das Eiweiß steckt. Dann kann man zum Beispiel diesen Gewebeschnitt vergleichen mit einem Gewebeschnitt aus einem Krebsgewebe, auch aus der Bauchspeicheldrüse, und die Unterschiede sehen: Dieses Eiweiß ist in Krebsgewebe zum Beispiel häufig und in gesundem Bauchspeicheldrüsengewebe ist es relativ selten. Das liefert natürlich sehr viele Informationen vor allen Dingen für die Entwicklung von Medikamenten: Wenn man ein gewisses Eiweiß bekämpfen möchte, dann kann man sehen, wo es überhaupt steckt. Und natürlich auch für die Medizin.
Gerd Pasch: Kein Schulatlas. Aber wer kann und was kann man mit dem Proteinatlas anfangen?
Michael Lange: Im Grunde genommen ist es erst einmal ein Werkzeug für die Forschung. Das ist genau das gleiche wie beim Genom: Das Genom ist ja auch noch kein Wissen an sich, sondern die Wissenschaftler benutzen es, um weitere Informationen zu gewinnen. So ist das mit dem Proteinatlas auch. Er soll aber auch - und dafür dienen vor allen Dingen diese Bilder, die ich gerade beschrieben habe - auch am Krankenbett sozusagen helfen, indem der Arzt die Bilder aus dem Gewebeschnitt seines Patienten, den er vor sich liegen hat, vergleicht mit dem Atlas. Er schaut in den Atlas und kann dann eine bessere Diagnose durchführen.