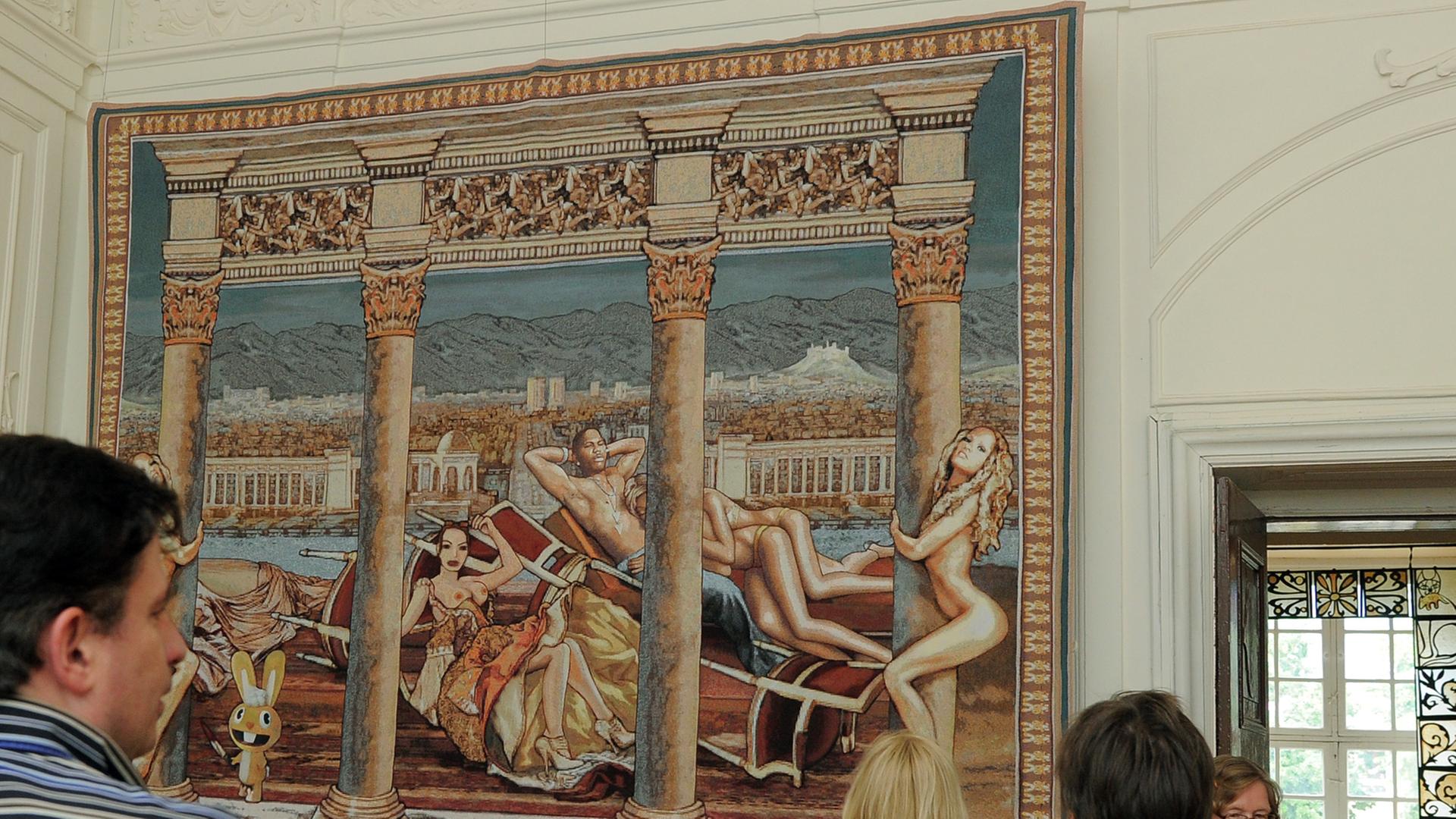"Den Gedanken Licht, den Herzen Feuer, den Fäusten Kraft" – Erich Weinert, der Dichter des deutschen Proletariats. Zu lesen ist dieses Zitat auf einer Mauer mit grau-braunem DDR-Putz, daneben zwei angerostete Fahnenmasten. Gleich um die Ecke hat Erich Weinert gewohnt, in der Intelligenzsiedlung in Berlin Pankow. Zweiundzwanzig Einfamilienhäuser, gebaut für die Exilanten, die nach Ende des Zweiten Weltkriegs nach Deutschland – genauer gesagt in die Sowjetisch besetzte Zone - zurückkehrten.
"Das war also Teil der staatlichen Kulturpolitik der beginnenden DDR, für die Re-Migranten gute Arbeits- und Wohnbedingungen zu schaffen, eigentlich auch ein Konkurrenzprogramm zum anderen Deutschland", sagt Thomas Flierl, von 2002 bis 2006 Berliner Kultursenator für die Linkspartei. Der Kulturwissenschaftler und Bauhistoriker ist heute unter anderem Vorstandsvorsitzender der Max-Lingner-Stiftung, die ihren Sitz ebenfalls in der ehemaligen Intelligenzsiedlung hat – im früheren Haus des Malers Max Lingner. Die Siedlung ist heute kaum noch als solche zu erkennen – unsanierte Häuser aus DDR-Zeiten stehen neben aufgehübschten Baumarkt-Exemplaren. Wie bei Vielem in Ostberlin wurde auch hier der Wert nicht erkannt, sagt der 57jährige.
"Das denke ich schon, dass mit dem Scheitern des politischen Systems auch das Scheitern der Gesellschaft als Ganzes damit verbunden war. Und dass erst mit gewissem Abstand das heute mehr wertgeschätzt wird, und dieses "Den Wert erkennen", den Wert behaupten gegen neue Interpretationen, gegen neue Deutungen, das ist sicherlich ein Prozess, der die Deutsche Einheit mit gekennzeichnet hat und der in gewisser Weise noch anhalten wird."
Doch Thomas Flierl gehört nicht zu den Ostalgikern, die nachträglich den DDR-Kehraus bedauern. Was wäre wenn? Was ist falsch gelaufen? Worauf könnte er im vereinigten Deutschland verzichten? Diese Fragestellung behagt ihm nicht.
"Also diese retrospektive Fragestellung ist ja zunehmend unproduktiv. Interessant ist eher, wie wieder ein neues Interesse gewachsen ist an Dingen, die schon längst aufgegeben waren, nach denen man nicht mehr gefragt hat, die scheinbar erledigt waren. Und dass vieles übersehen wurde, und dass vieles vergessen wurde, weggeworfen wurde, auch von den Ostberlinern selbst, gehört ja mit in diesen Prozess."
Stadtschloss ersetzt Palast
Das Schicksal des Palastes der Republik ist das Symbol für diesen Prozess. Nach der friedlichen Revolution zunächst geschlossen und entkernt, dann künstlerisch bespielt – unter Leitung von Matthias Lilienthal. Der sagte im Jahr 2004: "Ich bin ganz sicher, dass der noch die nächsten 10 Jahre steht. Die Stadt Berlin ist bankrott, und der Abriss kostet viel Geld und das ist ein Zusammenwirken von Berliner Subkultur, von verschiedenen gesellschaftlichen Gruppierungen, und deshalb glaube ich, dass die Nutzung weitergehen wird."
Matthias Lilienthal - demnächst Intendant der Münchener Kammerspiele – irrte sich gründlich. Zehn Jahre später ist nicht nur der Palast der Republik längst Geschichte. An seiner Stelle wächst das alte neue Berliner Stadtschloss aus dem Boden, der Rohbau ist fast fertig, die Baustelle im Zeitplan. Berlins früherer Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit sagte bei der Grundsteinlegung:
"Es soll nicht nur ein Ort sein, wo Museum sich zeigt, wo sich ein altes Schloss zeigt. Sondern dieses Humboldt Forum soll in der Kombination mit den außereuropäischen Sammlungen, mit der Humboldt-Universität, mit der Zentral- und Landesbibliothek natürlich auch ein Zentrum sein der Auseinandersetzung."
Mit der Eröffnung des Humboldtforums – voraussichtlich 2019 - wird der Schlussstein gesetzt, das milliardenschwere Kultur-Investitionsprogramm in Berlins Mitte voraussichtlich beendet sein. Anders als in den anderen neuen Ländern, wo um jedes Theater, um jede Bibliothek gekämpft und gebangt wurde und wird, spielt das Geld in der Hauptstadt nur eine untergeordnete Rolle. Die großen Kulturinstitutionen in Berlin-Ost wurden gestärkt, nicht abgewickelt. Anders die künstlerisch bespielten Brachen, die nach 1990 entstanden – nach und nach werden die Freiräume enger. Investoren verdrängen die Künstler – auch im Tacheles, das vor zwei Jahren endgültig geräumt wurde - DJ Dr. Motte:
"Das Tacheles ist Berlin. Das ist, wenn man so will, der letzte Freiraum für jede Art von Kultur und Kunst in Mitte. Denn: Ein Land ohne Freiräume geht eigentlich unter."
"Das macht man nicht"
Keine Freiräume mehr in Mitte - so ziehen die Kreativen weiter, entdecken die Plattenbausiedlungen am östlichen Stadtrand. Karin Scheel leitet die kommunale Galerie M in der Marzahner Promenade, sie betreut im Auftrag des Bezirks Marzahn-Hellersdorf auch ein Atelierprogramm für Maler, Bildhauer, Medienkünstler.
"Wir machen einige Kunstprojekte im Jahr, die immer partizipatorische Ansätze haben. Nicht nur, das ist nicht der alleinige Zweck. Der Zweck ist immer die Kunst. Aber es geht nicht darum, in einem hermetisch abgeschlossenen Raum etwas zu präsentieren und mit einer gewissen Arroganz zu sagen, es ist mir egal, ob das jemanden interessiert oder nicht."
Künstlerische Interventionen im öffentlichen Raum – im Zentrum Berlins längst Alltag, in der Plattenbausiedlung am Stadtrand nach wie vor irritierend. Da ruft schon mal jemand die Polizei, wenn auf der Straße gegessen und gekocht wird. In Karin Scheels Büro liest man – in feinem Silberrahmen - das Zitat eines anonymen Marzahners: "Das macht man nicht!" Mühsam ist die Arbeit hier, sagt die 50jährige, in der DDR aufgewachsene Kunstwissenschaftlerin. Ihre Bilanz fällt trotzdem positiv aus:
"Wir können jetzt Dinge tun, die früher nicht machbar waren. Man kann mit Partnern arbeiten, man kann international arbeiten. Es gibt keine Reglementierungen von wegen: Das ist keine Kunst. Das ist ganz wichtig. Das spüren wir täglich, dass wir ernst genommene Orte zeitgenössischer Kunst in dieser Stadt sind."