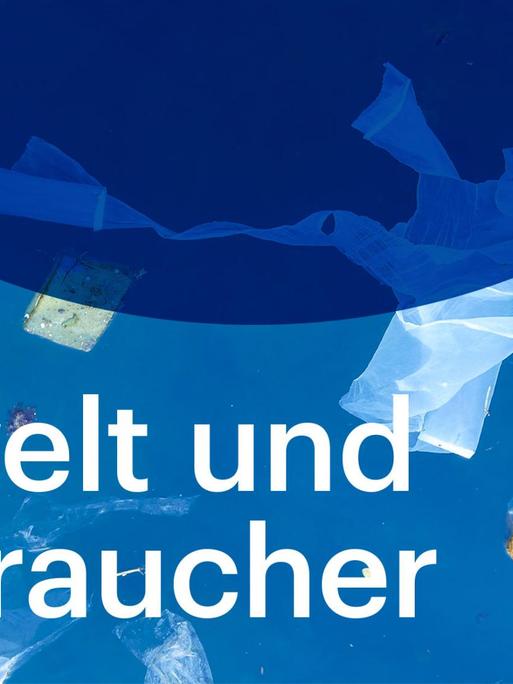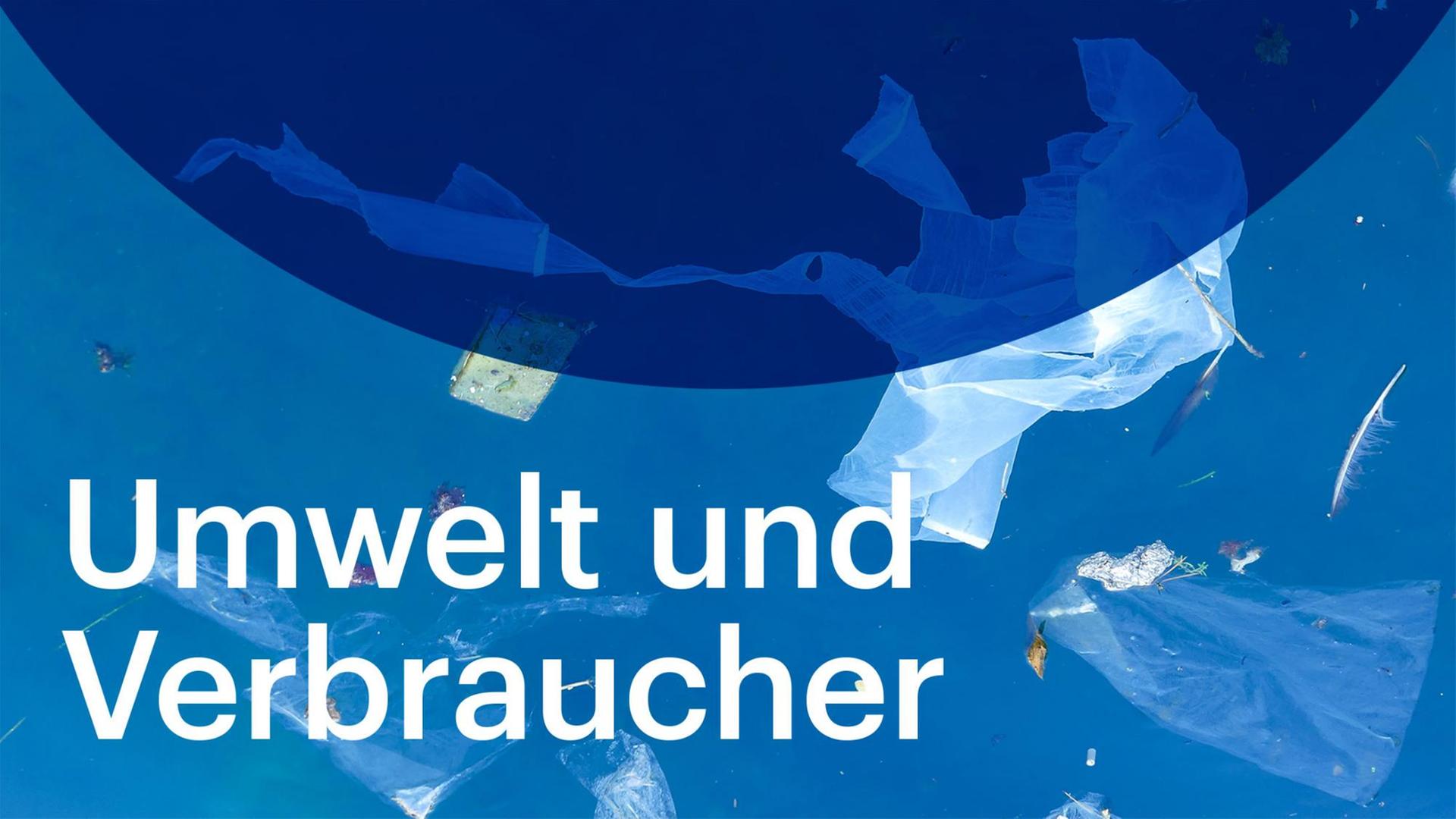Behörden warnen vor dem Baden in Seen, wenn es auf dem Wasser „blüht“, und auch die Ostsee ist als flaches und stark überdüngtes Meer besonders betroffen: Blaualgen können besonders Menschen mit Vorerkrankungen und Kinder gesundheitlich gefährden. Um sie zu bekämpfen bräuchte es einen konsequenteren Schutz von Klima und Umwelt.
Was sind Blaualgen?
Dem Leibniz-Institut für Ostseeforschung in Warnemünde (IOW) zufolge gibt es mehrere Tausend verschiedene Arten von Blaualgen auf unserem Planeten. Der Begriff „Alge“ ist dabei irreführend, denn bei Blaualgen handelt es sich eigentlich um Bakterien. Der wissenschaftlich korrekte Name: Cyanobakterien.
Algen sind nicht grundsätzlich schlecht für Gewässer. Im Gegenteil: Es gibt zum Beispiel große Makroalgen, die wichtige Ökosysteme im Meer bilden. Und selbst die Blaualgen, die von Urlaubern und der Tourismuswirtschaft so gefürchtet werden, sind wichtig für uns.
Es gibt eine einzige Art, die etwa 20 Prozent des weltweiten Sauerstoffs produziert. Vor gut zwei Milliarden Jahren waren es die Cyanobakterien, die Leben auf der Erde durch die Produktion von Sauerstoff ermöglichten.
Viele Mikroalgen dienen außerdem als Futter für kleine Meereslebewesen und binden CO2. Problematisch wird es für die Ökosysteme erst, wenn das Gleichgewicht zerstört wird und sich bestimmte Algen oder Bakterien sehr stark vermehren.
Sind Blaualgen gefährlich für den Menschen?
Die meisten nicht, aber rund 40 Arten produzieren Giftstoffe. Laut dem Leibniz-Institut für Ostseeforschung sind diese Toxine in geringer Konzentration für gesunde Menschen ungefährlich. Wenn sich die Cyanobakterien allerdings an windstillen Tagen an der Wasseroberfläche konzentrierten, könne sich in den Teppichen die Konzentration der Giftstoffe so weit erhöhen, dass es beispielsweise zu Hautreizungen und beim Verschlucken des Wassers auch zu Übelkeit und Erbrechen kommen könne, schreiben die Experten.
Besonders bei empfindlichen oder durch Krankheiten geschwächten Menschen sei deswegen Vorsicht geboten, so das Institut. Auch Kinder soll man von den Teppichen fernhalten. Bei Tieren, die toxinhaltiges Wasser getrunken hatten, sei es in der Vergangenheit auch zu Todesfällen gekommen, beispielsweise bei Rindern, Hunden und Enten.
Wann sollte man nicht baden?
Weil sich die Blaualgen-Konzentration durch Strömungen und Winde sehr schnell verändern kann, gilt als Faustregel: Wenn man bis zu den Knien ins Wasser geht und die Füße wegen der bläulich-grünen Trübung nicht mehr erkennen kann, sollte man nicht baden. Die Umweltbehörden beobachten die Situation und testen Badegewässer regelmäßig – gegebenenfalls sprechen sie Badeverbote aus. Solche Verbote gibt es jedes Jahr wieder, 2025 auch an der Ostsee und für etliche Seen in Deutschland.

Nehmen Algenblüten zu?
Algenblüten sind ein jahreszeitliches Phänomen. In der Ostsee entstehen sie zumeist weiter draußen auf dem Meer und werden dann durch Wind und Strömungen verdriftet. Welche Küste oder welchen Strand es dann trifft, ist in der Regel schlicht Glück oder Pech.
Ab einer Wassertemperatur von 20 Grad steigt die Algenmenge schnell an. Ein anderer wichtiger Faktor für ihre Zunahme sind Nährstoffe, die auf Umwegen im Wasser landen. Dass die Algen sich im Laufe der Zeit vermehrt haben, illustrieren Satellitenbilder aus den vergangenen zehn Jahren, die der NDR ausgewertet hat.
Demnach gab es besonders in den warmen Jahren 2018, 2020, 2023 und 2024 nicht nur viele, sondern auch besonders intensive Algenblüten. Vor allem im Juli und August waren die Algenteppiche dicht. Auch eine Untersuchung des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung zeigt, dass es in den vergangenen Jahren häufiger Blaualgen-Teppiche in der Ostsee gab als früher.
Können Blaualgen auch dem Ökosystem schaden?
Ja, das größere Problem haben die Meereslebewesen, nicht die Menschen. Denn die Algenteppiche sterben irgendwann ab und sinken dann zu Boden. Dort verrotten sie und produzieren dabei lebensfeindliche, sehr sauerstoffarme oder sogar -freie Zonen, in denen Fische und andere Organismen nicht mehr überleben können. Dass es in der Ostsee nur noch so wenig Fische gibt, liegt auch an diesen sauerstofffreien Zonen.
Kann man etwas gegen Algenblüten tun?
Grundsätzlich wird die Bildung der Blüten von hohen Temperaturen und dem Nährstoffeintrag begünstigt. Wer also etwas gegen sie unternehmen will, muss den Klimawandel abschwächen und die Nährstoffbelastung verringern.
Während der Klimawandel nur global bekämpft werden kann, lässt sich gegen den Nährstoffeintrag lokal etwas unternehmen. Auch wenn hier schon einiges passiert ist – die Belastung ist noch immer viel zu hoch. In Schleswig-Holstein gelangen über Landwirtschaft und Kläranlagen rund 6000 Tonnen Stickstoff pro Jahr ins Meer.
Nach aktuellen Plänen der Landesregierung soll dieser Eintrag um 200 Tonnen reduziert werden. Notwendig wäre aber eine Reduktion um das Zehnfache, also um 2000 Tonnen. Und: Selbst wenn die Situation sich verbessern sollte, würde man das erst zeitverzögert feststellen. Denn das System ist träge. Die Nährstoffe werden in der Ostsee auch in den Sedimenten eingelagert und von dort aus nach und nach wieder ausgewaschen.
ahe