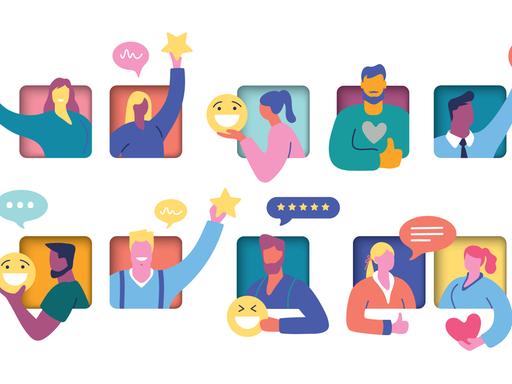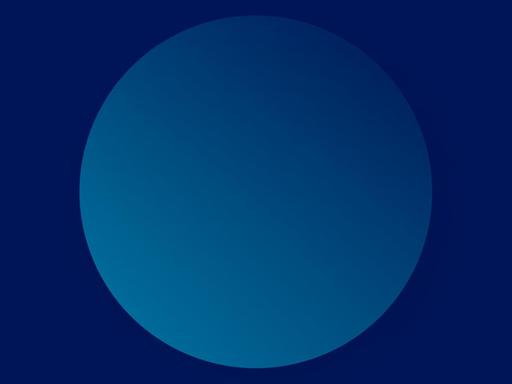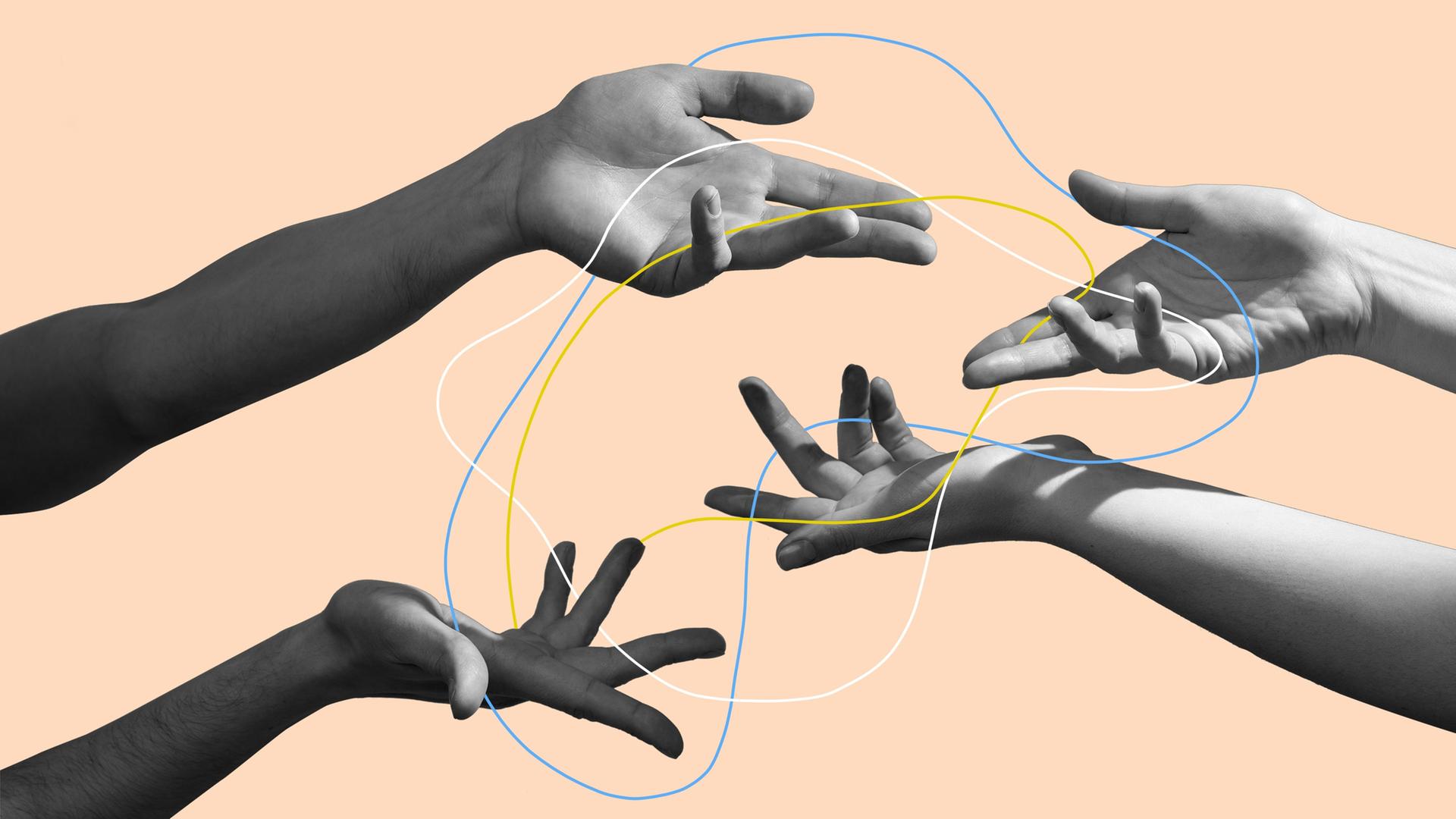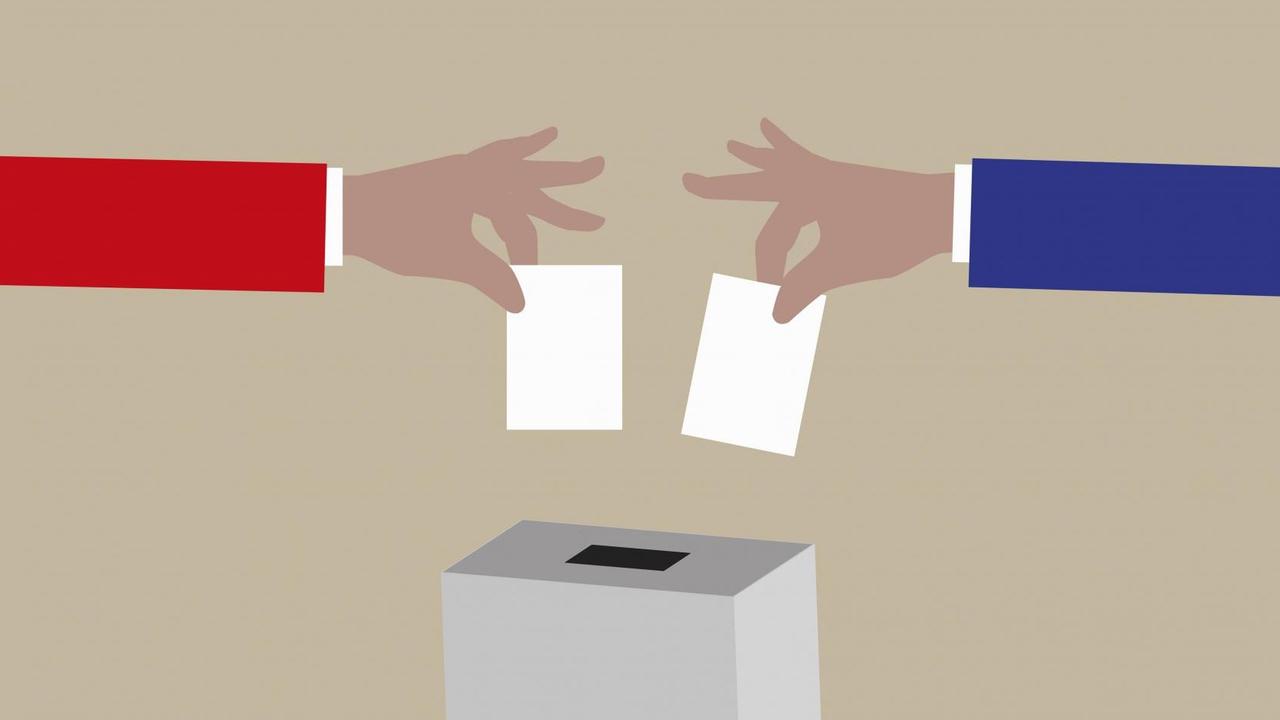In Deutschland setzen Kommunen und Länder immer mehr auf Bürgerräte, um über kontroverse, politische Fragen diskutieren zu lassen. Dabei geht es um so unterschiedliche Themen wie Stadtplanung, Kinder- und Jugend, Infrastruktur, Nachhaltigkeit, Ernährung oder Verkehr.
Bürgerräte sind mit Hoffnungen verbunden. Befürworter sehen in ihnen eine Möglichkeit, die Teilhabe von Bürgern an politischen Entscheidungen zu stärken und damit Politikverdrossenheit abzubauen. Doch an den Räten gibt es auch deutliche Kritik.
Wie funktioniert ein Bürgerrat?
Der Bürgerrat ist ein Instrument der dialogischen Demokratie (*) und soll die Politik beraten. Er wird zu einem bestimmten Thema eingesetzt, seine Mitglieder werden über die kommunalen Melderegister per Losverfahren bestimmt. Dabei wird darauf geachtet, dass der Rat den Querschnitt der Bevölkerung repräsentiert: Kriterien hierfür sind Geschlecht, Alter, Bildungsstand, die Größe der Herkunftsgemeinde und ein möglicher Migrationshintergrund.
Das macht Bürgerräte demokratietheoretisch attraktiv: Denn durch die repräsentative Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, ein auch für die gesamte Bevölkerung gültiges Meinungsbild zu ermitteln. In Bürgerräten kann jeder mit seiner Ansicht präsent sein, jede Stimme hat das gleiche Gewicht. Es gibt keine Hierarchien – und auch keine anderen Zwänge, wie beispielsweise die Fraktionsdisziplin in den Parlamenten.
Am Ende des Beratungsprozesses – nach vielen Diskussionen und der Anhörung von Experten – sollen dann konkrete Vorschläge stehen, die an die Politik übergeben werden und als Basis für politische Entscheidungen dienen können, aber nicht müssen. Die Politik ist an die Empfehlungen nicht gebunden.
Was können Bürgerräte leisten?
Befürworter sehen in Bürgerräten eine Chance für die Politik, Vertrauen zurückzugewinnen. Menschen lernen beispielsweise wie Demokratie funktioniert, wenn sie an einem Bürgerrat teilnehmen, so die Soziologin Angelika Vetter: „Sie sagen: Ich habe wirklich viel gelernt.“ Bürgerbeteiligung funktioniere immer dann besonders gut, wenn es um Fragen geht, die im Alltag der Menschen eine konkrete Rolle spielen – auf der lokalen Ebene, wie beispielsweise bei der Sanierung eines örtlichen Schwimmbades.
Großes Interesse an Basisdemokratie in Ostdeutschland
Nach Ansicht des Soziologen Steffen Mau gibt es gerade in Ostdeutschland ein großes Interesse an basisdemokratischen Organisationsformen und Verhandlungsformaten jenseits von Parteien. Das hänge auch mit den Erfahrungen nach dem Zusammenbruch der DDR zusammen, als DDR-Bürgerinnen und Bürger bei Runden Tischen und in politischen Bewegungen wie dem Neuen Forum zusammenkamen. Zum ersten Mal konnten sie sich als politische Subjekte verstehen.
Bürgerräte knüpften einerseits an diese früheren Erfahrungen Ostdeutscher an, und gingen andererseits über sie hinaus. Trotz der großen Wahrscheinlichkeit, dass dort dann auch rechte Populisten vertreten sein könnten, werden laut Mau in demokratischen Foren sehr radikale Meinungen tendenziell abgedimmt und die "leise" Mitte kann sich stärker artikulieren und durchsetzen. Deswegen hält er Bürgerräte „für eine ideale Form“.
Welche Bürgerräte gab es bereits?
Bürgerräte gibt es in Deutschland auf Bundes-, Landes- und auf kommunaler Ebene. In den Nullerjahren fanden durchschnittlich jährlich sechs Bürgerräte in Deutschland statt. In den Jahren 2020 bis 2023 stieg die Anzahl auf fast 30 pro Jahr, 80 Prozent davon auf kommunaler Ebene, so das Institut für Demokratie- und Partizipationsforschung (IDPF) der Universität Wuppertal.
Zuletzt beschäftigte sich ein Bürgerrat mit Ernährungspolitik. Im Februar 2024 überreichte er seine Vorschläge an Bundestagspräsidentin Bärbel Bas. Er geht auf eine Vereinbarung im Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung zurück. Es ist das erste Mal, dass ein solcher Rat durch den Bundestag eingesetzt wurde.
Welche Grundsatzkritik gibt es an Bürgerräten?
In einer Demokratie lässt sich kaum etwas dagegen einwenden, dass Bürger sich engagieren und an der Willensbildung mitwirken. Dennoch werfen Bürgerräte eine grundlegende Frage auf: Wie viel direkten Einfluss sollen Bürgerinnen und Bürger in einer repräsentativen Demokratie haben? Deren Grundidee ist nun einmal, dass die Wählerinnen und Wähler ihre politische Macht an Vertreterinnen und Vertreter delegieren, die die politische Fragen aushandeln und entscheiden.
Die Kritik an Bürgerräten greift deswegen vor allem ihre Rolle im politischen System auf. Durch die Räte werde "die Bedeutung von Parlamenten unterminiert", sagt etwa die CDU-Abgeordnete Gitta Connemann:
"Der Bundestag kann jederzeit Experten aus Wissenschaft und Gesellschaft befragen. Es braucht keine Alibi-Parlamente, die per Los zusammengewürfelt werden."
Losverfahren und die Verantwortung für Entscheidungen
Kritisiert wird auch das Losverfahren, mit dem die Teilnehmer von Bürgerräten ausgewählt werden. Wenn man die Teilnehmenden nicht demokratisch auswähle, sei ein Kernmerkmal der Demokratie nicht erfüllt. Bürgerräte müssten zudem – im Gegensatz zu demokratisch gewählten Abgeordneten – keine Verantwortung für ihre Entscheidungen übernehmen.
Auch gibt es Zweifel im Hinblick auf den Nutzen. Bürgerräte sind nur beratend tätig und können nichts entscheiden. Daher besteht die Sorge, dass sie als Alibi-Instrument betrachtet werden und die Politikverdrossenheit nur noch verstärken könnten, nämlich dann, wenn Politik den Empfehlungen nicht folgt.
Ob die Räte ein ernst zu nehmendes demokratisches Instrument sein können, hängt somit auch von ihrer Akzeptanz durch die Politik ab – und von deren Bereitschaft, dem Willen der Räte zu entsprechen.
(*) Wir haben einen falschen durch den richtigen Begriff ersetzt.
ahe, mkn, rwh, bd, pto, tha, cs