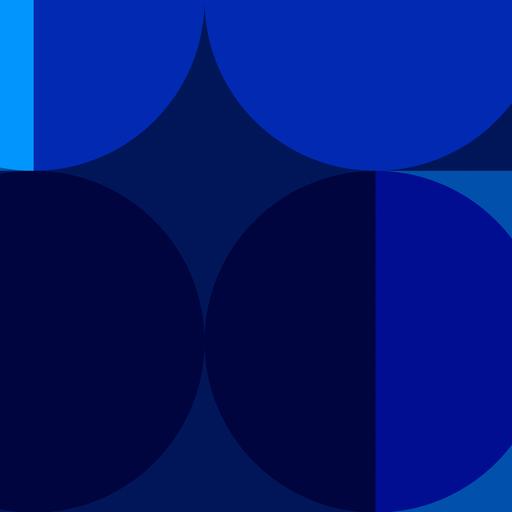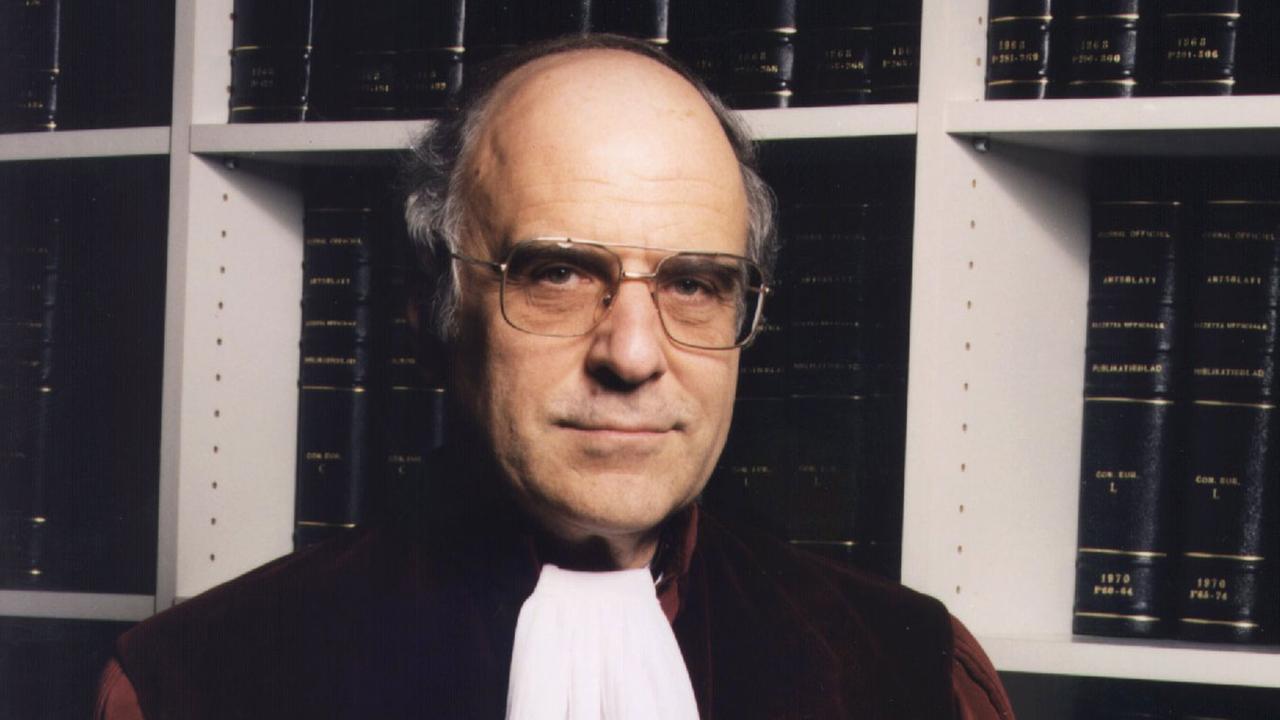
Er galt und gilt als der Experte für alle europarechtlichen Fragen, und auch sonst ist sein Lebenslauf auf das Engste mit Europa verbunden. Der Einigung des Kontinents auf der Grundlage gemeinsamer Werte wie Frieden, Freiheit, Demokratie und Toleranz galt sein lebenslanger Einsatz. Die Rede ist von Professor Doktor Carl Otto Lenz, Jahrgang 1930, geboren in Berlin. Rechtsanwalt, CDU-Politiker und ehemaliger Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof.
Schon Ende der 50er-Jahre wurde Lenz Generalsekretär der Christlich-Demokratischen Fraktion des Europäischen Parlaments in Luxemburg. Seinen Weg in den Deutschen Bundestag fand er 1965, als Lenz als Nachfolger des ein Jahr zuvor verstorbenen ehemaligen deutschen Außenministers, Heinrich von Brentano, direkt im Bundestagswahlkreis Bergstraße gewählt wurde. Ebenso 1976 und 1983. Über lange Jahre war er Mitglied im Rechtsausschuss, dessen Vorsitzender von 1969 bis 1980. Es folgten parlamentarische Funktionen im Vermittlungsausschuss, und er war Vorsitzender der Europa-Kommission des Bundestages sowie Mitglied im Wahlmännerausschuss für die Wahl von Richtern des Bundesverfassungsgerichts. Lenz engagierte sich insbesondere für die deutsch-französische Freundschaft, war Mitglied der deutsch-französischen Parlamentariergruppe und deren Vorsitzender sowie Koordinator für deutsch-französische Zusammenarbeit. Neben vielen anderen inner- und außerparlamentarischen Ämtern war Lenz zwischen 1984 und 1997 Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof in Luxemburg. Carl Otto Lenz ist verheiratet und hat fünf Kinder.
Erinnerungen an Konrad Adenauer, die Anfänge der Bonner Republik und frühe europäische Orientierungen
Stephan Detjen: Herr Lenz, wie war Konrad Adenauer, welche Erinnerungen haben Sie an ihn?
Lenz: Er war unheimlich höflich, und 1962, da gab mir mein damaliger Fraktionsvorsitzender im Europäischen Parlament, Alain Poher, den Auftrag, dafür zu sorgen, dass Adenauer ein Vorwort schreibt für das Buch von Robert Schumann für Europa. Der alte Herr, der zögerte so ein bisschen, weil er es sich nicht mit der de Gaulle verderben wollte. Und dann bin ich also nach Bonn gefahren von Luxemburg und war natürlich pünktlich. Und der alte Herr stand an der Tür, führte mich zu meinem Platz, dann ging er auf seinen Platz, und dann haben wir uns beide gesetzt, und dann habe ich das Gespräch geführt, wofür ich da war. Und dann hinterher begleitete er mich zur Türe. Diese Höflichkeit - ich hätte sein Enkel sein können -, die hat mich schwer beeindruckt. Die war ich von anderen Persönlichkeiten so nicht gewohnt.
Detjen: Generationell hätte das ja hinhauen können mit dem Enkel, und Sie kannten ihn ja in der Tat schon aus Ihrem Elternhaus. Er war bei Ihnen zu Hause.
Lenz: Ja, ja. Ja, ja.
Detjen: Was ist Ihre erste Erinnerung an Adenauer?
Lenz: Eigentlich die erste richtige erzählbare Geschichte, die ich noch weiß, war bei der Beerdigung meines Vaters. Es regnete, Schneeregen, und der alte Herr hatte keinen Hut auf, hatte ihn in der Hand. Und da sagte meine Mutter zu ihm, Herr Bundeskanzler, ziehen Sie doch den Hut auf, es regnet, und Sie werden sich erkälten. Und dann antwortete Adenauer, für Ihren Mann ziehe ich den Hut ab.

Detjen: Und dieser Mann, der da zu Grabe getragen wurde, Ihr Vater, Otto Lenz, war ein politischer Weggefährte Konrad Adenauers, Staatssekretär in Adenauers Kanzleramt in Bonn. Zuvor, in der Weimarer Zeit, Jurist, Richter, von den Nationalsozialisten entlassen, Gegner des Nationalsozialismus wegen seiner Kontakte, wegen der Rolle, die ihm die Verschwörer vom 20. Juli zugewiesen hatten. Im Zuchthaus, am Ende des Krieges, und von den Russen befreit. Was war Ihr Vater für ein Mensch?
Lenz: Er spielte mit uns Kindern. Er hatte wenig Zeit, aber sonntags nahm er sich Zeit. Und da haben wir Eisenbahn gespielt, oder Schach habe ich bei ihm gelernt, Skat habe ich bei ihm gelernt. Ich habe sehr lebhafte Erinnerungen an ihn, eigentlich stärkere Erinnerungen an ihn als an meine Mutter, obwohl die dauernd um uns herum war und der Vater immer selten da war.
Detjen: Er war ein preußischer Demokrat und jemand, der sich sehr früh für das Wirken der Öffentlichkeit, der Medien, der Presse interessiert hat. Eigentlich ein ganz zeitgemäßes Thema, ein ganz modernes Thema. Als Jurist hat er das getan, und das hat ihn dann auch ins Kanzleramt gebracht, 1951, glaube ich.
Lenz: So sehe ich das auch. Und er hatte ja damals sehr eng zusammengearbeitet mit der Frau Noelle-Neumann, die er schon vorher kannte. Wir waren bei ihr zu Besuch am Bodensee. Ich kann mich da noch ganz gut dran erinnern. Und der glaubte fest daran, dass eine der Ursachen des Scheiterns der Weimarer Republik die fehlende Kommunikation zwischen Regierung und Volk war. Und dieser Aufgabe hat er sich eigentlich gewidmet.
Detjen: Und er wurde dann bei Adenauer Staatssekretär im Kanzleramt, aber auch so etwas wie der erste Chef des Bundespresseamtes, das damals noch nicht so hieß, aber die Vorgängerinstitution, die ihr Vater, Otto Lenz, aufgebaut hat.
Lenz: Ja. Er war allerdings nicht Sprecher der Bundesregierung, aber diese Diensteinheit, die heute Presseamt heißt, die unterstand ihm.
Detjen: Dieses Elternhaus - Sie waren zu viert, drei Geschwister hatten Sie - muss ein sehr politisches Elternhaus gewesen sein. Auch Ihre Schwester Marlene ist Europapolitikerin geworden, war in der CDU als Frauenpolitikerin Vorsitzende der Frauenunion aktiv, später gehörte sie dem ersten direkt gewählten Europaparlament an. Haben die Kinder Lenz da auch das Werk des früh verstorbenen, mit 54 Jahren verstorbenen Vaters fortgesetzt?
Lenz: Während er Staatssekretär und Abgeordneter war, haben sich meine Schwester und ich zurückgehalten, wenn man das so sagen darf. Wir wollten da keine Komplikationen haben. Aber nachdem er gestorben war, sind wir beide in die CDU eingetreten, und sie ist dann - sie war vorher eine Zeit lang in Paris gewesen bei einer europäischen Organisation privater Art und sprach also fließend französisch, hatte auch französisch gelernt, und kam dann 1958 mit der ersten Kommission nach Brüssel, als die damals noch im Hotel Metropol am Platz in der Innenstadt saßen, und war dann später in Brüssel. Ich hab sie da auch ein paar Mal besucht, und wir waren eigentlich beide, haben das so gesehen als Wirken im Sinne unseres Vaters. Und als ich noch Referendar war, da wurde mir von Hans Furler die Stelle des Generalsekretärs der Christlich-Demokratischen Fraktion des Europäischen Parlaments angetragen, und drei Tage nach dem Assessorexamen habe ich da angefangen. Und da war mein Chef dann Alain Poher, französischer Senator.
Detjen: Das war ein Europäisches Parlament, eine parlamentarische Versammlung, die noch relativ wenig mit dem zu tun hatte, was wir heute als Europaparlament kennen und jetzt wieder wählen.
Lenz: Es war noch das indirekt gewählte Parlament. Und dieses indirekt gewählte Parlament hätte niemals die Rolle spielen können, die das direkt gewählte Parlament heute spielt. Ich will ein Beispiel sagen. Wir hatten eine für uns wichtige Abstimmung im Europäischen Parlament, und das Parlament konnte nur Einfluss haben, wenn es geschlossen war, und am Tag vor der Abstimmung in Straßburg wurde in Bonn eine namentliche Abstimmung angesetzt. Daraufhin fuhr die gesamte deutsche Delegation, alle Parteien, nach Bonn. Und die Abstimmung, ohne die Deutschen, hätte das politische Gewicht nicht gehabt, die die bräuchte. Also, die direkte Wahl des Europäischen Parlaments war eine unverzichtbare Voraussetzung dafür, dass es eine mächtige Institution wird.
Detjen: Aber es war eine Vision ja wahrscheinlich in dem, was die Mitglieder dieser ersten parlamentarischen Versammlung damals der Europäischen Gemeinschaft, der Gemeinschaft für Kohle und Stahl, wie sie damals ja noch hieß, angetrieben hat. Es war eine Versammlung, wenn man das nachliest, von europäischen Visionären.
Lenz: Ja. Frei nach Hallstein: Wer in Europa nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Und es war eben bemerkenswert, dass diese Abgeordneten, obwohl sie von dem nationalen Parlament gewählt waren, durchaus das Recht für sich in Anspruch nahmen, anders zu stimmen als ihre Kollegen in Bonn. Oder sie selber hätten vielleicht stimmen müssen, wenn sie an der Abstimmung teilgenommen hätten. Das war eigentlich schon ganz bemerkenswert, dieses Selbstbewusstsein, wir haben eine besondere Aufgabe.

Detjen: Die Vorstellungen, die man von einem Europa der Zukunft hatte, gingen ja bei vielen der Akteure damals weit über das hinaus, was wir bis heute erreicht haben. Die Einigkeit darüber, dass wir uns auf die Vereinigten Staaten von Europa zubewegen, hat damals viel mehr auch Parteien geeint als das heute der Fall ist. Aus heutiger Sicht - ist Europa eigentlich über das hinausgewachsen, was Sie sich damals erhofft hatten, oder ist es hinter den Erwartungen, hinter den Hoffnungen, die Sie damals vereint hat mit Ihren anderen Parlamentsmitgliedern, zurückgeblieben?
Lenz: Also ich würde schon sagen, wir sind weiter. Wir sind zwar nicht die Vereinigten Staaten von Europa geworden, aber die umfassten ja damals, nach der damaligen Vorstellung, sowieso nur Westeuropa. Und dass es möglich war, die ehemaligen Länder des Warschauer Pakts, sogar drei Sowjetrepubliken zu integrieren, das wäre in den kühnsten Träumen niemandem eingefallen. Man hat zwar immer gesagt, wir sind für euch da, und wir werden euch aufnehmen, wenn ihr kommt. Aber dass die Sowjetunion zusammenbrechen würde, daran hat nun wirklich niemand gedacht. Die Entwicklung ist anders gelaufen, aber ich glaube, vieles von den Vorstellungen der damaligen Zeit ist doch verwirklicht worden. Das Europa des Friedens. Stellen Sie sich mal vor, Ungarn und Rumänien, die müssen sich eigentlich automatisch an die Gurgel greifen, wenn man sich mal die Geografie und Geschichte anguckt. Aber das tun sie nicht. Und wenn die Serben und die Kosovaren heute ruhig halten, dann deshalb, weil sie in die Europäische Union wollen und wissen, wenn sie Krieg gegeneinander führen, können wir das vergessen. Auch zwischen Mazedonien und Griechenland gibt es sehr starke, starke Spannungen, die einfach nur deshalb im Zaum gehalten werden, weil jedes Land, das gegen das Friedensgebot verstoßen würde, sich außerhalb der Gemeinschaft stellen würde.
Detjen: Das wird uns ja heute wieder in Erinnerung gerufen. Wir sehen auf die Krise in der Ukraine, und manche hatten schon vergessen, dass diese Europäische Union auch eine Friedensordnung ist. Manchen war das selbstverständlich, damals war das tatsächlich eine Vision, das friedliche, gesichert friedliche Europa. Welche derer, die damals die Vorreiter waren - Hallstein haben Sie gerade schon erwähnt - welche Politiker haben Sie damals ganz besonders beeindruckt und geprägt auch?
Lenz: Also Hallstein hat mich schon sehr beeindruckt und ich war ganz stolz, dass das erste Glückwunschtelegramm für meine Wahl in den Bundestag von ihm kam. Und wir haben uns gut verstanden, und wir haben uns gegenseitig unterstützt, soweit mir das möglich war. Man hatte eine unheimlich strukturierte Sprache. Nach den ersten drei Sätzen konnten Sie also die Rede eigentlich ableiten, weiterführen. Das war ungeheuer eindrucksvoll, verglichen mit den Reden Adenauers, die ganz anders strukturiert waren, oder denen von Erhard, der für meine Begriffe über die Köpfe der Leute hinweg redete. Hallstein - man musste ihm zuhören, aber es war einfach, ihm zuzuhören, weil sich die Gedanken ganz logisch entwickelten.
Ein Politiker mit dem Schwerpunkt Recht, die Konflikte um die Notstandsgesetze und die bleierne Zeit des RAF-Terrors
Detjen: Sie haben es schon erwähnt, Sie wurden dann Mitglied des Deutschen Bundestages, 1965 war das, sind Sie nachgerückt im Wahlkreis des verstorbenen Fraktionsvorsitzenden, Heinrich von Brentano, des ehemaligen Außenministers auch. Ein Weggefährte und, ich glaube, auch Freund Ihres Vaters?
Lenz: Ja, ja, ja. Die kannten sich gut.
Detjen: Das war ein prominenter Wahlkreis, den Sie da hatten. Dann waren Sie vor allen Dingen Rechtspolitiker. Sie waren elf Jahre, von 1968 bis 1980 Vorsitzender des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages. Die Rechtspolitik war ein ganz zentrales Feld der Politik in dieser Zeit, viel zentraler, als das die Rechtspolitik heute ist, ganz wichtige politische, verfassungsrechtliche Entwicklungen sind da ausdiskutiert, gestaltet worden. Die Notstandsverfassung, wichtige Reformen in der Familienpolitik, im Strafrecht wurden in diesem Ausschuss verhandelt.
Lenz: Ja. Es war ein absolut zentraler Ausschuss, und es war für Personen, die in anderen politischen Systemen groß geworden sind, außerordentlich schwierig zu verstehen, wie so ein zentraler Ausschuss von einem Oppositionspolitiker geleitet werden sollte. Das war eigentlich überhaupt kein Problem, das akzeptierten alle. Und wenn ich mal, was fast nie vorkam, eine Sitzung nicht leiten konnte, dann kamen die Oppositionsabgeordneten und sagten, das nächste Mal müssen Sie aber wieder da sein. Es war eine sehr schöne Aufgabe, wenn man mal begriffen hatte, wie die Anliegen der beiden Seiten sind. Die Regierung will nur abstimmen, und die Opposition will nur reden. Man muss also der Regierungsseite beibringen, dass eine gewisse Zeit zum Reden da sein muss, und der Opposition klar machen, dass irgendwann in einer vernünftigen Zeit auch eine Abstimmung stattfinden muss.
Detjen: Eines der ganz wichtigen Themen, das Sie gerade am Anfang beschäftigt hat, war die Auseinandersetzung um die Notstandsverfassung. 1968 verabschiedet, das Thema, das die Gesellschaft damals wie wenige andere mobilisiert, gespalten hat, im Parlament, außerhalb des Parlaments, Studentenbewegung, APO - wie sehen Sie diesen Streit, diese Auseinandersetzung rückblickend?
Lenz: Als das Gesetz verabschiedet war, 1968, da war die Sache vorbei.

Detjen: Ist nie angewendet worden?
Lenz: Ist nie angewendet worden, und die ganze Bewegung - ich glaube, das Gesetz ist Ende Juni '68 im Gesetzblatt veröffentlicht worden. Zum 1. Juli hat der DGB die Finanzierung des Sekretariats der Anti-Bewegung eingestellt, und damit war der Fall erledigt. Das ist in sich zusammengefallen wie nichts, und vorher war es ein Riesenkrach. Also wenn ich meine Rede noch mal nachlese, die ich damals gehalten habe zur Verabschiedung, da hatte am Tag davor die Demonstration stattgefunden im Bonner Hofgarten mit 10.000 Leuten, wo die übelsten Verdächtigungen geäußert wurden. Und deswegen habe ich immer wieder gesagt, es ist nicht wahr, dass ... – es ist nicht wahr, dass ... Aber im Bundestag verlief die Sache eigentlich sehr gut. Im Ausschuss hatte ich als Gesprächspartner bei der SPD den Gerhard Reischl, der auch mein Vorgänger beim EUGH war, und außerdem waren da Matthöfer, der war der Sprecher der SPD-internen Opposition gegen die Gesetzgebung, und er pflegte dann immer zu sagen, das und das und das wollen wir ja, das steht doch schon drin, sagte ich da - ja, wenn es schon drin steht, dann kann man es ja auch ausdrücklich reinschreiben. Und das haben wir in vielen Fällen gemacht. Und wir waren uns in einem einig: Wir wollten den Notstand nicht zur Stunde der Exekutive werden lassen, sondern wir wollten die parlamentarische Demokratie auch im Notstand praktizieren. Natürlich in einer Form, die dann möglich sein musste, daher der gemeinsame Ausschuss aus Bundestag und Bundesrat, der die gesetzgebenden und kontrollierenden Funktionen des Parlaments übernehmen sollte. Und diese Konzeption, die hat sich ganz durchgesetzt, und das konnte ich umso unbefangener tun, als ich mit den Auseinandersetzungen der beiden vorhergehenden Wahlperioden überhaupt nicht befasst war.
Detjen: Die große Bewährungsprobe, der große Angriff auf die Demokratie kam ja dann zehn Jahre später in der Zeit des Terrorismus. Auch diese Diskussion haben Sie eng mit verfolgt. Die Notstandsgesetze kamen nicht zum Zug, aber trotzdem gab es halsbrecherische Gesetzgebungsverfahren, Gesetze, die über Nacht durch den Bundestag gingen. Die Demokratie hat ihre Belastungsfähigkeit da ausprobiert.
Lenz: Ja, das war eine schlimme Zeit. Ich hatte damals Personenschutz, und das war also eine Mauer im Wahlkreis. Wenn Sie eine Veranstaltung hielten, patrouillierten da draußen welche und guckten, ob die Vorhänge der Fenster richtig geschlossen waren. Sie kamen mit einem Wagen vom BKA, und es war völlig unsinnig, das Ganze, denn ich wohnte damals in einem Haus, wo zwischen dem Hoftor und der Haustür etwa 75 Meter waren. Die Zuständigkeit des BKA endete am Hoftor, und die 75 Meter hätten völlig ausgereicht durch jemanden, der im Gebüsch oben drüber versteckt war, einen zu erschießen. Aber dafür war die örtliche Polizei zuständig, und die war gar nicht da. Ich hatte auch bei der Beerdigung von Schleyer, das war irgendwie bewegend. Neulich hat eine Veranstaltung der Hanns-Martin-Schleyer-Stiftung stattgefunden, wo also ein - wie soll ich das sagen - Aussöhnung zwischen Schmidt und der Familie Schleyer stattfand. Und Sie konnten sich dieser Schutzmaßnahmen auch nicht entziehen. Der Peter Lorenz in Berlin hatte das getan und war dann gekidnappt worden und musste freigekauft werden. Und das wollte keiner mehr haben.
Detjen: Es gab auch Diskussionen, auch in der Union damals, ob der Rechtsstaat mit seinen Mitteln dieser Bedrohung nicht unterlegen sei, ob man nicht zu ganz anderen Mitteln greifen müsste. Im Krisenstab damals, Strauß war ja auch dabei, während der Schleyer-Entführung ging das bis dahin, muss man unter Umständen Terroristen erschießen. Gab es Momente, wo Sie daran gezweifelt haben, ob sich das rechtsstaatlich bewältigen lässt, ob der Rechtsstaat da seine eigenen Begrenzungen, auch die parlamentarischen Begrenzungen, die Sie gerade erwähnt haben mit Blick auf die Notstandsverfassung, einhält?
Lenz: Es gab solche Stimmen, aber die CDU-Leute im Rechtsausschuss, die waren alle der Meinung, es geht auch ohne Sondermaßnahmen. Und diesen Standpunkt haben wir auch in der Fraktion erfolgreich durchgesetzt.
Die Reformgesetze der 70er-Jahre, Fragen der Verfassungsreform und Carl Otto Lenz als möglicher Bundesjustizminister im Kabinett Helmut Kohl
Detjen: Die 70er-Jahre waren - wir haben jetzt über Bedrohungen gesprochen - aber auch eine Zeit gesellschaftlichen Wandels, wir haben das eben schon erwähnt, Familienpolitik, Mitbestimmung, Strafrechtsreformen, das waren wichtige Themen. Welche Entwicklungen waren Ihnen besonders wichtig damals?
Lenz: Bei der Mitbestimmung habe ich einen sehr mitbestimmungsfreundlichen Standpunkt vertreten. Es war nicht überall gern gesehen, aber - mein Gott, ich habe ja vorhin davon gesprochen, dass ein Abgeordneter frei ist. Die Freiheit muss er aber auch ausüben. Er muss sie nicht nur haben, er muss sie auch ausüben gelegentlich. Und bei dem ersten Eherechtsreformgesetz, wie das hieß, was ja praktisch eine Neuformulierung des Scheidungsrechts war, ja, da haben wir uns sehr mit der Regierungsmehrheit auseinandergesetzt. Das war damals der Bundesminister Vogel, und das Schöne an der Geschichte war eigentlich, mit ihm konnte man sachlich unterschiedlicher Meinung sein, ohne dass die persönlichen Beziehungen darunter litten. Er hatte eins mit Adenauer gemeinsam: hervorragende Umgangsformen, und die erleichtern halt das Leben. Wir sind dann noch nachher bis in den Vermittlungsausschuss gegangen, ich war da auch drin. Das Vermittlungsergebnis ging natürlich ein Stück in Richtung der Mehrheit, es konnte ja gar nicht anders sein. Wenn man die Mehrheit nicht hat im Bundestag, sondern nur im Bundesrat, dann muss der Standpunkt zwischen den beiden irgendwie angenähert werden, sonst gibt es kein Vermittlungsergebnis. Und ich hatte das Vermittlungsergebnis aus Überzeugung auch vertreten, und ich glaube, das war auch richtig so.
Detjen: Sie haben dann damals auch eine Rolle als Verfassungspolitiker, als Verfassungsjurist gespielt. Es gab eine Enquetekommission, es gab viel Nachdenken über Verfassungsreformen. Gut 20 Jahre war das Grundgesetz damals alt.
Lenz: Älter schon!
Detjen: 30 Jahre war das Grundgesetz damals, in den 70er-Jahren schon alt. Welchen Reformbedarf haben Sie damals gesehen?
Lenz: Die erste Reform des Grundgesetzes war ja die Notstandsverfassung. Da war eine Lücke, das konnte niemand bestreiten, und die Lücke haben wir ausgefüllt. Das nächste war dann die Finanzverfassungsreform von '69, wo ich gerne einen lesbareren Verfassungstext gehabt hätte, einen, den der Bürger auch verstehen kann. Und wir haben es auch fertiggebracht, dass der erste Reformentwurf, der diesen Wünschen nicht entsprach, gescheitert ist. Dann hat Barzel zu mir gesagt, so, jetzt haben Sie Ihren Sieg erfochten, aber jetzt, im zweiten Anlauf muss das Ding dann doch verabschiedet werden. Das fand ich dann auch, aber um zu zeigen, dass es eine andere Alternative gab als diese mit den Ländern ausgehandelte Finanzverfassungsreform, wobei die den Text des Grundgesetzes überhaupt nicht interessierte. Die interessierte ausschließlich, ob eine Mark mehr oder weniger für sie dabei rumkam. Die hatten so Tabellen, das war alles vorherberechnet, was das kostet und was das bringt. Und die Kampfparole war: Kein rotes Geld in schwarze Kassen. Wenn ich heute die Auseinandersetzungen in Europa sehe, ich muss sagen, das habe ich in Deutschland auch erlebt.
Detjen: 1982, Herr Lenz, gab es dann den Regierungswechsel. Helmut Kohl wurde Bundeskanzler, und manche haben sich gedacht, na, der Carl Otto Lenz, das wäre doch jemand für die Bundesregierung - Sie kamen nicht rein. Wären Sie damals gern in die Regierung gegangen?
Lenz: Ich würde sagen, ja. Es war ja schon mal 1972 davon die Rede, damals in der berühmten Bundestagswahl. Damals haben wir die Mehrheit nicht gekriegt, und auch 1982 gab es ja einen Koalitionspartner, und wir mussten den doch gut behandeln, sonst war keine Mehrheit da. Also, es hat mich - ich war nicht traurig darüber, weil ich fand das völlig richtig und habe das jederzeit verteidigt, dass das Ministerium, für das ich am ehesten in Frage gekommen wäre, an die FDP gegangen wäre.
Detjen: Justiz. Klar.
Lenz: Da muss man nun Prioritäten haben. Es war wichtiger, dass wir den Kanzler stellten, als dass ich Justizminister wurde.
Wechsel von der Politik zum Europäischen Gerichtshof, und die europapolitische Rolle des Deutschen Bundesverfassungsgerichts
Detjen: Und dann kam was ganz Neues, dann kam eine Zäsur, Sie gingen nämlich aus der Rolle des Politikers raus und gingen nach Luxemburg als Generalanwalt an den Europäischen Gerichtshof. Und das muss man jetzt wahrscheinlich erklären, was das ist. Der Generalanwalt, in Deutschland, im deutschen Justizsystem gibt es das nicht. Das ist so eine Art Vordenker, eine Art Chefgutachter des Gerichts - richtig beschrieben?
Lenz: Ja, richtig, Chefgutachter ist eine sehr gute Bezeichnung.
Detjen: Was hat Sie gereizt an der Aufgabe?
Lenz: Das man wieder vernünftig arbeiten konnte. Als Richter, und das ist ja praktisch eine Richterfunktion, haben Sie ein Aktenstück vor sich, das sich nicht mehr verändert. In der Politik kann jeden Augenblick etwas eintreten, was die Gegebenheiten verändert. Man läuft immer ein bisschen hinter den Ereignissen her. Und das ist eben in dem Fall nicht der Fall gewesen. Das Zweite war, dass ist eine wahrhaft unabhängige Position. Sie haben niemanden über sich. Sie haben auch keine Kollegen, die Ihnen sagen können, schreiben Sie bitte so oder sonst stimme ich dem nicht zu. Sie können sich überlegen, was die richtige Lösung ist und können die vorschlagen, und niemand kann Sie daran hindern. Im Bundestag als Abgeordneter sind Sie zwar auch unabhängig und Ihrem Gewissen verpflichtet, aber Sie haben damals, ich weiß nicht, 500, und heute 600 Kollegen, und wenn Sie deren Interessen missachten, dann kommen Sie nicht sehr weit. Also, die Unabhängigkeit im Bundestag heißt, Sie sind Herr über Ihr eigenes Abstimmen, aber Sie müssen damit rechnen, dass andere aus Ihrem Abstimmungsverhalten Konsequenzen ziehen. Das ist da anders gewesen. Ob die Konsequenzen ziehen oder nicht, ist die Rechtssache der Richter. Ich kann schreiben, was ich für richtig halte. Das war herrlich.

Detjen: Und meistens ist es ja bis heute so, dass das Gericht, dass der Europäische Gerichtshof diesem Gutachten der Generalanwälte zumindest in den Grundlinien folgt. Jetzt sind Sie aus der parlamentarischen Diskussionskultur raus in eine ganz andere Diskussion. Da sitzen Richter aus allen Ländern der Europäischen Union und Generalanwälte zusammen, da wird übersetzt, da treffen unterschiedliche Rechtskulturen, unterschiedliches richterliches Denken, das in ganz unterschiedlichen nationalen Rechts- und Justizsystemen geprägt ist, zusammen. Wie haben Sie das erlebt?
Lenz: Sie haben das ganz richtig geschildert. Sie haben so viele Rechtskulturen wie Richter. Aber die haben eines gemeinsam, die Aufgabe, das Gemeinschaftsrecht auszulegen. Und sie haben keine näher oder ferner stehende Richter. Es gibt keine, mit denen Sie schon mal früher gestritten haben in anderer Eigenschaft.
Detjen: Dieses Gericht ist ja wirklich ein besonderes Gericht. Weltweit gibt es kein vergleichbares Gericht wie diesen Europäischen Gerichtshof. Es ist ein verhältnismäßig junges Gericht immer noch, das sich auch in der Entwicklung befindet. Es ist ein erstinstanzliches europäisches Gericht in Luxemburg ebenfalls hinzugekommen. Es hat auch immer wieder Diskussionen um das Selbstverständnis dieses Gerichts gegeben, um seine Rolle, um sein Verhältnis gegenüber nationalen Gerichten. Manche haben den Europäischen Gerichtshof und wollten ihn sehen als einen Motor der europäischen Integration - wie haben Sie ihn gesehen?
Lenz: Also, ich habe das schon damals immer wieder gehört und dem immer wieder widersprochen. Das ist erstens seine Aufgabe nicht, das steht im Vertrag nicht drin so, und zum Zweiten ist es auch der Sache nach nicht möglich, denn Sie können ja nur ein Urteil sprechen, wenn es einen Rechtsstreit gibt. Und ob es einen Rechtsstreit gibt oder nicht, das haben Sie überhaupt nicht in der Hand. Wir haben kein Klagerecht der Bevölkerung - ich meine, wenn Sie das haben, können Sie eigentlich sicher sein, irgendjemand wird sie schon anrufen - sondern sie können nur angerufen werden von nationalen Gerichten, das ist der überwiegende Fall, von den Mitgliedsstaaten und von den Organen der Europäischen Union, also von der Kommission, im Rat und durch das Parlament. Und nur bei dem Gericht - früher Erster Instanz - heute heißt es das Gericht - da gibt es Klagen von Privatpersonen, wenn sie durch einen Rechtsakt unmittelbar und persönlich und direkt und unmittelbar betroffen sind. Und das gibt es vor allen Dingen eben im Wettbewerbsrecht, wo eben die Kommission eine Entscheidung erlässt, die den Einzelnen direkt betrifft.
Detjen: Manchen Menschen ist erst im Laufe der Zeit, erst spät, manchem bis heute nicht aufgegangen, welche Rolle dieser Europäische Gerichtshof eigentlich inzwischen für alle Bürger spielt. Es ist ein Gerichtshof geworden, der europäische Grundrechte ausformuliert, geprägt hat - Gleichbehandlung von Mann und Frau, inzwischen auch Datenschutz – sind Rechtsgebiete, die maßgeblich auch in Deutschland inzwischen durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs geprägt werden. Der Fall, der vielleicht der spektakulärste in Ihrer Amtszeit war und der vielen dann dieses Gericht wirklich ins Bewusstsein gerufen hat, war ein Fall, da ging es um Fußball - der Fall Bosmann. Was war das für eine Geschichte?
Lenz: Das war eine schöne Geschichte, Bilderbuchgeschichte. Der Bosmann war Mitglied eines belgischen Fußballklubs, und sie konnten sich nicht einigen über einen neuen Vertrag. Er hatte also gar keinen Vertrag mehr mit diesem Fußballklub und wollte deshalb zu einem anderen Fußballklub gehen, nach Nordfrankreich, zwischen Belgien und Nordfrankreich gibt es eine gemeinsame Sprache, da gibt es eigentlich praktisch keine Grenze. Und dazu war es notwendig, dass jemand an den belgischen Verein eine bestimmte, ziemlich große Summe Geldes zahlt, damit der Fußballklub, mit dem er keinen Vertrag mehr hatte, ihm eine Freigabebescheinigung gibt. Und da die Summe Geld nicht kam, konnte er den neuen Posten nicht antreten, denn das war nicht nur eine nationale Vereinbarung, die es in allen UEFA-Vereinen und -Ländern gibt, sondern das war sogar weltweit abgestützt durch die FIFA.
Also, wenn man in ein anderes Land ging, unterlag man den gleichen Regeln. Und er hatte sehr gute Anwälte, ich weiß nicht, wie er da dran gekommen ist, die haben dann gesagt, klag doch mal, das kann nur gut gehen. Es hat dann also eine komplizierte Vorgeschichte gegeben, die ich jetzt hier nicht ausbreiten will. Schließlich hat ein Gericht, ein Berufungsgericht in Belgien, die Sache dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt. Und was die Fußballverbände unter allen Umständen verhindern wollten, war, dass es hier einen Rechtsspruch eines ordentlichen Gerichts gibt. Die wollten das in der Vereinsgerichtsbarkeit abhandeln. Und deswegen war die wichtigste Frage in diesem Rechtsstreit: Ist der Gerichtshof überhaupt zuständig? Wenn Sie meine Schlussanträge lesen - etwa ein Drittel beschäftigt sich nur mit dieser Frage. Die zweite Frage war: Ist das eine Beeinträchtigung der Arbeitnehmerfreizügigkeit? Wenn der nicht gehen kann, weil erst sein abgebender Verein, mit dem er gar keinen Vertrag mehr hat, Geld haben will - dass das eine Beeinträchtigung der Freizügigkeit war, das war für mich eigentlich sonnenklar. Und das muss eigentlich jedermann sonnenklar gewesen sein. Damals gab es in fast allen Vereinssatzungen Klauseln, wonach nur so und so viele Ausländer in einem nationalen Verein spielen dürfen, und diese Klausel war natürlich europarechtlich nicht zu halten, da steht, dass Gründe der Staatsangehörigkeit niemals eine Diskriminierung rechtfertigen. Das steht da dick und fett drin seit 1958. Also auch das musste mit Ja beantwortet werden, und so habe ich denn auch meine Schlussanträge gestellt.
Detjen: Und auch in diesem Fall ist das Gericht Ihrem Schlussantrag gefolgt. Und nicht allen ist das ganz genehm, manchen ist das suspekt, manche fragen, wie ist das eigentlich mit den Gerichten in Europa, wer ist denn da nun der Ober und wer ist der Unter – besonders, wenn man auf das Verhältnis des nationalen, mächtigen Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe und dieses Gerichts in Luxemburg schaut, und das ist ja eine Auseinandersetzung, ein Spannungsverhältnis, das uns auch jetzt aktuell wieder beschäftigt. Zum ersten Mal in seiner Geschichte hat das Bundesverfassungsgericht im Streit um die Kompetenzen der Europäischen Zentralbank, einen Fall, eine Verfassungsfrage dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg vorgelegt. Und es ist noch gar nicht ganz klar, ob sich Karlsruhe dann am Ende dem unterordnen wird, was die Luxemburger Richter da sagen. Kann das noch mal zu einer richtigen Verfassungskrise in Europa führen zwischen den obersten Gerichten?
Lenz: Also schon als Generalanwalt habe ich immer gesagt, ich bin Generalanwalt und kein Prophet. Aber es ist angelegt, aber ich finde es gut, dass das Bundesverfassungsgericht diese Sache vorgelegt hat, denn das hätte man nur vermeiden können mit juristischen Klimmzügen, die eines Gerichts eigentlich nicht würdig sind.
Detjen: Das haben die Gerichte ja
oft genug gemacht, dass sie viel unternommen haben, um das zu vermeiden, diese Frage, wer hat da wem was zu sagen, um die zu umgehen.
Lenz: Ja, aber hier war das so offensichtlich europarechtlich, dass das wie gesagt nur mit juristischen Klimmzügen zu verhindern g
Detjen: Und unter Umständen akzeptieren, dass die europäischen Richter das nun mal anders sehen. Das Bundesverfassungsgericht sagt, die EZB hat in der Eurokrise ihre Kompetenzen überschritten, und viele sagen, das wird der Europäische Gerichtshof wahrscheinlich anders sehen.ewesen wäre. Nun hat man vorgelegt, und das Bundesverfassungsgericht hat ja auch seine eigene Auffassung dargelegt, und auch das finde i
ch richtig. Das steht sogar ausdrücklich in den Anleitungen drin, die der Gerichtshof für Vorlagefragen macht. Wie kann denn der Gerichtshof eine richtige Antwort auf eine Frage geben, wenn er die Bedenken nicht kennt, die zur Vorlage der Frage geführt haben. Das ist schon in Ordnung. Und dann ist, wenn der Gerichtshof sein Urteil gesprochen hat, geht das ja wieder automatisch zurück ans nationale Gericht. Und dann muss das Bundesverfassungsgericht entscheiden.
Lenz: Der Europäische Gerichtshof hat natürlich eine ganz andere Entscheidungsgrundlage als das Bundesverfassungsgericht. In diesem Verfahren können sich alle Mitgliedsstaaten, alle 28 Mitgliedsstaaten, die Kommission und die EZB äußern. O
b das Parlament und der Rat das auch können, das wage ich im Augenblick nicht zu entscheiden, aber jedenfalls wird der Europäische Gerichtshof genau wissen, was alle 28 Mitgliedsstaaten darüber denken. Und er wird darauf sein Urteil aufbauen. Und ich nehme an, dass das Bundesverfassungsgericht diesen Sachverhalt auch zur Kenntnis nehmen wird, und dann werden wir mal sehen, was kommt.
Detjen: Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle, und auch das Gericht in seinen letzten Urteilen spricht immer wieder davon, dass sich da in Europa ein europäischer Gerichtsverbund entwickelt, und man das gar nicht mehr, wie man das so klassisch gewohnt ist als Nationalstaaten, in klassischen Hierarchien von Gerichten denken kann, sondern da neue Kooperations- und Kommunikationsverhältnisse zwischen Gerichten entstehen. Man redet viel miteinander, spricht sich ab, weiß, was die anderen denken. Müssen wir da Fragen von Verfassungsordnungen und von Gerichtsordnungen, die sich über viele Generationen hinweg entwickelt haben, lernen, neu zu denken?
Lenz: Also nach der Auffassung des EuGH ist der EuGH das für die Auslegung des Gemeinschafts- oder des Unionsrechts zuständige Gericht, aber kein den nationalen Gerichten übergeordnetes Gericht. Wo Unionsrecht Anwendung findet, hat er das letzte Wort - wo Unionsrecht Anwendung findet. Nicht darüber hinaus. Also ich habe mir nie vorstellen können, dass man das Grundgesetz gegen Gemeinschaftsrecht in Stellung bringen will. Wenn man die Entstehungsgeschichte des Grundgesetzes kennt - und ich war ja damals immerhin schon im heute wahlfähigen Alter - der weiß, dass die Präambel dieses Gesetz prägen sollte. Carlo Schmidt hat das als Generalberichterstatter ganz deutlich gesagt: Dieses Grundgesetz war gemacht, um die Einfügung Deutschlands in ein vereintes Europa zu ermöglichen. Das war der Zweck der Übung. Weil sich damals alle Parteien, oder jedenfalls die meisten, und 90 Prozent der Abgeordneten des Parlamentarischen Rats darüber im Klaren waren, der Weg aus der Misere führt nur über Europa.
Detjen: Aber trotzdem ist die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts von der Sorge geprägt, dass sich die Nationalstaatlichkeit, die Demokratie, die Staatlichkeit der Bundesrepublik Deutschland in einer immer dichter werdenden europäischen Verfassungsordnung auflösen könnte. Und im Lissabon-Urteil hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, ziemlich deutlich, also viel mehr Integration geht jetzt nicht, und wer dann mehr will, der muss eben - und auch der Weg ist ja im Grundgesetz vorgezeichnet, eine neue Verfassung in Deutschland schreiben und der Bevölkerung zur Abstimmung vorlegen.
Lenz: Ja, ich habe mich ja dazu geäußert. Ich glaube, das Urteil ist falsch. Ich habe es als „ausbrechenden Rechtsakt" bezeichnet. Die Bezeichnung habe ich mit Absicht gewählt, weil das Bundesverfassungsgericht diesen Ausdruck auch gebraucht hat gegenüber -
Detjen: Mit Blick auf europäische Organe.
Lenz: Genau.
Detjen: In der Rechtsprechung, in der Diktion des Bundesverfassungsgerichts, müsste man sagen, das war ein verfassungswidriges Urteil des Bundesverfassungsgerichts.
Lenz: So ist es, genau. Und ich habe damals in dem Aufsatz nur ein Argument nicht gebracht, das ich aber noch gerne bringen würde. Es gab den deutschen Vertrag mit den drei Westalliierten, und da gab es einen Artikel sieben. Da drin steht, dass sich die vertragschließenden Parteien darüber einig sind, dass Deutschland wiedervereinigt werden sollte, wenn es eine Verfassung ähnlich wie das Grundgesetz hat und in die Europäische Gemeinschaft integriert wird. Also die Integration Deutschlands in die Europäische Gemeinschaft ist eine Voraussetzung der Zustimmung der Westmächte für die Wiedervereinigung gewesen. Das sollte man nicht vergessen. Und deshalb ist diese ganze Diskussion über Euro und Wiedervereinigung Unsinn. Damals stand der Euro schon an, lange bevor man von Wiedervereinigung überhaupt nur geträumt hat. Und das war eben der aktuelle Fall, wo man sah, ob Deutschland sich in die Europäische Gemeinschaft auch weiterhin integrieren will, und deshalb ist das so gemacht worden. Also das Grundgesetz, ich will es mal knapp ausdrücken, hat nichts gegen die Vereinigten Staaten von Europa und Deutschland als Mitglied - nichts. Das ist für die Entstehungsgeschichte völlig eindeutig. Und der souveräne Nationalstaat, von dem das Bundesverfassungsgericht spricht, der steht nicht im Grundgesetz. Das Bundesverfassungsgericht beruft sich da, ich möchte schon sagen merkwürdigerweise, auf einen Schriftsteller aus dem Jahr 1888, um zu beweisen, was ein guter Nationalstaat ist. Ich glaube, nichts ist der Denkweise des Parlamentarischen Rats ferner gewesen als die Denke von 1888.
Detjen: Das Bundesverfassungsgericht beruft sich auf Artikel 38 des Grundgesetzes, auf das Demokratieprinzip, und sagt, die demokratische Teilhabe der Bürger an den Entscheidungen, die sie betreffen, ist wirklich demokratisch nur auf der nationalen Ebene bisher legitimiert, und sagt, das Europäische Parlament hat eben doch nicht die gleiche demokratische Legitimation, auch nicht die gleichen demokratischen Mitwirkungsmöglichkeiten, wie das Grundgesetz es nun einmal verlangt. Jetzt stehen wir ja wieder vor einer Wahl zum Europäischen Parlament. Da stehen zum ersten Mal Spitzenkandidaten der großen europäischen Parteienfamilien zur Wahl, die dann entsprechend den Mehrheitsverhältnissen, von denen einer dann zum Präsidenten der Europäischen Kommission gemacht werden soll. Ist das ein entscheidender Durchbruch zur Demokratisierung der europäischen Parlamentskultur?
Lenz: Nun, also schon die letzten Wahlen zum Europäischen Parlament 2009 haben ja, wenn ich das richtig sehe, schon unter der Herrschaft des Lissabon-Vertrages stattgefunden. Und schon damals hatte das Parlament Gesetzgebungsbefugnisse, die denen des Bundestages gleichkommen. Und jetzt kommt noch hinzu, das ist das Neue, dass die Parteien zum ersten Mal von dieser Bestimmung des Lissabon-Vertrags Gebrauch machen, wonach der Präsident der Kommission unter Berücksichtigung des Wahlergebnisses auszuwählen ist. Und das hat natürlich die Sache schon verändert. Sie sehen hier Martin Schulz plakatiert.
Detjen: Die SPD macht das, Ihre Partei macht es nicht. Juncker sieht man hier nicht, hier scheint man, wenn man CDU-Plakate sich anschaut, zu denken, da geht es drum, Angela Merkel zu wählen, oder nicht?
Lenz: Die Bürger werden ja darüber entscheiden, welche Form der Plakatierung sie für wirkungsvoller halten. Ich sehe dem mit Gelassenheit entgegen. Ich mache auch keinen Hehl daraus, dass ich meine, dass das eine geradezu sagenhafte Konstellation ist für die SPD, dass die Sozialdemokratischen Parteien Europas einen deutschen Spitzenkandidaten gekürt haben und dass sie damit dem Gelegenheit geben, in dem Staat, in dem die meisten Mandate zu vergeben sind, ihnen den bundesweit durch Plakate nahezubringen.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.