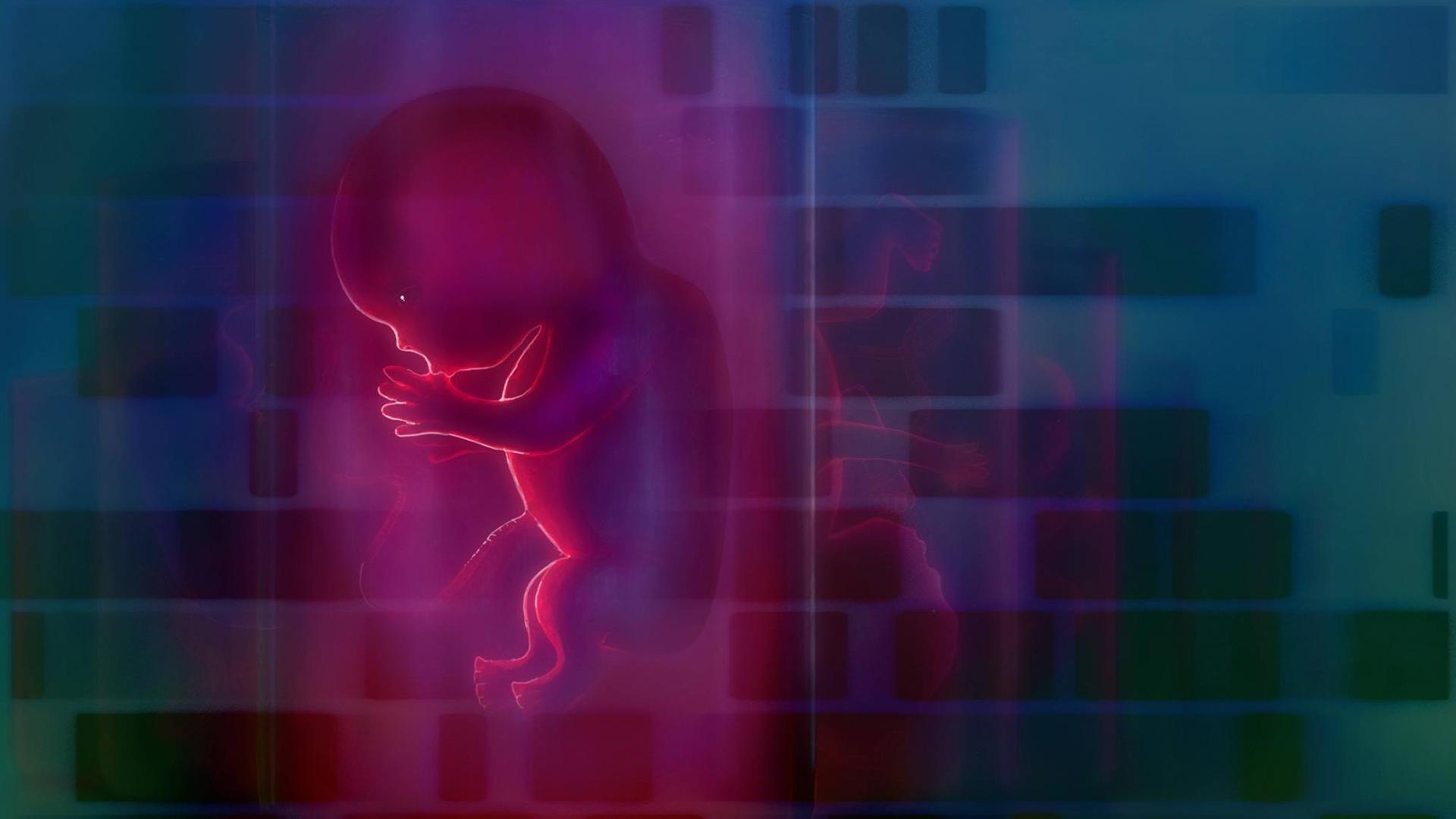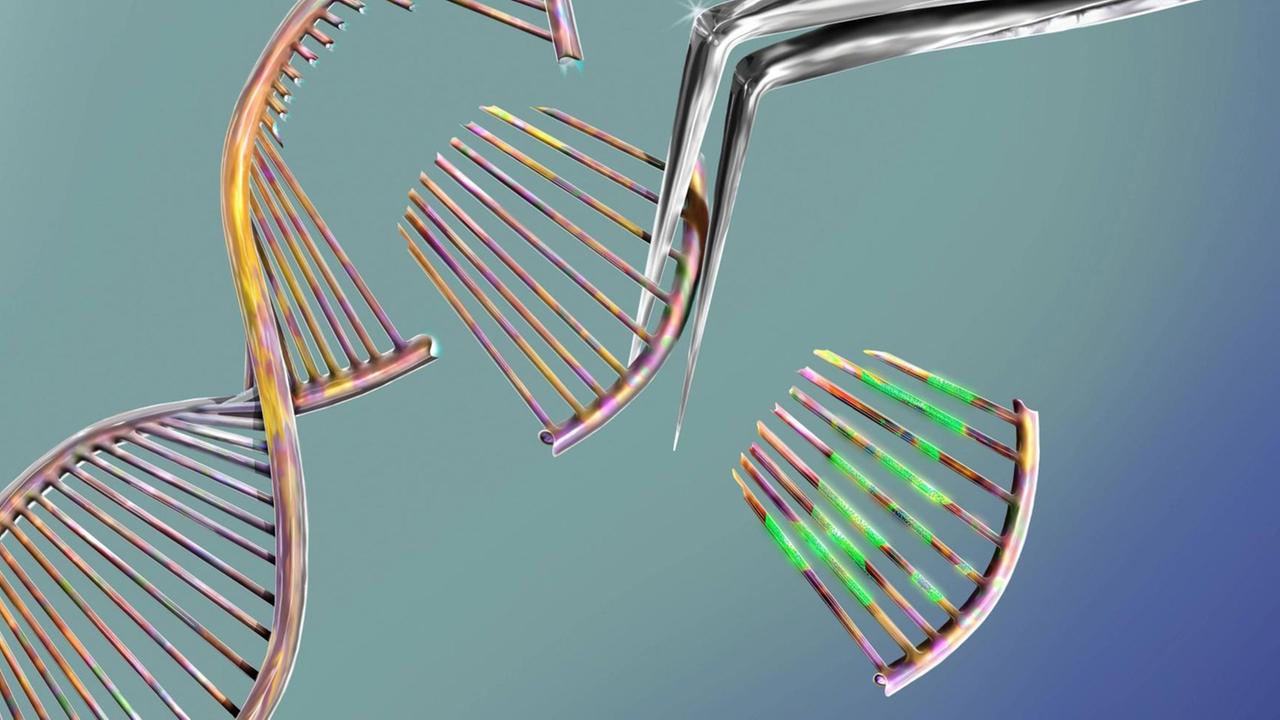
Die Quintessenz lautet: Das Verbrauchervotum ist extrem heterogen ausgefallen, mit vielen Einzelmeinungen.
Zu den 20 Verbrauchern, die sich auf Einladung des BfR mit den neuen Genscheren wie Crispr-Cas befasst haben, gehört zum Beispiel Alfred Schaller aus Heidelberg. Der 63-jährige Software-Entwickler im Vorruhestand sieht Genscheren im Ergebnis als Chance.
"Ich habe jetzt eigentlich gar keinen rationalen Grund gefunden, warum man dagegen ist. Man kann natürlich aus prinzipiell ethischen Gründen dagegen sein, in die Natur in der Form einzugreifen. Aber nach den Aussagen der Wissenschaftler, die wir gehört haben, war für mich kein wirklich rationaler wissenschaftlicher Grund zu erkennen, warum das mehr Risiko darstellen soll als die Mutagenese-Verfahren zum Beispiel, die schon seit 30, 40 Jahren, soweit ich weiß, angewendet werden."
Insgesamt drei Wochenenden haben die 20 Personen zusammengesessen und konnten auch mitentscheiden, welche Wissenschaftler, Philosophen, Juristen und Ethiker ihnen die Zusammenhänge erklären. Etwa welche Methoden der Zucht neben der Gentechnik angewendet wurden, wozu auch die Mutagenese in der Pflanzenzucht gehört, die durch radioaktive Bestrahlung zur Genveränderung führt.
Fragen blieben offen
Mediendesignerin Juliane Schindler aus Rastatt hat da zwar viel Neues gelernt, aber ihre ursprüngliche kritische Haltung zu gentechnischen Verfahren nicht verändert.
"Es sind so viele Fragen offen, die auch die Wissenschaftler, die Experten, uns nicht so beantworten konnten. Da sind so die Risiken, glaube ich, doch etwas unabschätzbar noch, und von dem her hat sich meine persönliche Meinung da nicht grundsätzlich geändert."
Dass man sowohl Gene als auch Genscheren patentiert, findet Juliane Schindler ebenfalls nicht richtig.
Die 20 Teilnehmerinnen wurden nach einer öffentlichen Ausschreibung nach demografischen Faktoren wie Alter, Geschlecht und Bildungsstand ausgewählt, erklärte Gaby-Fleur Böl, die Leiterin der Abteilung Risikokommunikation im Bundesinstitut für Risikobewertung. Die Einstellung zur Gentechnik sei kein Auswahlkriterium gewesen.
"Das hat überhaupt keine Rolle gespielt. Das haben wir auch nicht abgefragt. Es gab ein Ausschlusskriterium. Das Ausschlusskriterium war, ob man beruflich damit zu tun hat. Wir wollten ganz sicher vermeiden, dass irgendjemand, der zum Beispiel bei einem Konzern arbeitet, der diese Methoden benutzt, dass der sich dadurch eventuell irgendwie einen Vorteil oder so schafft. Das war das Ausschlusskriterium. Wir haben die Personen nicht gefragt, was sie eigentlich für eine Meinung dazu haben, sondern nur abgefragt, ob sie Interesse am Thema haben."
Die Verbraucher bekamen für ihren Einsatz 500 Euro Aufwandsentschädigung, Reisekosten und die Übernachtungen in Berlin bezahlt - aus den Mitteln des BfR, also letztlich vom Steuerzahler.
Verbraucherkonferenz spiegelt gesellschaftliche Debatte
In ihrem abschließenden Verbrauchervotum werden sowohl Chancen als auch Risiken von Genscheren und letztlich uralte Pro- und Contra-Argumente dieser Methoden aufgeführt. Eigentlich nichts Neues also. Das sieht Gaby-Fleur Böl trotzdem als Gewinn.
"Letztlich ist was sehr Kontroverses raus gekommen. Somit spiegelt das sehr schön wider, was man mit einer Verbraucherkonferenz erreichen möchte, nämlich dass es gesellschaftlich einen Diskurs gibt und dass man eben am Ende keinen Konsens hat, sondern einen konstruktiven Dissens. Es könnte sein, dass man zum Tierwohl beiträgt, auch zum Beispiel dazu, dass es weniger Tierexperimente geben muss in der wissenschaftlichen Forschung. Mögliche Risiken könnten sein, dass zum Beispiel bei der Heilung von Krankheiten gewisser gesellschaftlicher Druck entsteht, dass man sozusagen die Methode nutzen muss, um eben kein behindertes Kind zur Welt zu bringen. Also somit wird das abgebildet werden was möglich ist und was die Verbraucher glauben, wo man aufpassen müsste, aber auch was man fördern sollte, zum Beispiel Risikoforschung."
Im Laufe des Tages werden die Ergebnisse sowohl Vertretern aus der Politik, wie auch dem Präsidenten des Lebensmittelverbandes und dem Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) vorgestellt werden.
Anne Markwardt vom vzbv sagte in einer ersten Einschätzung, dass sie dem BfR dankbar sei für diese Bestandsaufnahme, sie decke sich im Ergebnis mit repräsentativen Befragungen. Vor allem freut sie, dass die Verbraucher die neuen Genscheren wie die alten Gentechnikverfahren einstufen würden und am Vorsorgeprinzip festhalten wollten.